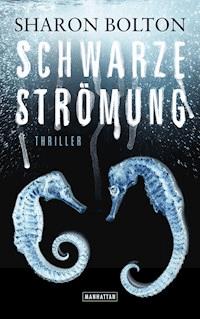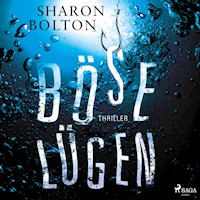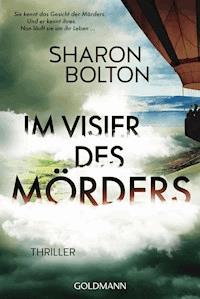
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Sharon Bolton ist die weibliche Ausgabe von Simon Beckett.« www.denglers-buchkritik.de
Atmosphärische Handlung, vielschichtige Charaktere und mörderische Spannung – das sind Boltons Markenzeichen.
Friedliche Morgenstimmung liegt über den Hügeln und Wäldern nahe der schottischen Grenze. Zwölf Menschen genießen die prachtvolle Aussicht, die ihnen der Ausflug mit einem Heißluftballon bietet – und müssen plötzlich mit ansehen, wie am Boden eine Frau erschlagen wird. Als der Mörder von seinem Opfer ablässt und den Blick gen Himmel richtet, steht das Schicksal dieser Menschen auf Messers Schneide. Der Mann schultert sein Gewehr und nimmt die Verfolgung auf. Eine grausame Jagd beginnt. Am Ende wird nur eine Zeugin entkommen. Sie kennt das Gesicht des Mörders. Und er kennt ihres. Nun läuft sie um ihr Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Friedliche Morgenstimmung liegt über den Hügeln und Wäldern nahe der schottischen Grenze. Zwölf Menschen genießen die prachtvolle Aussicht, die ihnen der Ausflug mit einem Heißluftballon bietet – und müssen plötzlich mitansehen, wie unter ihnen am Boden eine Frau getötet wird. Als der Mörder von dem Opfer ablässt und den Blick gen Himmel richtet, steht das Schicksal dieser Menschen auf des Messers Schneide. Der Mann schultert sein Gewehr und nimmt die Verfolgung auf, offensichtlich will er keine Zeugen riskieren. Eine grausame Jagd beginnt. Am Ende wird nur eine Frau entkommen. Kann sie den Killer stoppen?
Weitere Informationen zu Sharon Bolton
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Sharon Bolton
________________
Im Visier des Mörders
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Replace outdated disclaimer texts as necessary, make sure there is only one instance of the disclaimer.
Die englische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Dead Woman Walking« bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London.
Deutsche Erstveröffentlichung September 2018
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Sharon Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: mauritius images / imageBROKER / Julie Woodhouse; FinePic®, München; Efrain Padro / Alamy Stock Foto
Redaktion: Uta Rupprecht
mb · Herstellung: kw
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22154-6V002
www.penguin.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Freunde in Ealing, die einfach wunderbar waren
1. Kapitel
»Eigentlich sollte die Frau, diese Jessica Lane, tot sein. Elf Personen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Lane hingegen hat nicht nur überlebt, sie ist verschwunden. Sie ist und bleibt verschwunden.
Also möchte ich wissen, wo sie ist. Und ich möchte wissen, wieso sie sich nicht gemeldet hat. Warum sie keine Hilfe sucht. Warum sie der Polizei ganz offensichtlich aus dem Weg geht.
Ich will wissen, vor wem sie auf der Flucht ist.
Und vor allem will ich, dass sie gefunden wird.«
Teil 1
2. Kapitel
Mittwoch, 20. September
Der Ballon hing in der Luft wie eine umgedrehte Christbaumkugel; seine pralle, bunt gestreifte Hülle spiegelte sich im See. Im Morgenlicht leuchtete das Wasser wie ein reifer Pfirsich, blassgolden an den Rändern, ein dunkles, sattes Rosa in der Mitte. Es war windstill. Kein Laut war zu hören, sogar die Bäume am Ufer hatten aufgehört zu rauschen. Keiner der Insassen des Ballons rührte sich oder sagte etwas. Die Welt schien den Atem anzuhalten.
Unter ihnen breitete sich die weite, von Heidekraut bedeckte Moorlandschaft des Northumberland National Park aus. Endlose Grasflächen wogten wie das Fell eines riesigen erwachenden Tieres, Bäche schimmerten wie silbrige Schlangen, und der Sonnenaufgang ließ die Hügelkuppen erglühen. Die urtümliche Landschaft war überwältigend und seit Jahrhunderten unverändert, es war, als wäre der Ballon eine Zeitmaschine, die sie zurückbrachte in jene Epoche, als im äußersten Norden Englands noch weniger Menschen gesiedelt hatten als jetzt. Sie sahen keine Straßen, keine Bahnschienen, keine Städte oder Dörfer.
Abgesehen von ihrer dreizehnköpfigen Gruppe schien die Welt völlig leer zu sein.
Der Korb des Ballons war, wie bei Vergnügungsfahrten üblich, groß und rechteckig und in vier Abteile unterteilt, damit die Passagiere sich nur innerhalb bestimmter Bereiche aufhalten konnten. Der Ballonführer hatte ein eigenes Abteil in der Mitte. In einer der vier Ecken standen zwei Frauen zwischen Mitte und Ende dreißig, die eine ganz in Schwarz, die andere grün gekleidet. Die beiden sahen sich nicht ähnlich genug, um Zwillinge zu sein, waren aber definitiv Schwestern. Die Frau in Schwarz ließ beim Ausatmen einen leisen Ton vernehmen, zu laut, um ein Seufzer zu sein, zu glücklich für ein Aufstöhnen.
»Gern geschehen.« Ihre Schwester lächelte.
Die Frauen teilten sich das Abteil mit einem Buchhalter aus Dunstable. Seine Frau und die beiden halbwüchsigen Kinder standen in der benachbarten Abtrennung. Auf der anderen Seite des Ballons befanden sich drei Männer auf Wanderurlaub, deren Anoraks in Rot, Gelb und Grün an eine Verkehrsampel denken ließen, sowie ein älteres schottisches Ehepaar und ein Journalist im Ruhestand.
Der Korb beschrieb langsame, bedächtige Spiralen, während sie über dem See dahintrieben. Dieses ständige Kreiseln war eine der größten Überraschungen gewesen, und auch, wie sich die Luft in großer Höhe anfühlte, schneidender und frischer als am Boden. Kühl, aber nicht so unangenehm kalt wie an einem frostigen Morgen. Diese Luft kribbelte auf der Haut und prickelte beim Einatmen.
Die Frau in Grün, Jessica, trat ein wenig näher zu ihrer Schwester, die blass geworden war und den Rand des Korbes umklammerte. Mit großen, staunenden Augen schaute sie unverwandt auf die Wasseroberfläche hinab. Urplötzlich überfiel Jessica ein verstörender Gedanke: Hatte ihre Schwester vielleicht vor runterzuspringen?
Kurze Zeit später würde sie denken, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie beide gesprungen wären. Ein oder zwei grauenhafte Sekunden und ein schmerzhafter Aufprall auf der Oberfläche wären nicht so schlimm gewesen. Vielleicht hätte das kühle, erstickende schwarze Wasser ihr Ende bedeutet, doch es hätte sie auch wieder nach oben und ans Ufer treiben können. Wären sie in diesem Moment gesprungen, hätten sie vielleicht beide überlebt.
»Ist das nicht toll?«, fragte sie, weil sie nämlich schon vor langer Zeit die Erfahrung gemacht hatte, dass sie manchmal durch gezielte Ablenkung voreilige Handlungen ihrer Schwester verhindern konnte. »Macht’s dir Spaß? Ich fasse es nicht, dass wir das noch nie gemacht haben.«
Isabel lächelte, sagte jedoch nichts, weil eine Antwort überflüssig war. Sie war ganz offensichtlich hingerissen.
»Wunderschön, nicht wahr? Schau doch mal, die Farben.«
Immer noch keine Antwort, doch Jessica sah befriedigt, wie ihre Schwester den Kopf hob und strahlend auf die Bäume blickte, die bis dicht ans Ufer heranreichten. Wie Damen auf einem Ball rangelten sie um die besten Plätze; ihre wallenden Laubkleider reichten bis zum Boden und waren so miteinander verdrillt, dass es unmöglich war zu erkennen, wo eins aufhörte und ein anderes begann. Dahinter zogen sich, schimmernd wie Edelmetall, die Hügel endlos dahin.
»Jetzt sind wir über dem Harcourt Estate.« Seit dem Abflug war der Ballonführer der Einzige, der nicht im Flüsterton sprach. »Das ursprüngliche Herrenhaus befand sich auf dem Hügel direkt vor uns, es wurde aber Ende des 19. Jahrhunderts durch einen Brand zerstört.«
»Fliegen wir nicht zu tief?« Der ehemalige Journalist mit schütterem Haar und Bauch betrachtete stirnrunzelnd die schnell näherkommenden Bäume.
»Keine Sorge, Leute, ich mach das nicht zum ersten Mal.« Der weit über eins achtzig große Ballonführer kitzelte die Luft über dem Brenner mit einem kurzen Flammenstoß, und die, die ihm am nächsten standen, spürten den Schwall ofenheißer Luft auf dem Scheitel. »Hier fliege ich immer gern tief, in diesem Wald hat man nämlich fast die beste Chance, rote Eichhörnchen zu sehen. Und Fischadler, obwohl’s dafür schon ein bisschen spät im Jahr ist.«
Es folgte hektisches Hantieren mit den Kameras, alle drängten sich zu der dem Wald zugewandten Korbseite. Keine der beiden Schwestern hatte eine Kamera dabei, daher waren sie die Ersten, die das verfallene obere Stockwerk des Hauses erblickten, das wie ein schlimm verfärbter Zahn aus dem Blätterdach auftauchte. Die schwarz gekleidete Schwester erschauderte.
»Dieses Haus stammt aus dem 16. Jahrhundert, es wurde zu Verteidigungszwecken erbaut«, sagte der Pilot, während der Ballon höher stieg, um den Baumwipfeln auszuweichen. »Damals hatte man von dort aus noch einen völlig freien Blick übers Land, fast achtzig Kilometer weit. Noch fünfzehn Minuten bis zur Landung, Leute.«
»Ist das einer? Ganz oben, da auf dem breiten Baum mit den gelben Blättern? Graubraunes Gefieder.« Einer der Wanderer zeigte nach hinten auf die Baumwipfel, und die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich von dem Haus ab.
»Könnte sein.« Der Ballonführer hob seinen Feldstecher und stand nun mit dem Rücken zur Fahrtrichtung.
»Da unten ist jemand.«
»Wo? Im Wald?« Jessica folgte dem Blick ihrer Schwester, aber so gut wie Isabel hatte sie noch nie sehen können. Isabels Gehör war ebenfalls besser, und sie bemerkte auch Gerüche oder einen merkwürdigen Geschmack im Essen stets als Erste. Als wäre sie die sauberer und genauer Gearbeitete von beiden.
»Hinter dem Haus.«
Jessica stellte sich auf die Zehenspitzen. Über die Schulter ihrer Schwester hinweg konnte sie die großen, klaffenden Löcher im Dach und die baufälligen Mauern sehen.
»Ein Mädchen. Es rennt.«
Dicht genug, um winzige Mooskissen und geborstene Dachschindeln erkennen zu können, flog der Ballon über das Haus. Abgelenkt durch sein Bemühen, einen Fischadler auszumachen, hatte sie der Ballonpilot noch tiefer herabsinken lassen.
»Dort.«
Die dahinhuschende Gestalt – eine junge Frau, schlank und dunkelhaarig und in blauer Kleidung, die irgendwie fernöstlich wirkte – hatte die gegenüberliegende Gartenmauer erreicht.
»Was macht sie denn da?«
Hinter ihnen versuchten die anderen, Fotos von dem Fischadler zu machen, und der Journalist erteilte Ratschläge, wie man am besten Tiere in der Wildnis fotografierte. Nur die beiden Schwestern beobachteten die junge Frau unten am Boden. Rasch sah Jessica sich um, zögerte aber, ob sie die anderen darauf aufmerksam machen sollte oder nicht. Sie griff in ihre Jackentasche und fand ihr Handy.
Unten im Garten umrundete ein Mann langsam, aber zielstrebig eine Reihe Büsche. Von oben konnten die Schwestern lediglich erkennen, dass er klein und stämmig war. Er trug eine weite Lederjacke und einen dunklen Hut, ebenfalls aus Leder, einen Trilby mit schmaler Krempe. Ein weißes Hemd. Unter der Hutkrempe waren schwarze Locken zu sehen.
Neben ihm trottete ein großer Schäferhund.
»Oh!« Jessica drückte sich noch dichter an ihre Schwester. »Bella, halt still, lass mich kurz …«
Beim Anblick des Mannes duckte sich das Mädchen und verschränkte die Hände über dem Kopf.
»Was denn?«, fragte Isabel.
»Ich fasse es nicht! Das ist er.«
»Wer? Jess, kennst du den Mann?«
»Sean!« Jessica griff nach hinten, berührte den Ballonführer am Ärmel. »Das müssen Sie sehen.«
»Was ist los?« Er drehte sich zu ihnen um, und der Buchhalter folgte seinem Beispiel.
»Der hat ein Gewehr.« Der halbwüchsige Sohn des Buchhalters hatte das Paar am Boden erblickt und zeigte auf etwas in der linken Hand des Mannes, was anscheinend ein Gewehr oder eine Schrotflinte war. In der Rechten hielt er einen großen Stein.
»O mein Gott, tatsächlich«, stieß die Mutter des Teenagers hervor. »Was machen wir denn jetzt?«
Sie sprachen noch immer in schrillem Flüsterton.
Auch andere im Korb hatten das Interesse an dem Fischadler verloren, weitere Köpfe drehten sich zu ihnen herum. Das Mädchen unten auf dem Boden schaute auf, sah den Ballon und fing an zu schreien. Der Mann, der den Ballon und die Passagiere noch nicht bemerkt hatte, hob den Stein hoch über den Kopf. Das Mädchen drückte sich fest gegen den Erdboden. Der Mann ließ den Stein herabsausen.
Von dem Mädchen kam kein weiterer Schrei. Der unterdrückte Aufschrei, deutlich vernehmbar in der Morgenluft, stammte von jemandem im Ballonkorb. Es war das einzige Geräusch, sie waren vor Schreck erstarrt. Der Mann unten am Boden drehte sich um und schaute nach oben, genau wie sein Hund. Der Hund begann zu bellen. Die Passagiere sahen, wie der Mann den Stein fallen ließ und mit einer Hand seinen Hut festhielt, während er den Kopf in den Nacken legte und nach oben starrte.
»Um Gottes willen!«, stieß Jessica hervor.
Die Luft um sie herum brüllte auf, als Sean das Ventil öffnete und die Flamme hochschießen ließ, doch bei der Vorbesprechung hatte er ihnen erklärt, dass auf jede seiner Aktionen eine sekundenlange Verzögerung folgen würde. Es konnte bis zu zehn Sekunden dauern, ehe der Ballon richtig emporstieg. Isabel, die sich wohl ebenfalls daran erinnerte, zählte leise: »Zehn, neun …«
Jessica hob ihr Handy, schaltete in den Kameramodus und machte ein Foto von dem Mann. Er sah, dass sie das tat. Einen Moment lang blickte er ihr direkt in die Augen.
»Acht, sieben …«
Der Mann am Boden nahm das Gewehr in die rechte Hand.
»Runter! Alle runter!« Jessica drückte ihre Schwester unter den Korbrand und duckte sich ebenfalls, dann griff sie hinter sich und zerrte am Arm des Buchhalters. Da sie nicht vollkommen in Deckung gehen konnte – es war einfach nicht genug Platz, dass alle im Korb knien konnten –, hielt sie den Blick fest auf den Mann unter sich gerichtet. Der obere Teil ihres Kopfes war gefährlich ungeschützt.
Der Hund lief jetzt aufgeregt im Kreis und bellte das komische Ding an, das da am Himmel hing.
»Sechs, fünf …«, zählte Isabel.
Jessica war, als würden sie nun steigen, aber nur langsam. Einige der Leute standen immer noch aufrecht da. »Runter mit euch«, versuchte sie es noch einmal.
Eine weitere Flamme zischte empor, genau in dem Moment, als der Mann unten am Boden sein Gewehr hob. Schreckenslaute ertönten in der stillen Morgenluft. Die Passagiere begannen zu schreien, sie brüllten sich gegenseitig an, brüllten den Ballonführer an. Als der Buchhalter den Arm ausstreckte und seine Frau und seine Kinder in den Korb hinunterdrückte, fing der Ballon an, sich zu drehen, und trug die beiden Schwestern weiter von dem Drama unten am Boden weg.
»Vier, drei …« Sie stiegen definitiv, und jetzt auch schneller.
»Festhalten!« Sean betätigte den Brenner ein drittes Mal.
»Zwei, eins.« Im Kopf zählte Jessica noch eine weitere Sekunde herunter, und dann noch eine.
Ja, jetzt stiegen sie rasch. Der Ballon trieb über die Gartenmauer hinweg und gewann mit jeder Sekunde mehr an Höhe.
»Ah, Gott sei Dank!« – »Schnell, bringen Sie uns rauf!« – »Du meine Güte! Lasst bloß alle die Köpfe unten!«
Der Korb drehte sich zurück, und sie konnte den Garten wieder sehen. Durch einen Torbogen, in dem wohl einmal eine feste Holztür gehangen hatte, war der Mann auf das freie Gelände hinter dem Haus hinausgetreten. Jessica hob das Handy und fotografierte ihn abermals. Diesmal hatte sie freies Schussfeld. Unglücklicherweise galt das auch für ihn.
»Köpfe runter! Köpfe runter!«
Jessica hatte keine Ahnung, wer da brüllte; wahrscheinlich war es der Ballonführer, doch sie konnte sich nicht rühren, konnte sich nicht einmal ganz unter den Rand des Korbes ducken. Sie hielt den Blick weiterhin auf den Mann gerichtet, der das Gewehr gehoben und den Kolben gegen die Schulter gestützt hatte und sich jetzt an die Mauer lehnte.
Er zielte auf sie. Sie war sich ganz sicher.
Auf den Schuss – so laut, so deutlich, so sehr, sehr nahe – folgten etliche Sekunden schockierten Schweigens. Dann war leises Gemurmel und ein gedämpftes Aufstöhnen zu vernehmen. Das junge Mädchen begann zu schluchzen.
Der Ballon stieg jetzt sehr schnell, der Erdboden blieb immer weiter zurück. Schon waren die beiden Gestalten – die eine zusammengerollt wie eine erschlagene Schlange, die andere an einer Anhöhe entlang rasch ausschreitend, als wollte sie den Ballon einholen – nicht mehr deutlich zu erkennen. Aus dem Augenwinkel sah Jessica einen zweiten Kopf über dem Korbrand auftauchen. Sie hörte Bewegungen, Scharren am Korbgeflecht. Die anderen Passagiere rappelten sich auf. Ihre Schwester drängte sich gegen sie, und sie lehnte sich zurück, um Isabel aufstehen zu lassen.
»Ist das gerade wirklich passiert?« – »Ich fasse es nicht!« – »Sind alle okay?« – »Helen? Poppy? Nathan? Sagt doch was!«
Der Mann dort unten hob abermals das Gewehr, und der Korb schaukelte, als alle sich duckten. Diesmal blieben die beiden Schwestern, wo sie waren. Sie waren jetzt sehr hoch oben, wahrscheinlich höher, als sie es seit Beginn des Ausflugs überhaupt gewesen waren, und etliche hundert Meter weit entfernt. Bestimmt waren sie in Sicherheit.
»Hat man hier oben Netzempfang?« Der Journalist kauerte noch immer unterhalb des Korbrandes. »Wir müssen die Polizei rufen.«
Jessica hatte bereits auf ihr Handy geschaut. Nichts. Im Northumberland National Park hatte man wenig bis gar kein Netz. Er war und blieb eine der abgelegensten Gegenden des Landes, dünn besiedelt und schwer zu erreichen.
Allmählich kamen die Köpfe wieder nach oben. Der Buchhalter, der sich vorhin als Harry vorgestellt hatte, streckte die Hand nach seiner Frau aus, die jeweils einen Arm um ihre beiden Kinder geschlungen hatte. Sichtlich erschüttert blickten die Leute auf die Anhöhe hinab, auf das verfallene Haus und den herbstlichen Flickenteppich des Waldes. Der See schimmerte noch immer im Morgenlicht wie ein weggeworfener Penny. Er schien weit weg zu sein.
»Es ist alles in Ordnung. Bleibt ganz ruhig. Nat, alles klar? Es ist vorbei, wir sind jetzt zu weit weg. Ich kann ihn nicht mal mehr sehen. Großer Gott, hab ich das eben wirklich mitangesehen?«
Jessica konnte fühlen, wie die Spannung nachließ, als Entsetzen der Erleichterung wich. Erneut schaute sie auf ihr Handy. Dort unten am Boden war eine Frau, die nicht entkommen konnte. Vielleicht hatte ja jemand mit einem anderen Netzbetreiber mehr Glück. Sie öffnete den Mund, um alle zu bitten, ihre Handys zu überprüfen …
Plötzlich Kreischen wie ein Hammerschlag.
Wie ein Mann drehten sich die Passagiere nach der Lärmquelle um. Auf der anderen Seite des Korbes stand eine ältere Lehrerin namens Natalie und schrie wie am Spieß, die Hände fest gegen das Gesicht gepresst. Ihr Mann umklammerte ihre Schulter und versuchte, sie zu sich herumzudrehen.
Die anderen Passagiere schauten sie an, folgten ihrem Blick und erkannten sofort, dass etwas fehlte. Und dass das eine Katastrophe verhieß.
Sean, der große rothaarige Ballonführer, stand nicht mehr aufrecht in der Mitte des Korbes, eine Hand am Brennerventil und den Feldstecher in der anderen. Diejenigen, die seinem Abteil am nächsten waren, reckten die Hälse, um zu sehen, ob er vielleicht außer Sicht am Boden des Korbes kauerte. Der Junge wurde von seinem Vater zurückgezerrt, einer der Wanderer wandte sich mit angewidertem Gesicht ab.
»Was ist denn?« – »Wo ist er?« – »Wo ist er denn hin?«
Jessica schob sich näher heran und stellte sich auf die Zehenspitzen, um über die Schulter des Buchhalters blicken zu können, dann hob sie erneut ihr Handy, um Fotos zu machen.
Das Innere des Pilotenabteils sah aus, als hätte dort jemand eine Dose mit roter Farbe verteilt. Blut und ein zäher grauer Schleim liefen an den geflochtenen Wänden entlang. Am Boden des Korbes lag ein Gewirr aus Gliedmaßen und Torso.
Dem Piloten war der Kopf glatt vom Rumpf geschossen worden.
3. Kapitel
Er hatte den Ballonführer mit einem einzigen Schuss ausgeschaltet. Selten hatte in seinem Leben etwas so gut geklappt. Patrick spürte das Kribbeln am ganzen Körper, Energie strömte durch seine Adern wie kleine Elektroschocks. Jetzt hatte er die Frau mit der grünen Jacke im Visier. Er atmete tief ein, hielt die Luft an und spürte, wie sein Finger am Abzug glühte. Blöd wie ein Kaninchen starrte sie ihn an, in einer Zehntelsekunde würde ihr Gehirn durch die Luft spritzen wie die Funken eines Feuerwerks. In dem Bewusstsein, dass die Jagd gleich zu Ende sein würde, verspürte er ein vertrautes Regen im Schritt, und auf seiner Brust schien sich der Umriss des Kruzifixes durch das Hemd und in seine Haut zu brennen.
Aber der verdammte Korb drehte sich wieder, sodass der Kopf der Frau aus der Schusslinie geriet und teilweise von einem der starken Drahtseile, die den Korb trugen, verdeckt wurde. Und mit jeder Sekunde, die verstrich, stiegen sie höher in den Himmel empor. Weitere Köpfe erschienen und verschwanden, wenn sie ihn erblickten, ruckartig wieder hinter dem Korbrand. Er zählte sechs, acht, vielleicht auch zehn Leute. Nur noch ganz wenig Zeit.
»Schnauze, Shinto.« Patrick trat nach dem Hund, der ihm so geschickt auswich, als hätte er jahrelange Übung darin.
Er könnte auf den Korb schießen. Das Geflecht würde die Geschosse nicht abhalten; er würde die meisten erledigen, indem er einfach drauflosfeuerte. Da, jetzt, der sauberste Schuss, den er je kriegen würde. Sie sah ihn direkt an, hatte sich sogar aufgerichtet und schaute ihn an, fast so, als würde sie ihn kennen … Ganz sachte zog er am Abzug.
Und hielt inne. Er durfte nicht noch mehr von denen abknallen. Einer war vielleicht schon zu viel gewesen. Das sollte doch wie ein Unfall aussehen. Die anderen mussten eben beim Absturz draufgehen.
Kein Problem. Eigentlich war das ja auch viel lustiger.
Patrick ließ das Gewehr sinken und sah dem davondriftenden Ballon nach. Dann holte er sein Handy hervor. Kein Empfang. Hier draußen hatte man nie welchen. Keiner von ihnen würde in nächster Zeit Hilfe herbeirufen oder den Vorfall melden.
Hinter ihm erinnerte ihn ein leises Stöhnen daran, dass er hier noch nicht fertig war. Mit dem Hund bei Fuß ging er zurück in den Garten.
Die junge Frau auf dem Boden hatte noch einen Puls, aber nur schwach. Sie blutete aus der Platzwunde am Kopf, und möglicherweise auch aus einem Ohr. Er hob eine schwarze Haarsträhne an, beugte sich hinab und drückte sie gegen sein Gesicht. Sie roch fettig und nach Schweiß, und als er sie angewidert fallen ließ, öffnete die Frau die Augen. Fokussieren konnten sie nicht. Ihre Augen waren schwarz, doch es war kein Leuchten mehr darin. Sie stöhnte, versuchte aber nicht, sich zu bewegen.
Drei Minuten lang betrachtete Patrick sie – Minuten, die er nicht übrig hatte. Er legte ihr langes Haar so, dass es ihr Gesicht bedeckte, hob die Finger jedoch nicht noch einmal an die Nase. Die Farbe passte, sie war so, wie er es mochte, aber der Geruch stimmte nicht. Er trat zurück, musterte den Umriss ihres dünnen Körpers unter den schmutzigen Kleidern und hatte dabei Gedanken, für die er laut seiner Ma auf direktem Weg in die Hölle kommen würde.
Die Zeit wurde knapp. Er schulterte das Gewehr, rannte durch den Garten, durch das verfallene Haus und zur Haustür hinaus, wo sein Quad wartete. Er stopfte den Hut in die Tasche, drehte den Zündschlüssel und fuhr um die Vorderseite des Hauses herum. Shinto lief hinterher. Wenn es sein musste, konnte er den ganzen Tag mit dem Quad mithalten
4. Kapitel
Der Schock hatte den Ballon erfasst wie ein eisiger Windstoß. Ganz hinten in der Ecke des Korbes brüllte einer der Wanderer Anweisungen, die niemand richtig verstehen konnte. Der Junge, der mit seinem Handy Fotos von dem toten Ballonführer machte, zappelte und zuckte in schreckhaften, nervösen Bewegungen. Sein Vater hingegen schien völlig erstarrt zu sein. So weit entfernt von dem Toten, wie es nur ging, klammerten sich Mutter und Tochter krampfhaft aneinander.
Natalie hatte sich an ihrem Mann festgekrallt und schrie die ganze Zeit, sie müsse runter, sie müssten sie runterbringen, sie könne wirklich nicht noch mehr ertragen, und könnten sie sie bitte sofort runterbringen.
Unter ihnen hatte die Erde den größten Teil ihrer Farben und ihr Leuchten eingebüßt. Beinahe aus dem Nichts heraus hatten sich schwere Wolken am Himmel zusammengeballt, die dem Park seine Schönheit nahmen. Jetzt sah er öde und leer aus. Ein Ort, von dem keine Hilfe zu erwarten war.
Der Ballon stieg immer noch, wurde schneller; sein Schatten jagte über den Boden. Auch die Luft um sie herum wurde kälter. Das sanfte Hautkribbeln zu Beginn des Fluges war der stechenden Kälte eines fast winterlichen Morgens gewichen. Zum ersten Mal, seit sie losgeflogen waren, verspürte Jessica Übelkeit.
Eine kalte Hand schloss sich sachte um ihre. »Was machen wir jetzt?«, fragte Isabel.
Auf der anderen Seite des Pilotenabteils standen die drei Wanderer. Bleich, aber gefasst, genau wie der Journalist.
»Wir brauchen einen neuen Piloten.« Jessica zwang sich, möglichst gelassen zu klingen und sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. »Das ist ja kein Düsenjet. Es geht rauf, es geht runter. Kann doch nicht so schwer sein.«
Einer der Wanderer, ein Mann namens Nigel, sagte: »Ich bin Ingenieur. Hält jemand sich für qualifizierter?«
»Jetzt tu doch jemand was«, jammerte Natalie. »Ich will nicht sterben.«
»Niemand wird hier sterben.« Der Wanderer in Rot, Walter, war ein lauter Mann, der aus vollem Hals redete und lachte. Die Angst ließ ihn noch lauter werden.
»Wir haben jede Menge Zeit«, versicherte Martyn, der Journalist. »Wir können bis auf etwa dreitausend Meter rauf, bevor wir Sauerstoff brauchen. Das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten.«
So weise Worte. So schwer zu befolgen. Wie ein gigantischer Raubvogel war die Panik auf sie herabgestoßen. Jessica mochte gar nicht nach oben schauen, um das Vieh nicht zu sehen, das über ihren Köpfen im Traggerüst des Korbes hockte, lüstern auf sie herabgrinste und darauf wartete, dass sie die Beherrschung verloren. Stattdessen warf sie einen raschen Blick über den Korbrand. Die Landschaft unter ihnen schien nicht mehr kleiner zu werden.
»Hilf mir mal da rauf, Walter.« Nigel langte nach oben und packte die lederumhüllten Drahtseile.
Natalie riss sich von ihrem Mann los und begann zu kreischen, sie schoss ihre Angst in die immer dünner werdende Luft hinaus.
»Seien Sie still!« Der letzte der drei Wanderer – Bob – deutete mit dem Finger auf Natalies Mann und sagte: »Sie, sorgen Sie dafür, dass sie den Mund hält. Ihr haltet jetzt alle den Mund, sonst schmeiß ich euch eigenhändig über Bord.«
Jemand mit einem zornroten Gesicht erwiderte: »Das ist ja nun wirklich nicht nötig.«
»Wir sollten alle versuchen, ruhig zu bleiben«, hörte Jessica ihre Schwester sagen. »Jeder von uns hat Angst, aber es gibt doch vieles, was wir tun können.«
Auf Isabel hörten sie. Sie unterdrückten ihre Schreie, dämpften das Schluchzen. Doch die Ruhe war fragil, so zart wie eine Seifenblase. Sie konnte jeden Moment platzen.
Nigel, der gefährlich luftig auf dem Rand des Ballonführerabteils stand, schwankte. Mit aschfahlem Gesicht sprang er hinein. »Scheiße.« Er wandte sich seinen beiden Freunden zu. »Ich kann hier drinnen überhaupt nichts sehen, verdammt noch mal. Sean muss raus.«
Walter starrte ihn an. »Wie meinst du das, raus?«
»Schaut ihn euch doch an.«
Als die Nächststehenden nach vorn drängten, tat Bob etwas, was unsinnig gewagt erschien. Er hielt sich an den Drahtseilen fest, die den Korb mit dem Ballon verbanden, und sprang hoch, sodass er auf dem äußeren Rand des Korbes saß. Alle schauten in das Abteil in der Mitte, das so eng war, dass lediglich eine Person darin stehen konnte. Der Ballonführer war ein großer Mann gewesen. Tot und zusammengesackt nahm er den ganzen Platz am Boden ein.
»Wir müssen ihn über Bord werfen.«
»Das können wir doch nicht machen. Leg ihn hin.«
»Das geht nicht, dann können wir uns nicht rühren.«
»Werft ihn in das Abteil da drüben«, sagte Martyn.
Ein neuerlicher Aufschrei von Natalie. »Nicht rein zu uns! Das ertrage ich nicht.«
Der Journalist fuhr zu ihr herum. »Wir können ihn doch nicht einfach über Bord werfen.«
»Herrgott, er ist tot, toter kann er doch nicht mehr werden.«
Jetzt musste Jessica etwas sagen. »Wir steigen nicht mehr«, rief sie. »Wir haben sogar ziemlich an Höhe verloren. Egal, was wir tun, wir müssen uns beeilen.«
Bob sprang vom Korbrand. »Natalie hat recht. Das ist nicht der richtige Moment für Sentimentalitäten. Er muss raus.«
»Ich klettere rüber und fasse mit an, Nigel«, erbot sich Walter.
Nigel nickte. »Martyn, schaffen Sie’s, uns zu helfen? Meine Damen, tut mir leid, aber Sie müssen vielleicht an seinen Beinen und Füßen mitanschieben.«
»Kein Problem«, antwortete Jessica.
Als Walter sich anschickte, zu Nigel in das Führerabteil zu klettern, blickte Jessica unwillkürlich noch einmal über den Rand, sie konnte nicht anders. Der Boden war sehr viel näher. War das gut, oder …?
»Nicht hinschauen«, sagte ihre Schwester leise. »Wir haben Zeit.«
»Er ist ganz schön groß.« Nigel und Walter standen gebückt im Führerabteil. »Martyn, schnappen Sie sich einen Arm und ziehen Sie, wenn ich’s sage. Okay, Jungs, hebt an!«
Die drei Männer stemmten. Der tote Ballonführer war schwer, doch sie bekamen seinen Oberkörper über den Rand, und dann übernahm die Schwerkraft.
O nein! »Wartet!«, schrie Jessica. Zu spät. Ein letzter Ruck, die Beine des Ballonführers schrammten über das Korbgeflecht, und er rutschte davon.
Der Ballon reagierte sofort auf den Gewichtsverlust. Er stieg empor, schneller als vorher, und trieb auf die immer dichter werdende Wolkendecke zu.
Neuerliches Geschrei von allen Seiten. Es ging aufwärts.
»Was ist denn los?«, brüllte jemand.
»Das Gewicht des Ballonführers ist weg«, schrie Jessica. »Er war groß, da musste der Ballon ja reagieren. Das gleicht sich schon wieder aus. Festhalten und keine Panik.«
Leichter gesagt als getan, wenn die bunten Farben des Ballons über ihnen immer größer und greller zu werden schienen.
Im Führerabteil schaute Nigel auf das Variometer, das einzige Instrument im Korb, das an einer Strebe angeklippt war. Er starrte es an, als wollte er es mit schierer Willenskraft dazu zwingen, nicht immer noch höhere Zahlen anzuzeigen. »Mein Gott, daran hätte ich denken müssen.« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und hinterließ rote Schlieren vom Blut des Piloten. »Wir sind fast bei sechshundertsiebzig Metern«, verkündete er.
»Das ist kein Problem«, rief Jessica. »Wir waren doch sehr tief über dem Haus. Über uns ist jede Menge Himmel. Das gleicht sich schon wieder aus.« Sie drehte sich um und sah in verängstigte Gesichter. »Wir bekommen gerade eine unerwartete Physikstunde. Ich glaube, er wird schon langsamer.«
Wurde er nicht. Noch immer stiegen sie rasch empor, doch der dreckige schwarze Vogel über ihnen hatte jetzt die Schwingen ausgebreitet. Sie konnte fühlen, wie sein Schatten sie umhüllte, wie sich sein widerlicher Gestank auf sie herabsenkte.
»Sie hat recht«, rief der Journalist. »Wir können nicht bis ins Unendliche steigen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, bevor ich diesen Ausflug gebucht habe. Die Endgeschwindigkeit eines Ballons wie diesem hier beträgt ungefähr zweihundertfünfundsechzig Meter pro Minute.«
»Was zum Teufel soll das denn jetzt heißen?«, fragte Bob.
»Das ist ungefähr so schnell wie ein altmodischer Fallschirm.« Der Journalist sah die beiden Schwestern an. »Das heißt, wir werden nicht sterben. Vielleicht brechen wir uns ein paar Knochen, aber selbst wenn wir jetzt nur noch auf den Boden zurücksinken, sollte alles gut gehen. Es besteht wirklich kein Grund zur Panik. Und nicht rausspringen, egal wann, sonst geht der Ballon wieder nach oben.«
Rund um den Korb legten sich Gesichter in konzentrierte Falten, während die Passagiere sich bemühten, das Gesagte zu verstehen.
»Danke, Martyn«, sagte Nigel. »Walt, du hast auf deinem Boot doch ein Funkgerät, schau doch mal, ob du rausfindest, wie das hier funktioniert. Wir müssen jemanden am Boden wissen lassen, was los ist, und Hilfe anfordern. Die können uns sagen, wie wir runterkommen. Kann ja nicht so schwer sein.«
»Hat einer von euch Empfang?« Jessica hielt ihr Handy hoch und versuchte, die anderen auf sich aufmerksam zu machen. »Wir müssen immer noch Hilfe für die Frau da unten rufen, wenn wir können. Und dafür sorgen, dass die Polizei nach dem Kerl sucht. Per Telefon geht das schneller, als wenn wir warten, bis Walter das Funkgerät in Gang kriegt. Können bitte alle mal nachschauen?«
Nigel wühlte in der Tasche und reichte ihr ein schmales Handy. Frustriert schüttelte Jessica den Kopf. »Genau wie bei mir. Hat jemand ein anderes Netz?«
Alle holten ihre Mobiltelefone heraus, hielten sie hoch, fuchtelten damit durch die Luft oder klopften gegen die Seiten des Korbes.
»Bitte versuchen Sie es weiter. Irgendwann müssen wir ja mal in Reichweite eines Sendemasts kommen.«
Nigel, der noch immer das Variometer anstarrte, atmete so schwer, als wäre er gerade ein Rennen gelaufen. »Okay«, meinte er, »mit das Letzte, was Sean gesagt hat, war, dass wir in fünfzehn Minuten landen, wir müssten also nahe bei der Landungsstelle sein.« Rasch schaute er über den Rand des Korbes. »Was ich jetzt von Ihnen will, Ladys und Gentlemen, ist, dass Sie mein Ausguck sind. Halten Sie Ausschau nach der Bodencrew und nach einem brauchbaren Landeplatz, irgendeiner großen, ebenen Fläche. Und am allerwichtigsten: Halten Sie Ausschau nach Hindernissen. Wir wollen ja nicht gegen einen Baum oder einen Berg fliegen.«
»Ich sehe hier im Augenblick kein Funkgerät«, brummte Walter. »Weiß jemand, wie das Ding aussehen sollte?«
Jessica blickte von ihrem Mobiltelefon auf. »Das alte Haus dürfte unser bester Orientierungspunkt sein. Der alte Harcourt Estate. Sonst ist nichts in Sicht. Wir müssen nur rausfinden, wie weit wir gekommen sind.« Sie schaute auf die Uhr. »Zwölf Minuten, seit wir über das Haus geflogen sind. Ich würde sagen, wir sind etwa drei Kilometer weiter.«
Nigel hatte die eine Hand an einem rot angestrichenen Ventil. »Wenn ich richtigliege, kommt hier das Gas raus und lässt uns steigen.« Als niemand widersprach, drehte er an dem Ventil. Ein Flammenstoß schoss in die Luft empor.
»Nein! Nicht nach oben. Wir müssen runter.«
»Ich muss doch erst rausfinden, wie das hier funktioniert.« Wieder betätigte Nigel den Brenner.
»Hören Sie auf! Bringen Sie uns runter.«
»Bin ich blind, oder was?« Walter lag auf den Knien, und nur die beiden Schwestern hörten ihn. Sie sahen sich an.
»Still, Liebling, er weiß schon, was er tut«, sagte Natalies Mann.
»Nein, tut er nicht. Er hat keine Ahnung. Keiner von uns hat auch nur den blassesten Schimmer.«
In dem Ballon ist kein Funkgerät. Jessica formte die Worte mit den Lippen, ohne einen Laut von sich zu geben, fühlte jedoch, wie sie in ihrem Kopf widerhallten. Über ihr öffnete der Vogel mit den fauligen schwarzen Federn den Schnabel und kreischte auf sie herab.
Der Ballon reagierte auf die heiße Luft und begann zu steigen.
»In dem Ballon ist kein Funkgerät.« Leise wiederholte Walter ihre Worte und schaute zu den beiden Schwestern herauf.
»Es muss eins da sein«, widersprach Jessica. »Wir haben doch alle gehört, wie Sean es benutzt hat.«
»Ich hab ein Netz.« Der Halbwüchsige hielt sein Handy hoch über den Kopf und drehte es in der Luft, als wollte er das flüchtige Signal einfangen. »Aber nur ganz schwach. Nur ein Balken.«
»Wähl die Notrufnummer«, fuhr Jessica ihn an. »Sag denen, was hier los ist. Die wissen dann schon, was sie tun müssen. Gib das Ding her, wenn du irgendwelche Probleme hast. Walter, was ist das da drüben? Hinter dieser Plane?«
Nigel wandte sich an den Journalisten. »Martyn, der Feuerlöscher ist gleich neben Ihnen. Wenn wir landen, wird Feuer eine der größten Gefahren sein, deswegen möchte ich, dass Sie rausfinden, wie man ihn benutzt. Aber nicht zu früh damit loslegen.«
»Geht klar«, antwortete der Journalist.
»O mein Gott, wir werden doch nicht verbrennen, oder? Ich will nicht verbrennen!«
»Sorg doch mal jemand dafür, dass sie die Klappe hält!«
Natalies Mann hatte eine Hand fest um ein Drahtseil gekrallt. »Sie hat Angst, okay? Wir haben alle Angst.«
»Tja, aber ein paar von uns versuchen hier, was Nützliches zu tun.«
»Das Netz ist wieder weg«, meldete der Junge. »Tut mir leid, Leute.«
»Versuch’s weiter.« Jessica hielt den Blick wie gebannt auf ihr eigenes Handy gerichtet. »Versuchen Sie’s alle weiter. Irgendwann müssen wir ja mal Empfang haben.«
»Wir sind zu hoch.« Die Mutter und das junge Mädchen klammerten sich aneinander. »Nicht noch höher.«
»Okay, ich hör damit auf.« Nigel bedachte die beiden mit einem nervösen Lächeln. »Ich glaube, ich weiß jetzt, wie die Entlüftung funktioniert, man zieht hier an der bunten Leine, also lass ich uns jetzt langsam runter. Den Brenner benutze ich nur, wenn ich denke, dass wir zu schnell sinken.«
Er legte die Hand um eine bunt gefärbte Schnur, zögerte einen Moment und zog dann daran. Ein vernehmliches Atemholen, und dann schauten alle nach oben und sahen, dass der Kreis in der Mitte des Ballons nach unten zusammengeklappt war, sodass ganz oben ein Ring aus Tageslicht sichtbar wurde. Jessica fing an, im Kopf bis zehn zu zählen. Bei acht begann der Ballon zu sinken.
Im Führerabteil gab Nigel ein leises Ächzen der Befriedigung von sich. »Okay, alle miteinander, ich möchte, dass ihr euch umschaut. Seht nicht mich an. Seht nicht den Ballon an. Wir müssen die Bodencrew finden. Wenn Sie Handys haben, dann möchte ich, dass Sie sie benutzen. Nathan, so heißt du doch, stimmt’s? Wie sieht’s bei dir aus?«
»Noch nichts.« Der Junge blickte kurz auf. »Ist immer gleich wieder weg. Ich versuch’s mal mit ’ner SMS.«
»Wie läuft’s mit dem Funkgerät, Walt? Ein bisschen Hilfe von da unten könnte ich wirklich gut gebrauchen.«
»Dad?«, sagte das junge Mädchen.
»Versuch’s weiter, Nathan. Hat irgendjemand ein Foto von dem Dreckskerl da hinten bei dem Haus machen können?«
»Dad?«, sagte das Mädchen wieder, ein bisschen lauter diesmal.
»Ich.« Martyn hielt sein Handy hoch.
»Gut. Posten Sie’s auf Twitter, Instagram oder was weiß ich. Die Leute müssen wissen, was passiert ist.«
»Was machst du denn da?« Jessica hörte die Stimme ihrer Schwester in ihrem Ohr.
»Ich schicke Neil das Passwort für meinen Laptop«, antwortete sie. »Da sind jede Menge wichtige Sachen drauf.« Sie blickte auf und sandte ein gezwungenes Lächeln in das beklommene Gesicht ihrer Schwester. »Nur so als Vorsichtsmaßnahme, du kennst mich doch.«
»Nigel, ich glaub, hier ist wirklich kein Funkgerät im Korb.«
»Dad! Leute!«
Diesmal wandten sie sich zu dem Mädchen um. Es zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
»Der Typ mit dem Gewehr verfolgt uns.«
5. Kapitel
Der Ballon war schon ein ganzes Stück weit weg. Patrick orientierte sich rasch an der Sonne und prüfte die Windrichtung, indem er tief einatmete und die verschiedenen Gerüche verarbeitete, dann machte er sich in östlicher Richtung auf den Weg durch eine baumlose, windgegerbte Landschaft, die einer Tundra glich. Nur wenige Menschen kannten diese zweihundertfünfzig Quadratkilometer Einöde besser als er, und wenn der Wind so blieb, dann hatte er eine ziemlich gute Vorstellung davon, wo sie runterkommen würden.
Das Heidekraut, das im morgendlichen Sonnenschein violett zu leuchten begann, wuchs dicht auf dem Abhang, doch die breiten Räder seines Quads rollten leicht darüber hinweg. Die verborgenen Steine, hart und scharf wie Messerklingen, waren da schon eher ein Problem. Er hinterließ Spuren, aber die grauen Wolken, die von der Küste hereinzogen, würden in weniger als einer Stunde hier sein. Der strahlende Tag verdunkelte sich allmählich. Der zu erwartende Pissregen würde seine Reifenspuren zwar nicht auslöschen, aber danach würden sie nicht mehr von denen der Farmer und Park Ranger zu unterscheiden sein.
Er verlor den Ballon aus den Augen, als er hangabwärts durch ein Dickicht fuhr, fand ihn jedoch wieder, sobald er auf der anderen Seite herauskam. Jetzt hing er viel tiefer am Himmel. Wieder begann er zu zählen, fing mit der Frau in der grünen Jacke an. Sechs, neun, zehn, elf. Zwölf, dachte er. Ja, er war sich sicher, definitiv zwölf.
Weil er ständig nach oben schaute, lenkte er das Quad zu dicht an einen Felsvorsprung heran. Das linke Vorderrad krachte gegen den Stein, dass er nach vorn flog, und er musste anhalten, zurücksetzen und sich einen Weg um den Felsen herum suchen. Der Boden hier war unwegsam; die steilen Cheviot Hills waren von Sümpfen und verborgenen Felsen durchsetzt, und er konnte das Quad nicht voll ausfahren. Andererseits war der Wind nicht stark, und er holte sie allmählich ein.
Zehn Minuten, dachte er bei sich, höchstens fünfzehn. Er rutschte auf dem Sitz herum. Zwei Jagdabenteuer an einem Tag. Er hatte schon miesere Vormittage erlebt.
6. Kapitel
»Nein, nein, nein, nicht alle nach hinten gucken. Ihr müsst doch sehen, wo wir hinfliegen! Und haltet still, hört auf rumzuhopsen.«
Ohne auf Nigel zu achten, drängten die Passagiere sich zum Teil des Korbes, der jetzt hinten war. Tief unter ihnen folgte ein Mann auf einem Quad anscheinend ihrem Kurs.
»Ich bringe uns höher rauf.« Nigel betätigte beim Sprechen den Brenner. »Bis wir genau Bescheid wissen.«
»Der kann uns doch nicht einholen, oder?«, wollte der Junge wissen.
Ein neuerlicher Flammenstoß. Der Ballon begann zu steigen. »Hat schon irgendwer jemanden am Boden erreicht? Hat jemand Empfang? Walter, wie sieht’s mit dem Funkgerät aus?«
»Ich hab einen Tweet gepostet«, sagte der Junge. »Bin mir nicht sicher, ob den schon irgendjemand gesehen hat, ich hab nur dreiundvierzig Follower.«
Sein Vater sagte: »Als ich den Notruf gewählt habe, ist jemand rangegangen, aber dann war die Verbindung weg.«
Jessica schaute abermals auf ihr Handy. Noch immer kein Netz. Aber die Fotos, die sie von dem Mann dort unten und von dem toten Piloten gemacht hatte, waren sicher gespeichert. Die SMS an Neil würde gesendet werden, sobald sie Empfang hatte.
»Lange kann er uns nicht folgen«, meinte Nigel. »Bestimmt sind ihm Flüsse im Weg, Mauern, alles Mögliche. Leute, ihr müsst nach vorn schauen, nicht nach hinten. Ich kann nicht alles allein machen. Walter, jetzt sag doch mal.«
»Da vorn ist ein Wald«, hörte Jessica ihre Schwester rufen. »Dem müssen wir ausweichen. Und im Süden sind Strommasten.«
»Er ist weg. Ich kann ihn nicht mehr sehen.«
Jessica drehte sich um und sah, dass der Quadfahrer tatsächlich verschwunden war.
»Er ist in einem kleinen Tal«, sagte der Journalist. »Steile Hänge rauf- und runterfahren, das hält ihn auf. Los, Leute, versucht’s weiter mit den Handys.«
Walter war wieder auf den Beinen, das Gesicht blass und verzerrt. »Nigel, hier ist kein Funkgerät.«
»Es muss eins da sein. Wir haben doch gehört, wie Sean es benutzt hat.«
»Ich hab überall gesucht. In jeder Tasche, jedem Beutel, überall. Das Ding ist nicht da.«
»Ich weiß, wo es ist.«
Jessica drehte sich um und sah Tränen in den Augen ihrer Schwester schimmern. »Sean hatte das Funkgerät um den Hals, an einem Riemen«, sagte Isabel. »Wenn er es nicht benutzt hat, hat er es vermutlich in die Tasche gesteckt.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragte einer der Männer.
»Sie haben es bestimmt nicht gesehen. Sie haben es nicht gewusst, es war nicht Ihre Schuld.«
Alle anderen Passagiere starrten ihre gefasste Schwester entsetzt an. »Wir haben das Ding über Bord geschmissen? Wir haben’s über Bord geschmissen, als wir Sean rausgeworfen haben?«
»Ich hab’s euch doch gesagt«, jammerte Natalie. »Ich hab doch gesagt, tut’s nicht.«
»Nein, haben Sie nicht, verdammte Scheiße!«, brüllte Walter. »Sie haben gesagt, wir sollen ihn nicht zu Ihnen in den Korb packen.«
»Solche Ausdrücke sind ja nun wirklich nicht nötig«, fuhr Natalies Mann ihn an.
»Großer Gott, sind Sie bekloppt? Schauen Sie uns doch an. Können Sie mir sagen, wann man Kraftausdrücke sonst benutzen soll?«
Angsterfüllte Augen funkelten sich über den Korb hinweg an. »Sie sollten ein bisschen Respekt an den Tag legen.«
»Das reicht! Ruhe!«
Sie gehorchten Nigel, Gott sei Dank. Er hatte jetzt das Sagen.
»Wir haben also keine Möglichkeit, Kontakt mit jemandem am Boden aufzunehmen?«, fragte er.
»Wir haben Handys«, meinte Bob. »Früher oder später finden wir schon ein Netz. Wir müssen eben ein bisschen länger oben bleiben, das ist alles.«
»Ich hab noch einen Tweet abgesetzt«, verkündete der Junge. »Und mein erster ist geteilt worden. Und ich hab vielleicht eine SMS an Gran durchgekriegt.«
Gott sei gedankt für die Jugend, dachte Jessica. »Was ist mit dem Kerl auf dem Quad?«, erkundigte sie sich. »Haben wir ihn abgehängt?«
»Nein. Er ist zurückgefallen, aber er folgt uns immer noch«, meldete der Journalist. »Wir sollten definitiv oben bleiben.«
»Okay, oben bleiben scheint im Moment das Vernünftigste zu sein.« Nigel schaute von einer Gasflasche zur anderen. »Das Problem ist nur, in der da ist nicht mehr viel drin«, fuhr er fort. »Wir müssen ausknobeln, wie man von einer auf die andere umschaltet.«
»Ich schau mir das mal an«, erbot sich Walter.
Nigel betätigte den Brenner. Der Ballon stieg abermals empor. Als Protestgeschrei einsetzte, sagte er: »Wir müssen ziemlich hoch sein, ehe ich es riskiere, den Tank abzukoppeln. Und, Leute, schaut euch weiter um. Kann jemand eine Straße sehen? Ein Fahrzeug? Versucht’s weiter mit euren Telefonen.«
Wieder betätigte Nigel den Brenner. Das Variometer zeigte tausenddreihundert Meter … tausendfünfhundert … tausendachthundert … Der Ballon wurde schneller. Es war jetzt deutlich kälter.
»Ich glaube, ich weiß, wie das geht, aber ich hätte gern, dass noch mal jemand anderes draufschaut«, sagte Walter.
»Wir hängen ihn ab.«
»Na, das ist doch mal was.«
Plötzlich wurde die Welt dunkler, ein Schatten fiel über sie. Über ihnen schwang der Ballon heftig herum, und seine vollendete Rundung fing an zu wabern und sich zu verdrehen.
»Das kann nicht gut sein«, stellte Martyn fest, als er nach oben blickte.
»Wir sind in eine Sturmbö geraten«, meinte Nigel. »Wahrscheinlich sollten wir jetzt runter und schauen, ob wir da wieder rauskommen. Walter, lass mich mal sehen.« Er trat auf Walters Seite des Korbes. »Zieh du mal kurz an der Lüftungsklappe.«
Die beiden Männer tauschten die Plätze.
»An der hier?«, fragte Walter und packte eine dünne farbige Leine.
Nigel sah sich nicht um. »Ich hab’s. Wir müssen das Ventil hier abschrauben und das Rohr auf die andere Flasche stecken. Ja, Kumpel. Die bunte Schnur. Ganz sanft dran ziehen.«
Walter zog an der Leine, und die Welt stürzte ab.
Jessica empfand einen Augenblick der Schwerelosigkeit, so ähnlich wie in einem rapide abwärtsfahrenden Fahrstuhl. Ihr Magen machte einen Satz, und ihr wurde klar, dass der Korb sich im freien Fall befand.
»Was ist denn jetzt los?«
»Großer Gott, was geht hier vor?«
Der Korb fiel weiter. Sie wurden schneller. Jessica lag auf den Knien, stürzte auf die Erde zu; das Haar flog ihr um den Kopf. Ein schweres Gewicht drückte sie nieder, presste die Knochen ihres Schädels zusammen.
Hoch. Hoch. Steh auf.
Sie streckte die Hände aus, griff nach etwas, irgendetwas, was sie an der Welt verankern konnte, und ihre Hände fanden den Korbrand. Als hievte sie sich aus dem Wasser, zog sie sich auf die Füße.
Der Korb kippte, während er fiel; die schwereren Passagiere drückten ihre Seite tiefer hinunter. Über den Rand hinweg konnte sie die grau-grün-braunen Muster des Erdbodens auf sich zuwirbeln sehen.
Alle im Korb schrien. Vielleicht schrie sie ja auch.
»Loslassen, Walter, lass los!« Nigel hatte einen Arm um die Drahtseile geschlungen, die Füße gegen irgendetwas auf dem Korbboden gestemmt. »Lass die Leine los!«
Irgendwie blieb Jessicas Blick am Variometer hängen. 1300 Meter … 1150 … Der Abstand zum Boden schmolz zusehends.
Walter war auf den Boden des Korbes gesackt, seine Hände waren leer. »Hab ich doch!«
»Woran zum Teufel hast du denn gezogen?«, schrie Nigel ihn an.
Mit aschfahlem Gesicht zeigte Walter auf die rote Leine.
1000 … 830 …
Panik zuckte über Nigels Gesicht, als hätte ihn eine unsichtbare Hand geschlagen. »Das ist die falsche. Das ist nicht die, an der ich gezogen habe!«
Über ihren Köpfen hatte der Ballon jegliche Form verloren, er war in sich zusammengestürzt, war fast so nahe, dass sie ihn berühren konnten.
650 … 600 … 500 …
»Nein, nein, nein!«, jammerte Natalie, außer Sicht auf der anderen Seite des Korbes.
»Den Brenner!« Jessica hörte die Worte in ihrem Kopf, war sich nicht sicher, ob sie über das Windrauschen und die Schreie hinweg verständlich gewesen waren. »Ich komm nicht ran. Nigel, zünden Sie den Brenner!«
Eine Hand am Rahmen des Brenners, streckte Nigel die andere aus und ließ die Flamme frei. Sie schoss hoch empor. Zehn Sekunden. Sie war sich nicht sicher, ob sie noch zehn Sekunden hatten. Der Erdboden flog ihnen jetzt entgegen, schickte sich an, sie mit Haut und Haar zu verschlingen. Wieder betätigte Nigel den Brenner, doch die riesige Flamme, so heiß und so hell, bewirkte überhaupt nichts. Der Ballon war schlaff und tot, er blieb nur durch die Geschwindigkeit ihres Sturzes über ihnen oben.
300 … 200 …
Sie starrte die rote Leine an, die den Ballon entleert hatte; dicht daneben war die bunt gestreifte, an der Nigel zuvor gezogen hatte. »Da sind zwei Leinen«, schrie sie zu ihm hinauf. »Ziehen Sie an der anderen!«
100 … 80 …
»Damit könnten wir’s noch schlimmer machen.«
»Wie kann’s denn noch schlimmer werden?« Jessica beugte sich hinüber, glaubte den Bruchteil einer Sekunde lang, sie würde gleich aus dem Korb fliegen, fasste die bunt gestreifte Leine und zog.
Ihr Sturz ging weiter. Schweigen senkte sich herab, als hätten die Menschen um sie herum zu viel Angst, um zu schreien. Sie blickte nach oben.
Der Ballon wallte und schwankte, dann nahm er plötzlich seine ursprüngliche Form wieder an. Der Korb ruckte einmal und schien dann in der Luft hängen zu bleiben, als hätten riesige Hände ihn aufgefangen. Das Fallen hatte aufgehört.
… 65 Meter … 60 … 50 … Es ging noch immer abwärts, aber langsamer. Nigel zündete abermals den Brenner. 40 … 30 …
Sie begann zu zählen. Sieben, acht, neun, zehn.
… 23 … 17 … 18 … 20 …
Sie hatten sich gefangen. Irgendjemand übergab sich geräuschvoll.
»Gott sei Dank.« Schweißperlen standen auf Nigels Gesicht. »Keiner fasst mehr die rote Leine an.« Er atmete schwer, als er sichan Walter wandte. »Mach weiter mit dem Brenner, ich wechsle inzwischen die Gasflaschen.«
Jetzt schienen sie dem Boden verlockend nahe zu sein; sie konnten wieder die Einzelheiten der Bäume erkennen. In der Ferne waren ein paar Gebäude zu sehen und das stahlgraue Schimmern einer Straße.
»Sieht jemand den Kerl da unten?« Bob war erneut auf den Korbrand geklettert. »In dieser Höhe sind wir doch bestimmt in Schussweite.«
»Wir müssen rauf«, schrie Isabel, »sonst knallen wir gegen den Strommast! Sofort!«
Sämtliche Köpfe fuhren herum. Sie waren gefährlich dicht an etlichen Hochspannungsleitungen, die über dem Park verliefen.
Walter betätigte den Brenner. Dann ein zweites Mal. Der Mast kam mit jeder Sekunde näher. Noch zu viele Sekunden, bevor sie zu steigen begannen. Der Ballon fing an emporzusteigen, langsam und schwerfällig.
»Festhalten!«, brüllte Martyn. »Haltet euch irgendwo fest!«
Sie flogen an der Spitze des Strommastes vorbei, so nahe, dass Jessica sich aus dem Korb lehnen und ihn hätte berühren können. Die Insassen des Korbes stießen gerade einen kollektiven Seufzer der Erleichterung aus, als der Boden des Korbes in die Stromleitungen krachte.
Ein ohrenbetäubender Knall, Funken erfüllten die Luft um sie herum. Der Korb hüpfte und neigte sich, schleuderte Natalie und ihren Mann hinaus, als würden sie aus einem Mülleimer gekippt. Noch immer aneinandergeklammert segelten sie durch die Luft und zogen eine Heckwelle aus Brandgeruch hinter sich her. Ein Geräusch wie eine losgehende Sirene ertönte, als das junge Mädchen zu schreien begann.
Wieder prallte der Korb gegen die Leitungen. Bob, der noch immer gefährlich hoch oben auf dem Korbrand hockte, verlor das Gleichgewicht, griff krampfhaft in die Luft, dann stürzte auch er hinaus. Keine drei Meter unter dem Korb landete er auf den Hochspannungsleitungen. Er war nahe genug am Mast, dass die Elektrizität überspringen, durch ihn hindurchströmen und den Kreis schließen konnte. Sein Körper begann zu zittern und zu krampfen, und Rauch kroch wie fliehende Schlangen aus seinen Kleidern. Schreie zuckten aus seinem Mund hervor wie die Stromstöße, die sie hervorriefen.
Unter ihm waren Natalie und ihr Mann auf dem Boden aufgeprallt.
»O mein Gott, o mein Gott, o mein Gott!« Die Finger der Mutter waren weiß auf den Schultern ihrer Kinder.
»Anschnallen!« Der Buchhalter beugte sich weit vor, um an seine Familie heranzukommen. »Hakt euch alle am Korb ein!«
Nigel versuchte es mit dem Brenner, doch die Flamme war zu klein, um wirklich etwas zu bewirken. »Leute, wir schmieren ab. Ich hab keine Kontrolle mehr. Schnallt euch an!«
»Wir werden in die Bäume da krachen.«
»Bella, ich schnall dich jetzt an. Verdammt, halt doch still!«
Jessica hatte den Aufprall erwartet. Sie hatte den Schwall goldenen Laubes gesehen, als die Bäume auf sie zurasten. Trotzdem überraschte sie die Wucht des Aufpralls, er warf sie auf den Boden des Korbes, und sie knallte mit dem Kopf heftig gegen das harte Metall eines losen Sicherungsgeschirrs. Eine Sekunde, bevor die Welt davonglitt, sah sie, wie ihre Schwester, deren Geschirr sie nicht mehr hatte festmachen können, aus dem Korb geschleudert wurde. Bellas schwarzes Kleid wehte ihr nach, als sie sich in die Luft erhob und aus ihrem Blickfeld verschwand.
Bella flog.
7. Kapitel
Achtundzwanzig Jahre zuvor
Drei Kinder saßen mit gekreuzten Beinen im Sand um eine halb fertige Sandburg herum, ein kleines Stück vom Meer entfernt. Die jugendliche Begeisterung für ihr Unterfangen war verpufft, als ihnen klar geworden war, dass das, was sie ohne Eimer oder Schaufeln mit bloßen Händen schaffen konnten, nicht einmal annähernd an die Zinnen und Brustwehren heranreichte, die sie in Büchern gesehen hatten.
Das jüngste Kind, gerade mal acht Jahre alt, aber trotzdem die Geduldigste der drei, fand, sie könnten ihren Sandklumpen vielleicht mit Mustern aus Muscheln, Kieseln und Seetang aufwerten, doch ihre Geschwister hatten keine Lust mehr.
»Zeitreisen«, sagte der Älteste, ein etwa vierzehnjähriger Junge. Wie seine Schwestern war er groß für sein Alter, mit dunklem Haar, braunen Augen mit dicken Brauen und vollen roten Lippen. Als er lächelte, sahen seine Zähne groß und sehr weiß aus. »Damit ich in die Zeiten von großen Verbrechen zurückreisen und sie verhindern kann.«
»Ja, das wäre gut«, bemerkte die Mittlere. Die Jüngste wandte ein, das wäre möglicherweise gut, aber andererseits könnte es Probleme verursachen, die weit über die Auswirkungen des ursprünglichen Verbrechens hinausgingen. Für eine Achtjährige war sie sehr klug.
»Ich würde gerne fliegen können.« Die Mittlere reckte die Arme nach hinten, um Flügel zu simulieren. »Abheben und in die Wolken steigen. Alles sehen und überallhin gelangen.«
Die Jüngste fand, das hörte sich toll an. Und außerdem echt gruselig.
»Und du, Jessie?«, fragte der Junge. »Was für Superkräfte hättest du gern?«
Jessica überlegte kurz. Manchmal – eigentlich sogar meistens – war es schwer, mit den beiden mitzuhalten.
»Ich würde gern unsichtbar sein«, sagte sie und setzte dann, weil sich das nicht eindrucksvoll genug anhörte, hinzu: »Mich unsichtbar machen können. Ihr wisst schon, das an- und abschalten können. Also nicht die ganze Zeit unsichtbar sein.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen, und Jessica fragte sich schon, ob sie etwas Falsches oder gar etwas Dummes gesagt hatte.
»Jessie, du bist so ein Mäuschen, die meiste Zeit bist du doch sowieso unsichtbar«, stellte ihr Bruder fest.
»Ärgere sie doch nicht.« Bella lächelte ihre Schwester an. »Unsichtbar sein, das ist eine ganz tolle Superkraft.«
»Gehen wir zu den Felsenteichen.« Ned sprang auf und rannte los, den Strand entlang. Bella sprang ebenfalls auf.
»Und was ist mit den Schuhen?« Jessica schaute sich um, wo in den Dünen ein Haufen aus Schuhen und Socken lag.
»Denen passiert schon nichts.« Bella hopste auf der Stelle, sie wollte Ned unbedingt folgen. »So hoch kommt die Flut nicht. Und wer klaut schon Neds Turnschuhe?«
Sie schoss in einem Tempo davon, dass Jessica wusste, sie würde niemals nachkommen. Sie trabte trotzdem hinterher. Bella würde auf sie warten. Das tat sie immer.
8. Kapitel
Mittwoch, 20. September
Die Frau, die er aus dem Ballon hatte abwärtstrudeln sehen, landete auf dem Mann, der vor ihr abgestürzt war. Ihr Kopf zeigte zu seinen Füßen, ihre Beine lagen über seinem Brustkorb. Als Patrick näher kam, sahen sie eher aus wie Marionetten als wie Menschen, Puppen, die jemand in einen zu kleinen Kasten geschmissen hatte. Ihre schlaffen, biegsamen Gliedmaßen lagen in merkwürdigen Stellungen und sonderbaren Winkeln.
Sie rührten sich nicht.
Patrick hielt das Quad in zwanzig Metern Entfernung an und stieg ab. Das Gewehr ließ er auf dem Sitz liegen, damit er gar nicht erst in Versuchung kam, es zu benutzen. Dann ging er auf sie zu, hielt Ausschau nach losen Steinen, tiefen Pfützen oder plötzlich auftauchenden Zeugen. Shinto erreichte die beiden zuerst und beugte sich schnuppernd hinab.
Die Frau war nicht die, die er zu sehen gehofft hatte. Nicht die in der grünen Jacke, die ihn angestarrt hatte, als prägte sie sich jede Linie und jede Wölbung seines Gesichts ganz genau ein. Oder als würde sie ihn bereits kennen. Er schüttelte den Kopf, wischte den Gedanken beiseite. Diese Frau war älter, Ende fünfzig, mit braun gefärbtem Haar und grauem Haaransatz. Sie war dick; die Haut hing ihr grau und schlaff an den Knochen.
Die Frau in der grünen Jacke war schlank gewesen, hatte ausgesehen, als sei sie gut in Form. Als könnte sie weglaufen, sich sogar zur Wehr setzen. Er unterdrückte eine Woge der Erregung.
Den Ballon konnte er nicht mehr sehen, aber weit konnte er ja nicht gekommen sein. Nicht, nachdem er so gegen die Hochspannungsleitung geknallt war. Er blickte nach oben. Ein Mann hing immer noch über ihm in der Luft. Mehr als eine der Leitungen war gerissen. Eine tanzte hin und her, sprühte Funken. Der Geruch erinnerte ihn an die Grillabende mit seiner Familie.
Zumindest wegen dem brauchte er sich keine Gedanken mehr zu machen. Drei erledigt, blieben noch neun, wenn es stimmte, dass zwölf Leute an Bord gewesen waren. Er bückte sich und durchsuchte das tote Paar, fand ein Handy in der Innentasche des Mannes. Direkt unter dem zuckenden Mann auf den Stromleitungen entdeckte er noch eins, in einer auffälligen knallroten Hülle. Er nahm beide an sich.
Dann rief er seinen Hund und ging zu dem Quad zurück. Dabei trat er auf Stellen, wo der Boden fester war, oder auf federnde Heidekrautbüschel, er achtete darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Er startete den Motor und fuhr los, wobei er vor seinem inneren Auge eine dunkelhaarige Frau in einer grünen Jacke sah.
Hoffentlich war sie nicht tot. Noch nicht.
9. Kapitel
Überall war Schmerz, er rauschte durch sie hindurch wie eine Bluttransfusion. Jessica konnte ihn laut in ihrem eigenen Kopf hören und in den Schreien der Menschen um sie herum. Als der Korb ein zweites und ein drittes Mal gegen Bäume prallte, vernahm sie das Krachen von Schädeln, die mit etwas Hartem kollidierten, und von brechenden Knochen. Metall schrammte über Metall. Drahtseile schnellten zischend durch die Luft wie wild gewordene Schlangen. Das Korbgeflecht vor ihren Augen wurde weggerissen, und der gesplitterte Ast eines Baumes fuhr auf sie zu. Er verfehlte sie nur um Zentimeter.
Der Korb prallte hart auf dem Boden auf, sprang wieder hoch. Das tat er noch einmal. Jeder Aufprall fühlte sich an, als würde sie gegen eine Mauer geschleudert. Sie konnte Nigel nicht mehr in der Kanzel sehen. Jetzt waren sie vollkommen führerlos.
Sie lag auf den Boden des Korbes und starrte zu dem Ballon empor, doch seine wunderschöne Kugelform hatte sich zu etwas Missgestaltetem, Hässlichem verzerrt. Geradezu lüstern schien er auf sie herabzugrinsen, und instinktiv zuckte sie zurück. Sie versuchte, sich ganz klein zusammenzurollen, die Glieder dicht an den Körper zu drücken, aber sie wurde zu sehr herumgeschleudert. Nur das Sicherheitsgeschirr, an das sie sich klammerte, hielt sie im Korb, doch es war, als würden die Muskeln ihrer Schultern von der Anstrengung gezerrt werden und reißen. Das Rumpeln und Schütteln hörte auf, nachdem sie ein weiteres Mal hochgeschnellt waren.
Einen Moment lang fragte sie sich, ob sie wohl allein im Korb war, die Einzige, die nicht über Bord geschleudert worden war, doch dann fand das Gebrüll einen Weg in ihren Kopf. Da waren noch andere, die sich an das dürftige Stück Weidengeflecht krallten und schrien.
Sie hatte keine Ahnung, wo ihre Schwester war.
Der Korb prallte gegen irgendetwas und kippte. Sie fiel auf die Seite, das zerrissene Geflecht zerkratzte ihr das Gesicht. Ganz in der Nähe gellte ein Schrei und verklang beim Sturz in Richtung Boden. Dann schien der Korb zur Ruhe zu kommen.
»Bella!«
Ein Schrei kam als Antwort. Es hörte sich nicht wie ihre Schwester an, aber sicher war sie sich nicht.
»Bella, ich kann dich nicht sehen.«
Der Ballon rauschte abermals in den Himmel hinauf, und eine Sekunde lang war der Korb von reinem, makellosem Blau umgeben.
10. Kapitel
Zweiundzwanzig Jahre zuvor
Jessica hatte noch nie einen Himmel von so durchdringendem Blau gesehen.
Ein reines, klares, sattes Blau, zu weich für Saphirblau, zu üppig für Kornblumenblau. Es gab einfach keinen vergleichbaren Farbton. Das war die Farbe von Ewigkeit, von Zeitlosigkeit, eine Farbe, in der man sich verlieren konnte. Und für sie würde es immer die Farbe von Traurigkeit sein.
Das Meer war auch blau, und ruhiger, als Jessica es je erlebt hatte. Als eine Möwe ganz tief darüber hinwegflog und dabei dem Verlauf des Strandes folgte, spiegelte sich ihr stromlinienförmiger weißer Umriss im Wasser.
Ihre Schwester war ein oder zwei Meter vor ihr. Jessica war zurückgeblieben, als sie zu weinen angefangen hatte.
»Ich versteh’s nicht, Bella«, rief sie.
Isabel ging nicht weiter, drehte sich aber auch nicht um und verlagerte ihr Gewicht nicht gleichmäßig auf beide Beine. Sie verharrte lediglich, ohne wirklich stehen zu bleiben. Das würde kein Gespräch werden, sondern lediglich eine Wiederholung dessen, was sie bereits gesagt hatte.
»Ich erwarte auch nicht, dass du es verstehst, Jess. Jetzt noch nicht.«
Jessica waren die Argumente ausgegangen. Alles, was sie jetzt tun konnte, war Heulen und Jammern wie ein Kind. »Zuerst Mum, dann Ned, dann Dad. Und jetzt du. Ich verliere alle!«
In ihrer Verwirrung stampfte sie mit dem Fuß auf den Sand. Aus dem Kummer wurde allmählich Wut. Außerdem hatte sie Angst. Vierzehn Jahre alt, aber noch immer fürchtete sie sich wie ein Kind vor dem Verlassenwerden.
Da drehte Bella um, kam zurück und legte die Arme um Jessica. Sie war immer noch größer. All die Jahre hatte Jessica darauf gewartet, sie einzuholen. Jetzt fragte sie sich, ob ihr das je gelingen würde.