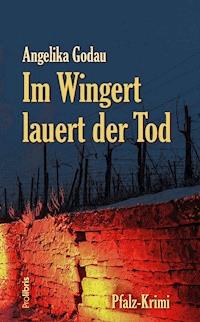Inhalte
Titelangaben
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Danksagung
Info
Angelika Godau
Im Wingert lauert der Tod
Pfalz-Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Phantasie der Autorin. Ebenso
die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2018
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelbild: © Claudia Franck
Schriften: Linux Libertine
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-194-5
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-184-6
www.prolibris-verlag.de
Die Autorin
Angelika Godau, auf der Durchreise in Bayern geboren, aufgewachsen in Detmold,
später nach Köln gezogen, dort geheiratet und drei Kinder großgezogen. Geschrieben hat sie eigentlich schon immer. Ihr erstes »Werk« hat sie im Alter von neun Jahren in der »Westfälischen Zeitung« veröffentlicht. Folgerichtig ist sie dann zunächst Journalistin bei verschiedenen großen Zeitungen geworden, hat dann aber nach dem Abschluss ihres
Psychologiestudiums eine eigene Praxis in Mannheim geführt, verbrachte danach zehn Jahre im Ausland.
Heute lebt sie mit Mann, zwei Hunden und einem Kater in der Pfalz. Und schreibt
immer noch. Unterhaltsame Romane mit oder ohne kriminelle Zutaten. »Im Wingert lauert der Tod« ist bereits der dritte Krimi um den Privatdetektiv Detlev Menke und seinen
Dackel Alli.
Prolog
Als ihn der Blick des Mannes über die wimmernde Frau hinweg traf, begriff Ramil Hajdaschin, dass er um sein
Leben laufen musste. Panisch flüchtete er hinaus in den kalten Dezemberabend, dachte nicht einmal daran, im
Laufen seine Jacke zu greifen. Beim Rennen spürte er weder die Kälte noch den kräftigen Wind.
Der Ort mit seinen erleuchteten Häusern lag bereits hinter ihm, nun war er mitten in den kahlen Weinstöcken und diesen steinigen Wegen, die ihn an die verlorene Heimat erinnerten.
Seine Beine bewegten sich monoton immer weiter, auch wenn seine Muskeln bei
jedem Schritt schmerzten. Er glaubte den keuchenden Atem eines Tieres hinter
sich zu hören und mobilisierte seine letzten Kräfte. Sicher würden bald Krämpfe einsetzen, er würde stolpern, diesen gleichmäßigen Rhythmus verlieren, stürzen und schließlich sterben. Tränen mischten sich mit dem Schweiß auf seinem Gesicht und er bog den Kopf zurück. Ein letztes Mal die Sterne sehen, auch wenn sie hier viel weniger hell
leuchteten als zu Hause.
Wortlos flehte er zu Allah, aber er tat es eher aus Gewohnheit, sein Gott konnte
ihn jetzt nicht mehr retten. Es war zu spät, er würde in diesem Land sterben, in das er gekommen war, um endlich in Frieden zu
leben. An seinem zwanzigsten Geburtstag hatte seine Mutter ihn auf diese gefährliche Reise geschickt. »Ramil, mein Sohn«, hatte sie gesagt und sein Gesicht in beide Hände genommen. »Du musst es für uns versuchen, seit dein Vater und alle meine Brüder umgekommen sind, gibt es niemanden, der es sonst tun könnte. Erreiche dieses Land, vielleicht kannst du uns dann zu dir holen. Allah
wird dich beschützen.«
Ja, Allah hatte ihn beschützt, die ganze Flucht war er mit ihm gewesen. Sogar, als das überfüllte Boot gekentert und Dutzende ertrunken waren, hatte er zu denen gehört, die gerettet wurden. Nun lebte er schon eine ganze Weile in diesem fernen
Deutschland, von dem Unglaubliches erzählt worden war. Weniges hatte gestimmt. Er war nicht erwartet worden und niemand
hatte ihm ein Haus geschenkt. Das waren alles Lügen der Schlepper gewesen, die ihm so viel Geld für die Fahrt über das Meer abgenommen hatten und Deutschland überhaupt nicht kannten. Doch hier gab es keinen Krieg, keine zerstörten Gebäude und Straßen, die Menschen mussten sich nicht vor den Bombenangriffen in Sicherheit
bringen, sie lebten in Frieden. Es war ein freies Land, in dem jeder leben
durfte, wie es ihm gefiel. Alle Kinder gingen zur Schule, auch die Mädchen. Es wurde erzählt, dass sie sogar ihre Männer selbst wählten, was er befremdlich fand. Das war das Einzige, was ihn wirklich störte.
Natürlich war die Enge in dem Haus nicht angenehm, die fremden Menschen
unterschiedlicher Herkunft, das Nichtstun, das endlose Warten und die Sorge, am
Ende ausgewiesen zu werden. Diese Angst verließ keinen von ihnen jemals ganz. Darum war er so glücklich gewesen, als die Sozialarbeiterin ihm vor einer Woche große Hoffnung darauf gemacht hatte, bleiben zu dürfen. Mutter und Schwestern konnte er nicht nachholen, er war volljährig und hatte daher keinen Anspruch auf seine Familie. Das hatte sie gesagt,
aber er war sicher, dass Allah einen Weg finden würde.
Ein winziger Augenblick hatte nun genügt, das alles zu einem kurzen, schönen Traum werden zu lassen, der sich nie erfüllen würde. Warum nur war er dem Mädchen in diesen Keller gefolgt? Er hätte in seinem Zimmer bleiben können, aber er hatte geahnt, dass Hadeel Gefahr drohte und seine Schwestern vor
sich gesehen. Nein, er hatte handeln müssen und doch zu lange gezögert, das Unglück war bereits geschehen, als er eintraf. Er hatte nichts verhindert, sich völlig umsonst in diese aussichtslose, tödliche Lage gebracht. Trotzdem war er losgelaufen, panisch, ohne Plan und ohne
Ziel, einfach nur weg. Weg von diesem Haus, weg von diesem Mann, der die Frauen
schändete und dessen Hund ihn mit Panik erfüllte. Nun waren sie hinter ihm her, und egal wie lange er lief, irgendwann würden sie ihn kriegen und töten. Er würde seine Heimat nicht wiedersehen, nicht seine Mutter, nicht seine Schwestern,
alles war umsonst gewesen. »Oh Allah, hilf mir.«
*
Ansgar Fritsche stand schwer atmend in der Dunkelheit und ballte die Hände zu Fäusten. Er musste sich eingestehen, dass es keinen Sinn machte, weiter hinter dem
Bengel herzurennen, er würde ihn nicht einholen. Der war einfach jünger und fitter als er, aber er hätte ihm wirklich zu gern eine Abreibung verpasst. Als Strafe, weil er ihm mitten
in die Nummer geplatzt war. Dass der kleine Spanner ihn gesehen hatte, war ihm
egal, der würde nicht reden und die hübsche syrische Schlampe auch nicht. Er kannte diese Typen, die waren viel zu
eingeschüchtert, um den Mund gegen ihn aufzumachen. Er keuchte immer noch und nahm sich
wieder einmal vor, mehr für seine Fitness zu tun.
Nach einem weiteren tiefen Atemzug entschloss er sich, umzudrehen und zurück zur Unterkunft zu gehen. Der Bengel entkam ihm nicht, den konnte er sich
morgen vornehmen, aber er wollte gern zu Ende bringen, was so schön begonnen hatte. Außerdem musste er diese kleine Fotze davon überzeugen, dass es für sie wirklich viel besser war, die Schnauze zu halten. In ihrem eigenen
Interesse, sie würde in ihrer Heimat keinen Mann abbekommen, wenn bekannt würde, dass sie keine Jungfrau mehr war. Der Traum vom fernen Verlobten wäre ausgeträumt. Nein, nein, die durfte nichts sagen, aber es konnte nicht schaden, ihr noch
einmal nachdrücklich klarzumachen, dass Schweigen das Klügste für sie war.
*
Rudi Gehrke saß hinter dem Steuer seines alten Volvos. Er hatte gerade erst den Parkplatz
erreicht, als die Tür des zweistöckigen Hauses aufgerissen wurde und ein junger Mann in Pullover die wenigen
Stufen herabsprang. Gehetzt schaute er nach rechts und links und rannte dann
direkt vor seinem Auto vorbei, ohne ihn zu beachten. Kaum außer Sicht, ging die Tür erneut auf und der Kerl erschien, auf den er es abgesehen hatte: Ansgar
Fritsche. Der stopfte sich das flatternde Hemd in die Hose und nahm die
Verfolgung des jungen Manns auf.
Spannung erfasste Rudi Gehrke. Er wartete einen Augenblick, bevor er den beiden
ohne Scheinwerfer und im Schritttempo folgte. Um diese Zeit war wenig Verkehr,
und auch als er den Ort bereits verlassen hatte, war ihm noch kein Auto
entgegengekommen. Er registrierte verwundert, dass der Verfolger immer öfter stehen blieb, um nach Luft zu schnappen, während der Jüngere unbeirrt weiterlief. Vielleicht war es der Anblick des Flüchtenden, der ein Déjà-vu bei Gehrke heraufbeschwor. Von einer Sekunde zur nächsten war er der Verfolgte. Keuchend und schnaufend, hinter ihm dieses Lachen,
das ihn bis heute, zehn Jahre später, schreiend aus Albträumen erwachen ließ. Schließlich der Moment des Zusammenbruchs, mit Schweiß, Speichel und Tränen im Gesicht. Dann der Stiefel in seinem Nacken, der seinen Kopf unaufhaltsam
tiefer in den matschigen Boden presste. Während seine Lungen nach Sauerstoff schrien, sich sein Mund mit Schlamm füllte und er tausend Tode starb, bis er endlich das Bewusstsein verloren hatte.
Die Hände um das Lenkrad gekrallt, biss er die Zähne so heftig aufeinander, dass es sich anhörte, als kaute er auf Glas. Die Erinnerung hatte ihn vollständig überrollt, deshalb hätte er beinahe übersehen, dass der Jüngere in einen Feldweg abbog. Fritsche aber hatte er aus den Augen verloren.
Leise fluchend beschloss er, die zwei auf der anderen Seite des ausgedehnten
Wingerts zu erwarten. Er kannte die Gegend wie seine Westentasche und wusste
genau, wo sie wieder rauskommen mussten. Keine zehn Minuten später war er am Ziel und niemand war zu sehen. Er zog den Zündschlüssel heraus, holte den Hund aus dem Kofferraum und ging mit ihm hinaus in die
Dunkelheit. Zwischen zwei Rebstock-Reihen wartete er, befahl dem Hund mit einer
Handbewegung Platz und Ruhe.
Jetzt kam es nur auf den richtigen Zeitpunkt an, dann Pacco das Kommando geben,
und Fritsche, diese verfickte Drecksau würde wissen, wie es sich anfühlte, bis an seine körperlichen und seelischen Grenzen gejagt zu werden. Den sicheren Tod vor Augen.
Sobald der jüngere Mann vorbei war, konnte er auf den Weg treten und Fritsche entgegensehen,
schließlich sollte der Hurensohn trotz Dunkelheit genau erkennen, wer da vor ihm stand.
Für den Bruchteil einer Sekunde vielleicht, bevor die Panik ihn erfassen würde. Er würde sich herumwerfen und zu fliehen versuchen. Sein Lachen im Nacken sollte
dieses Schwein um sein beschissenes Leben rennen, dann erst würde er dem Hund das oft geübte Signal geben.
Eine ungeheure Spannung ergriff von Gehrke Besitz, sein Herz raste und jeder
Muskel seines Körpers spannte sich. Viel zu lange hatte er auf den Moment seiner Rache warten müssen. Kurze Zeit später hörte er ein paar Rebstock-Reihen vor sich endlich das Schnaufen eines völlig ausgepowerten Menschen. Er hielt den Atem an, und bevor er noch den Befehl
aussprechen konnte, sprang der Hund auf und raste lautlos davon. Zu früh! Das konnte noch nicht Fritsche sein! Entsetzt lauschte er in die Dunkelheit,
bis Kampfgeräusche und Schreie zu hören waren. Er begriff sofort, das war nicht die Stimme, die er kannte und bis in
den letzten Winkel seines Körpers hasste. Der verfluchte Köter hatte den Falschen attackiert und mit Sicherheit getötet. Innerlich kochend stieß er einen leisen Pfiff aus, um ihn zurückzurufen, und wartete einige Atemzüge, dann lief er in die Richtung, aus der die Schreie gekommen waren.
Der große, schwarzbraune Schäferhund senkte die Rute, als er seinen Besitzer sah und zögerte weiterhin, dem Rückruf Folge zu leisten. Er war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch zu
fliehen und dem zu gehorchen. Sein Adrenalinspiegel war hoch, und der
Blutgeruch der Beute trug nicht dazu bei, ihn zu beruhigen.
Noch einmal versuchte er, den Hund zu sich zu rufen, vergebens. Selber schuld,
wer nicht hören will, muss fühlen, dachte er und versetzte dem Tier per Knopfdruck einen Stromschlag. Laut
aufjaulend kam es mit einem Satz auf den Mann zu, der zufrieden nickte. Er überlegte einen Augenblick, richtete dann die Taschenlampe auf den reglos am
Boden liegenden Mann und schaltete sie schnell wieder aus. Kurz dachte er darüber nach, die Polizei zu informieren, verwarf den Gedanken gleich darauf. Warum
seinen Plan gefährden? Der Mann war ohnehin tot.
Auf dem Weg zurück Richtung Auto, wartete er noch eine Weile, ob Fritsche, der Hurensohn, an dem
er Rache üben wollte, nicht doch noch kam. Schließlich stieg er frustriert in seinen Wagen und fuhr davon. Er dachte nicht an das
Opfer, ihn beschäftigte ausschließlich die Frage, wie er das Tier dazu bringen konnte, seinen Befehlen zuverlässiger zu gehorchen.
*
Fritsche ärgerte sich über sich selbst, dass er dem Bengel so überhastet nachgerannt war. Er hatte doch gerade erst angefangen, als der plötzlich auftauchte. Nun gut, aufgeschoben war nicht aufgehoben, die Kleine war
bestimmt noch da und wartete auf ihn. Er riss die Haustür auf und lief in den Keller, wo er das Mädchen genauso vorfand, wie er es verlassen hatte.
Ihre entblößten Beine und die vor Angst geweiteten Augen erregten ihn aufs Neue, aber so
sehr er sich auch mühte, sein Schwanz wollte einfach nicht steif werden. Er fluchte und schimpfte,
musste sich jedoch eingestehen, dass er keine Energie mehr für eine Fortsetzung der unterbrochenen Nummer hatte. Voller Frust packte er sie
an ihrem verrutschten Kopftuch und schlug ihr mehrfach mit der Faust ins
Gesicht. Blöde Schnalle, welcher Mann konnte denn auch, wenn eine nur wie tot dalag. Schließlich zog er ihren Kopf näher an seinen Mund und machte ihr klar, wer in diesem Haus das Sagen hatte. Ob
das Mädchen ihn verstand, war ihm egal, sie würde die Botschaft begreifen, das war es, was zählte.
Er stieß sie zurück, drehte sich um und verließ den Keller. Schon auf dem Weg zur Tür dachte er daran, noch einmal in das Zimmer des jungen Syrers zu gucken.
Vielleicht war der ja zwischenzeitlich wieder eingetroffen. War er nicht, wie
er kurz darauf feststellte. Als er eine halbe Stunde später nach Hause kam, lag sein Hund jaulend im Zwinger auf seiner Decke und freute
sich nur mäßig über sein Auftauchen. Er füllte ihm Wasser nach, das Futter war nicht angerührt, und er nahm sich vor, am Montag einen Tierarzt aufzusuchen. So ein Hund
kostete schließlich einen Haufen Kohle, und wenn der verreckte, musste er einen neuen kaufen.
Danach ging er in sein Bett und schlief umgehend ein. Das Winseln des leidenden
Tieres hörte er nicht.
*
Zwanzig Minuten nach dem Unglück erreichte Gehrke den Campingplatz, auf dem er seit einigen Jahren seinen
Wohnwagen stehen hatte. Er passierte die Schranke, fuhr die wenigen Meter,
parkte den Volvo und ließ den Hund raus, aber als der ihm folgen wollte, raunzte er: »Nix da, du bleibst draußen!« Er zeigte auf eine alte Decke, die neben dem Eingang auf der Erde lag.
»Hier, friss, mehr gibt’s heute nicht«, verkündete er etwas später. »Wo du Wasser findest, weißt du selber.« Danach schloss er endgültig die Tür hinter sich. Der Hund beroch die Schüssel, zögerte einen Augenblick und wandte sich schließlich dem See zu, um ausgiebig zu saufen.
Drinnen setzte der Mann einen Topf auf den Herd und schüttete eine Dose Bohneneintopf hinein. Dem Kühlschrank entnahm er eine Flasche Bier, bevor er den PC hochfuhr, rührte den Eintopf um und öffnete die Bierflasche. Topf und Flasche trug er schließlich zu der gepolsterten Sitzbank und begann kauend im Internet zu surfen. Nicht
lange, da fesselte eine Geschichte über einen Wolf sein Interesse. Der hatte angeblich das zweijährige Kind einer Familie getötet, während es im elterlichen Garten im Sandkasten spielte. Er überflog die Kommentare, die sich bereits im vierstelligen Bereich bewegten, und
lachte in sich hinein.
Es war einfach lächerlich, wie leichtgläubig die Menschen waren. Niemand kannte den Schreiber, trotzdem nahm man alles für bare Münze und ereiferte sich nach Kräften. Je nach Gesinnung und Bildungsstand waren die Kommentare sachlich oder
erschreckend ausfallend. Für einige wenige waren Wölfe Kuscheltiere, die so etwas niemals tun würden, für die meisten gehörten sie allesamt abgeschossen. Vernünftige Argumente für die eine Sicht oder die andere gab es selten. Am Ende war der Eingangspost
vollkommen in Vergessenheit geraten, aber man beschimpfte sich virtuell weiter.
Nur wenige brachten Empathie mit den Eltern des Kindes auf und bis auf drei
Personen hinterfragte keiner den Wahrheitsgehalt der Story.
Er schüttelte den Kopf, fühlte sich an Bilder eines mittelalterlichen Marktes erinnert. Damals warfen
Menschen mit faulen Eiern auf arme Teufel, die am Pranger standen. Er steckte
sich den letzten Bissen in den Mund und leerte die Flasche, bevor er den PC
runterfuhr. Zähneputzen ließ er ausfallen, zog nur Schuhe, Socken und Hose aus, ging pinkeln und dann ins
Bett.
Obwohl es letzte Nacht spät geworden war, brauchte er keinen Wecker zum Wachwerden. Um halb sieben schlug
er die Augen auf und sprang sofort aus dem Bett. Im winzigen Badezimmer wusch
er sich Gesicht und Hände, danach setzte er die kleine italienische Schraubkanne in Gang. Ohne Kaffee
ging morgens gar nichts, da war er nicht ansprechbar. Während er wartete, öffnete er die Tür und sah nach dem Hund. Der lag auf seiner Decke, stand aber bei dem Geräusch sofort auf und wedelte erwartungsvoll. Der Mann überlegte einen Moment, drehte sich dann zu einem der Einbauschränke um und entnahm ihm eine Tüte mit Hundefutter. Er sprang aus dem Wagen und schüttete dem Tier einen kleinen Berg davon vor die Füße. »Da, friss! Gleich wird gearbeitet, und dafür solltest du nicht unbedingt hungrig sein. Ich hoffe allerdings für dich, dass du heute besser spurst als gestern Abend.«
Zurück im Wohnwagen, goss er den Kaffee in einen Becher und beschmierte das letzte
Stück Brot, das er fand, mit Butter und Marmelade. Kauend überlegte er, wo er mit dem Hund arbeiten konnte und welche Übungen er dringend wiederholen musste. Das Tier hatte gute Anlagen, war auch
willig, aber irgendwas stimmte nicht zwischen ihnen.
Während er aus dem Fenster starrte, kam die Erinnerung hoch, die er so lebendig
hielt, wie es ihm möglich war. Zehn Jahre hatten nicht ausgereicht, seinen Hass auf diesen Mann zu
mildern, der für all das verantwortlich war. Für sein ganzes beschissenes Leben, das so hoffnungsvoll angefangen und ihn schließlich auf diesen Campingplatz stranden lassen hatte. Statt Karriere, Anerkennung
und Geld, Abstieg, Ablehnung und Hartz IV. Seit er die Bundeswehr verlassen
hatte, lebte er nur für den Tag der Abrechnung. Viele Tausend Mal hatte er den Ablauf in Gedanken
minutiös durchgespielt, aber wirklich zufrieden war er nie, etwas Entscheidendes
fehlte. Seine Rache sollte perfekt sein, ihn für all die Demütigungen entschädigen.
Dann endlich, vor fast zwei Jahren, hatte er diesen Hund gesehen. Sofort war ihm
klar gewesen, dass es das war, was er unbewusst all die Zeit gesucht hatte. Ein
Hund war der Anfang gewesen und ein Hund sollte das Ende sein. Das Ende seines
Peinigers. Sein Besitzer hatte einen unverschämt hohen Preis gefordert und gehörte auch nicht zu den Menschen, mit denen man schachern konnte. Ein halbes Jahr
hatte er auf jedes bisschen Luxus verzichten müssen, sogar das Rauchen aufgegeben, um das Tier bezahlen zu können. Der Typ, der ihn ausgebildet hatte, war zwar genauso ein Arschloch
gewesen, wie sein Vorgesetzter damals beim Bund, aber er musste zugeben, der
Hund spurte hervorragend. Was der einmal gepackt hatte, das ließ er nicht mehr los, egal wie auf ihn eingedroschen wurde. Vielleicht war das der
Grund, warum sie immer noch nicht zu einem Team geworden waren. Er war zu
weich, obwohl er sich Mühe gab, das Tier härter anzufassen. Es gehorchte ihm nicht zu hundert Prozent. Brachen seine
Instinkte durch, traf es seine eigenen Entscheidungen und entzog sich seinem
Einfluss. Genau das hatte gestern Abend zu dieser völlig überflüssigen und ungeplanten Scheiße geführt, die ihn dazu gezwungen hatte, seinen Plan ein weiteres Mal aufzuschieben.
Erst als er seine zweite Tasse Kaffee fast geleert hatte, wusste er, wo genau er
ansetzen musste, damit so etwas wie gestern Abend sich nicht wiederholte. Er
war zwar kein Freund von Merkels Flüchtlingspolitik, aber noch ein toter Asylant würde unnötiges Aufsehen erregen und das konnte er jetzt nicht gebrauchen. Irgendwo in
seinem Inneren regten sich Schuldgefühle, durch seinen Hund war ein Mensch ums Leben gekommen. Andererseits
beschwichtigte er sein Gewissen, wäre der Junge einfach stehen geblieben und hätte nicht so ein furchtbares Geschrei angestimmt, wäre gar nichts passiert. Erst dadurch war der Hetz- und Tötungstrieb des Hundes ausgelöst worden. Im Grunde genommen war es also ein Unfall gewesen, ein
Kollateralschaden, für den er nicht verantwortlich war. Immerhin wusste er jetzt, dass der Hund
ordentliche Arbeit leisten konnte, wenn auch ohne sein Kommando und am falschen
Objekt.
Entschieden stellte er die Kaffeetasse auf den Tisch, nahm diverse Utensilien
aus einer Schublade und sprang nach draußen. Der Hund erhob sich, wedelte erfreut und sprang an seinem Herrn hoch, der
darauf nicht reagierte. Nachdem er das Tier in den Kofferraum gesperrt hatte,
lief er auf einen in der Nähe stehenden Wohnwagen zu und rief halblaut einen Namen. Sofort ging die Tür auf und ein kleiner Mann mit Halbglatze und zerfurchtem Gesicht steckte seinen
Kopf ins Freie.
»Was ist ’n?«
»Hast du noch welche von deinen Kitten?«
»Klar, willste eine?«
»Ja, drei. Kriegst ’nen Fuffi dafür.«
»Prima, so in zwei Wochen kannste sie haben.«
»Bullshit! Jetzt sofort!«
»Die sind zu klein, brauchen noch die Mutter, sonst haben die später alle einen Schaden. Verstehste, die werden dann nicht sauber und so.«
»Egal, wo sind sie?« Als er das Zögern seines Campingnachbarn bemerkte, kramte er in seiner Jeanstasche und zog
einen Hunderter hervor. »Hier, also, wo?«
Das reichte als Argument gegen die Bedenken des Mannes, er verschwand in seinem
Wagen, kam kurze Zeit später mit einem Korb zurück, in dem drei Kätzchen lagen und aus großen blauen Augen in runden Gesichtern die Welt betrachteten. »Die sollten auf alle Fälle zusammenbleiben, dann geht’s vielleicht. Den Korb bringste mir zurück, haste verstanden, ist im Preis nicht drin.«
Der Katzenbesitzer unterdrückte einen Fluch und schloss die Tür sorgfältig hinter sich. Sein ungutes Gefühl blieb, da konnte er den Hunderteuroschein noch so lange anschauen. Er warf
einen Blick in den Karton, der unter dem Tisch stand. Seine Minka lag mit den
restlichen beiden Jungen darin, und er bildete sich ein, sie würde ihn vorwurfsvoll anstarren. Er sprang auf, riss die Tür auf, wollte sagen, er habe es sich anderes überlegt, aber sein Nachbar war bereits weg.
1
Miroslav Bronski war gut gelaunt. Heute war sein letzter Arbeitstag, nur noch
wenige Stunden, bis er aufbrechen und die nächsten drei Monate in seiner Heimat Polen verbringen würde. Dieses Jahr war er überhaupt noch nicht dort gewesen, es hatte einfach nie gepasst. Er arbeitete
bereits seit zehn Jahren für das Weingut Menke und gehörte hier irgendwie zur Familie. Nun stand Weihnachten vor der Tür und er wollte mit vielen Geschenken die Reise antreten. Bei seinen letzten
Besuchen hatte ihn allerdings das Gefühl beschlichen, Frau und Kinder freuten sich mehr über das, was er mitbrachte, als über ihn selbst. Darüber wollte er jetzt aber nicht nachdenken, sich nicht die Vorfreude verderben.
Er zog den Reißverschluss seiner mit Lammfell gefütterten, schwarz-grün karierten Winterjacke bis zum Kinn und die Mütze über die Ohren. Richtig kalt war es nicht, bisher waren die Temperaturen kaum
unter null gerutscht, aber der Wind blies unangenehm und nach einigen Stunden
auf dem Trecker war er auch ohne Minusgrade bis auf die Knochen durchgefroren.
Er tuckerte die Weinstraße entlang, amüsierte sich über hektische Autofahrer, die aufgeregt nach einer Überholmöglichkeit suchten. Oftmals riskierten sie Kopf und Kragen, nur um ein wenig früher an der nächsten roten Ampel warten zu müssen. Nach fünfundzwanzig Minuten bog er auf den Wirtschaftsweg zu dem Wingert ab, der an
diesem Morgen sein Ziel war. Er pfiff eine Melodie vor sich hin und dachte eine
Weile darüber nach, zu welchem Lied sie eigentlich gehörte. Es wollte ihm nicht einfallen, und er überlegte, ob er sich Sorgen um sein Gedächtnis machen müsste. Tröstete sich aber mit dem Gedanken, dass er bald 53 Jahre alt wurde, da durfte man
mal was vergessen.
Die ersten beiden Reihen durchfuhr er ohne Aufenthalt, schaute nach rechts und
links, ob jeder Trieb dort war, wo er hingehörte. Unvermittelt tauchten zwei Rehe vor ihm auf, blieben einen Herzschlag lang
unschlüssig stehen, um dann mit weiten Sprüngen die Flucht zu ergreifen. Er lachte in sich hinein, als er daran dachte, wie
erstaunt er die erste Zeit gewesen war, immer wieder Rehe in den Wingerten zu
sehen. Mittlerweile hatte er sich an ihren Anblick gewöhnt und erzählte zu Hause von Sprüngen mit 30 und mehr Tieren. Man glaubte ihm nicht und lachte gutmütig über seine Worte, aber er wusste es besser.
Genau um 08:32 Uhr, sieben Minuten nachdem er die Straße verlassen hatte, sah er, gerade noch rechtzeitig, dieses verdammte
Kaninchenloch vor dem linken Vorderreifen. Es gab einfach zu viele von ihnen,
und egal wie oft er kontrollierte und alle zuschüttete, die Viecher gruben immer wieder neue.
Fluchend stieg er ab, bückte sich, um im Licht der aufgehenden Sonne die Tiefe und den Umfang zu
inspizieren, und schaute umher, ob es noch weitere gab, da fiel sein Blick
durch die kahlen Reben auf den Mann. Der lag drei Reihen rechts von ihm, und wäre es Sommer, Herbst oder eine halbe Stunde früher gewesen, er hätte ihn vermutlich nicht bemerkt. Der Anblick war so merkwürdig, dass ihn die Angst überfiel und er sich panisch umschaute. Nichts war zu sehen, niemand weit und
breit, sie waren vollkommen allein an diesem Samstagmorgen, er, Miroslav
Bronski, und der tote Mann am Boden. Dass der tot war, daran zweifelte er keine
Sekunde. Kein Mensch, in dem noch Leben war, lag so da wie der. Sein erster
Gedanke war Flucht, und er wandte sich zu seinem Trecker um, überlegte es sich dann anders und schaltete lediglich den Motor aus. Während er durch die Reihen auf den Mann zulief, zog er sich mit den Zähnen einen Handschuh aus, grub in seiner Jackentasche nach dem altmodischen
Handy und drückte die Nummer seiner Chefin.
»Miro, was machst du denn noch draußen, ich denke, du willst heute nach Hause fahren?«, klang die fröhliche Stimme von Wiebke Menke an sein Ohr.
»Chefin, du musst schnell kommen, hörst du, schnell kommen. Liegt toter Mann hier in deinem Wingert.«
»Was? Miro, ganz ruhig, wo bist du?«
»Bin im Wingert zwölf, rechts von Straße.«
»Gut, bist du sicher, dass der Mann tot ist?«
»Ja, ganz sicher, ist mausetot.«
»Okay, bleib, wo du bist, ich rufe die Polizei.«
2
Ich wachte auf, weil mein Smartphone »Knocking on Heaven’s Door« schmetterte, und nahm mir wieder einmal vor, diese Melodie gegen eine zu
tauschen, von der ich sanfter geweckt wurde. Ich langte über die schlafende Tabea hinweg und sah auf dem Display den Namen meiner
Schwester Wiebke. Wenn die um diese Uhrzeit anrief, musste etwas passiert sein,
das war klar.
»Ist was mit Mama?«, war daher meine erste Frage, ohne mich lange mit einer Begrüßung aufzuhalten.
»Nein, aber Miro hat einen Toten gefunden. Die Polizei in Dürkheim habe ich bereits verständigt, und da ich davon ausgehe, dass Tabea bei dir ist ...«
»Was denn für einen Toten?« So früh am Morgen, gänzlich ohne Koffein bin ich immer etwas langsam im Denken.
»Einen Mann, er lag im Wingert, mehr weiß ich auch noch nicht. Miro ist völlig außer sich und behauptet, der sei von einem Wolf angefallen worden. Kann doch nicht
sein, oder? Gibt es neuerdings Wölfe in der Pfalz?«
»Keine Ahnung, möglich wär’s, aber warum sollten die einen Mann anfallen und töten? Jetzt sag schon, wo liegt die Leiche? Okay, ich wecke Tabea und dann kommen
wir so schnell wie’s geht.«
Natürlich war Tabea längst wach und bereits im Badezimmer verschwunden. Ich sprang aus dem Bett, trat
fast auf Alli, fluchte gotteslästerlich und rannte in die Küche, um die Kaffeemaschine startklar zu machen.
Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Detlev Menke, 26 Jahre alt,
privater Ermittler, wohne in Bad Dürkheim, fahre einen silbernen Porsche und habe einen Dackel. Ich weiß, dass ich damit so ziemlich alle Vorurteile bediene, die es nur geben kann,
aber ich bin kein verkappter Schwuler. Ganz im Gegenteil, meine Leidenschaft für schöne Frauen hat mich bereits mehrfach in äußerst brenzlige Situationen gebracht. Eine davon liegt noch kein halbes Jahr zurück. Damals habe ich in einem Hotelzimmer die Leiche von Britta Steinbach
gefunden, mit der ich dort zu einem sehr brisanten Date verabredet war. Natürlich hatte nicht ich sie umgebracht, war nur zuerst einmal Tatverdächtiger Nummer eins.
Diese schreckliche Geschichte hatte mein Leben auf den Kopf gestellt, aber da es
mir am Ende gelungen war, den Täter ausfindig zu machen, auch dazu geführt, dass meine auftragslos vor sich hin dümpelnde Detektei einen ungeahnten Aufschwung nahm. Der verlief noch steiler, als
ich nur wenige Wochen später die Leiche eines grausam gefolterten Mannes fand. Gefesselt und geknebelt
hatten seine Mörder ihn mitten in Dürkheim an ein Stoppschild gesetzt.
In beiden Fällen war Tabea Kühn die leitende Ermittlerin gewesen, mit der ich nun seit einigen Monaten liiert
war. Sollte das jetzt diejenigen Leser verblüffen, die sich noch daran erinnern, wie schrecklich diese Frau mich anfangs
gefunden hat, wundert mich das nicht. Arrogant, eitel und absolut unnütz waren die wenig schmeichelhaften Attribute, mit denen sie mich bedacht hatte.
Tja, das war inzwischen anders geworden und zu meinem eigenen Erstaunen hatte
ich seither eine andere Frau nicht einmal mehr angeguckt.
Dann gibt es da noch Alligator vom Trifels, genannt Alli, meinen Dackel mit dem
Herzen eines Löwen. Ich selbst habe, wie Sie vielleicht bemerkt haben, die seltsame
Angewohnheit, ständig über Leichen zu stolpern. Nun lag also wieder ein Toter in einem unserer
Wingerte. Meine Familie besitzt seit Adam und Eva ein Weingut in der Nähe von Bad Dürkheim, allerdings trinke ich weder Wein, noch verstehe ich etwas von seinem
Anbau. Was mich in der Pfalz, in der seit ungefähr 2.500 Jahren Wein angebaut wird, schon fast zu einem Exoten macht.
Als Tabea aus dem Bad kam, stand ihr extra starker Espresso bereit und sie lächelte mich an. Sofort war ich erneut fasziniert von dieser Frau. Die schwarzen
Locken, die sich um das ovale Gesicht ringelten, die strahlenden Augen und der
toll geschwungene Mund. Sie war eine echte Schönheit, aber sagte ich ihr das, winkte sie genervt ab und behauptete,
Schmeicheleien nicht leiden zu können. Außerdem sei Verstand wesentlich wichtiger als Aussehen. Vielleicht meinte sie das
sogar ernst, denn sie benutzte so gut wie kein Make-up. Auch verbrachte sie
niemals Stunden im Badezimmer, wie ich das von meinen früheren Freundinnen gewohnt war. Sie ging duschen, cremte sich ein und war nach spätestens zehn Minuten fertig.
»Ich habe es schon mitgekriegt, in einem eurer Wingerte liegt ein Toter?«
»Ja, unser Arbeiter hat ihn gefunden und Wiebke alarmiert, die hat bereits die
Polizei verständigt. Miro hat gemeint, der Mann sähe aus, als habe ihn ein Wolf zerfleischt …«
»Ein Wolf? Seit wann gibt es in der Pfalz Wölfe? Also, ich meine, kann ja sein, dass da mal einer durchwandert, aber der
greift mit Sicherheit keinen Menschen an. Es sei denn, der ist verletzt oder
gar tot. Nee, lass uns nicht spekulieren, ich fahre hin und sehe es mir an.«
»Nichts da, ich fahre mit. Erstens ist das unser Wingert und zweitens findest du
das alleine nie.«
»Was? Natürlich finde ich das, aber von mir aus komm halt mit, so habe ich dich jedenfalls
unter Kontrolle und weiß, dass du nicht schon wieder auf eigene Faust irgendwelche Recherchen anfängst«, lachte sie und griff nach ihrer Jacke.
»Wer hat denn den Richter gefasst? Hä, wer war das denn? War ich das nicht vielleicht, wenn du dich freundlichst
daran erinnern würdest?«, kasperte ich zurück.
»Na ja, die Hauptarbeit hat ja eigentlich Alli gemacht, nicht du. Aber, ich gebe
es zu, du hattest einen winzigen Anteil daran, dass wir ihn hinter Schloss und
Riegel bringen konnten«, lachte sie und sah dabei derart sexy aus, dass ich sie am allerliebsten sofort
zurück ins Bett gezogen hätte. Sie ahnte das und hob abwehrend die Hände.
»Denk nicht mal dran! Ich muss arbeiten und habe für alles andere keine Zeit, schon gar nicht für deine sexuellen Gelüste.«
»Okay, sehe ich ein, aber ich komme darauf zurück, spätestens heute Abend.«
»Vergiss es nicht«, antwortete sie und bückte sich, um Alli an die Leine zu nehmen, der natürlich nicht allein in der Wohnung bleiben sollte.
Der graue Himmel, die tief ziehenden Wolken und der Nebel über dem Michaelsberg passten irgendwie nicht in die Vorweihnachtszeit, aber
leider war Schnee eine echte Rarität. Nicht umsonst wird die Pfalz die Toskana Deutschlands genannt. Touristen
standen oft staunend vor großen Feigenbäumen und üppig blühendem Oleander. Na ja, dieses mediterrane Flair gab es natürlich auch hier nur im Sommer und nicht kurz vor Weihnachten.
Fünfzehn Minuten nach Wiebkes Anruf waren wir am Wingert. Auf der B 271 war kaum
Verkehr und auf dem Weg nach Freinsheim begegnete uns nicht ein einziges Auto.
Nach etwa drei Kilometern sah ich einen Rettungs- und zwei Polizeiwagen am Straßenrand stehen. Um der Spurensicherung das Leben nicht unnötig schwer zu machen, parkte ich den Porsche auf dem Randstreifen, und wir
legten das Stück Weg zu Fuß zurück.
Werner Harber, Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, war schon mit zwei Beamten eingetroffen, ebenso der Notarzt. Dieser »erste Angriff« ist Routine und wird immer in Bewegung gesetzt, sobald irgendwo eine Leiche
auftaucht, bei der Fremdverschulden nicht auszuschließen ist. Tabea grüßte in die Runde, und Harber gönnte mir einen genervten Blick, ließ es aber zu, dass ich mir den Toten anschaute. Hätte er mich doch nur daran gehindert, denn der Anblick war wieder einmal dazu
angetan, selbst den stabilsten Magen in Aufruhr zu versetzen.
Der Mann war nicht sehr groß und eher zierlich, er trug eine blaue Jeans und einen ebenfalls blauen Hoodie
mit irgendeinem Emblem auf der Brust. Genau ausmachen konnte ich das nicht,
denn das Teil war blutdurchtränkt. Blut war wirklich überall, es sah aus, als hätte man es eimerweise über dem Toten ausgeschüttet. Von seinem Gesicht war nicht mehr viel zu erkennen, es fehlten große Stücke Fleisch, und in der Kehle klaffte eine tiefe Wunde, aus der seltsame Dinge
ragten, die aussahen wie Strohhalme.
»Mein Gott, wer hat das nur angerichtet?«, stöhnte Tabea neben mir. »Habt ihr schon mal solche Verletzungen gesehen?«, wandte sie sich an die Männer, die allesamt mit versteinerten Gesichtern dastanden.
»Nein, habe ich nicht«, antwortete Harber und die beiden anderen schüttelten ebenfalls stumm den Kopf.
»Für mich sieht das fast aus, als wäre er von einem Wolf angefallen worden«, sagte der am Boden kniende Notarzt und zeigte auf die tiefe Halswunde. »Das war kein Mensch, da bin ich mir sicher, auch eine Maschine hinterlässt keine solchen Spuren. Nein, das war ein Tier und zwar ein großes.«
»Könnte es ein Wildschwein gewesen sein?«, wollte Harber wissen.
»Möglich wäre das, aber dann sähe der Boden ringsherum völlig anders aus. Außerdem habe ich bislang nichts davon gehört, dass in der Gegend Wildschweine gesichtet worden wären.«
»Okay, was sonst? Ein Hund?«
»Schon eher, nur warum sollte ein Hund diesen Mann angreifen und derart
zurichten, mitten in der Nacht in einem Wingert? In der Pfalz, nicht im
Outback! Nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, bin aber weder Experte für Wölfe noch für Hunde, da müsst ihr auf euren Rechtsmediziner warten. Ich weiß nur, dass der Mann tot ist und das seit etlichen Stunden, mehr leider nicht.«
Harber nickte und beugte sich etwas näher über das Opfer. »Seine Haare sind tiefschwarz und auch die Haut ist viel dunkler als bei einem
Europäer, der ist nicht von hier, das dürfte feststehen. Vielleicht ein Tourist oder einer der Asylbewerber? Wo ist denn
die nächste Unterkunft? In Neustadt, oder?«, beantwortete er sich selbst seine Frage. »Aber was tut der dann bei uns, wie kommt er überhaupt hierher? Wer hat ihn gefunden?«
»Das war Miro, Miroslaw Bronski, unser Mitarbeiter«, gab ich Auskunft und drehte mich suchend um. »Da oben sitzt er«, sagte ich und zeigte auf Miro, der auf seinem Trecker hockte. »Komm mal runter, der Kommissar hat ein paar Fragen an dich«, rief ich. Er nickte, kletterte von seinem Gefährt und kam auf uns zu, sichtlich bemüht, den Toten nicht ansehen zu müssen.
»Guten Tag, mein Name ist Harber und Sie sind Herr … Bronski? Gut, erzählen Sie uns bitte, was Sie hier gemacht haben und wie Sie den Toten gefunden
haben.«
»Gemacht? Habe ich gar nichts gemacht, nur meine Arbeit. Geschaut, dass alles
seine Ordnung hat. War gegen neun Uhr, als ich gefahren bin und das Loch, das
elende gesehen habe. Bin ich abgestiegen, wollte gucken wie tief, da er lag da.«
»Gut, der lag also da. Sind Sie zu ihm hingegangen, haben Sie ihn angefasst?«
»Bisschen hingegangen, nix angefasst, nur gucken.«
»Haben Sie vielleicht sonst noch jemanden gesehen oder gehört?«
»Nein, habe niemanden gesehen, nix gehört, habe Chefin angerufen und dann gewartet.«
»Sie haben die ganze Zeit auf Ihrem Trecker gesessen, sind nicht abgestiegen und
rumgelaufen?«
»Nein, bin nicht abgestiegen, Chefin sagt, oben warten. Ich warten. Kann jetzt
gehen?«
»Nein, das geht leider nicht, wir brauchen Ihre Aussage und Sie müssen sie unterschreiben.«
Bronski zuckte die Schultern, drehte sich um und stieg wieder auf seinen
Trecker. Ich schaute ihm nach und entdeckte meine Schwester Wiebke, die etwas
verloren auf dem Hauptweg stand. Sie hatte ein beschissenes Jahr hinter sich.
Erst eine Krebsoperation, dann eine Entführung, die mit einer Gehirnerschütterung geendet hatte. Nun also kurz vor dem Jahreswechsel noch eine Leiche im
Wingert. Ein Gutes hatten die schrecklichen Ereignisse immerhin gehabt, das
Verhältnis zu meiner großen Schwester hatte sich sehr verbessert, wir waren uns wieder näher gekommen. Ich hatte aufgehört, ein Arschloch zu sein, und sie, sich wie meine Mutter zu benehmen.
»Was ist los?«, rief ich, »warum kommst du nicht zu uns?«
»Ich will keine Leiche von Nahem sehen, ich habe schon genug üble Dinge im Kopf, das brauche ich nicht zusätzlich obendrauf. Wer ist es denn und was ist passiert?«
»Ein Mann, vermutlich ein Ausländer, vielleicht einer aus dem Asylbewerberheim in Neustadt. Er ist sehr übel zugerichtet und sieht aus, als hätte ein Wolf ihn zerfleischt.«
»Ein Wolf? Du spinnst, oder? In der Pfalz gibt es überhaupt keine Wölfe.«
»Woher willst du das so genau wissen? Die tauchen mittlerweile fast überall wieder auf, warum also nicht auch bei uns? Viel Wald, viel Wild,
eigentlich ein nettes Umfeld für die Tierchen.«
»Nee, lass mal, muss ich nicht haben, obwohl, na ja, die werden nicht gezielt in
einen Wingert marschieren, um dort einen Mann zu zerfleischen, oder etwa doch?«
»Kaum, aber wenn es wirklich ein Wolf war, ich betone wenn, dann könnte der natürlich gerade hier durchgekommen sein, während der Mann …«
»Quatsch«, unterbrach Wiebke meine sinnentleerten Ausführungen, »so viel Zufall gibt es überhaupt nicht. Ein Asylbewerber aus dem fernen Neustadt läuft nachts durch einen Wingert, der nirgends hinführt und trifft dabei zufällig auf einen Wolf, der ihn daraufhin anfällt und tötet? Nee, das glaube ich nie und nimmer.«
»Ich eigentlich auch nicht, aber was war es dann? Ein Hund? Auch nicht besser,
ach … apropos Hund, ich lasse mal Alli aus dem Auto, der muss bestimmt mal. Bin
gleich wieder zurück.«
Ich ging die wenigen Meter zu meinem Wagen, öffnete die Beifahrertür, und Alli sprang raus, warf mir einen schiefen Blick zu und pinkelte ausgiebig
an den erstbesten Weinstock. Mein Hund hasste es, im Auto warten zu müssen, und war dann sehr beleidigt, so wie jetzt. Er tat, als wäre ich überhaupt nicht da, sauste schnurstracks durch die Reihen auf Wiebke zu, freute
sich kurz, bevor er aufmerksam die lange Dackelnase in die Luft reckte. Nach wenigen Sekunden drehte er sich einmal um die
eigene Achse, um dann mit wehenden Ohren loszurennen. Er hatte Tabea aufgespürt und die liebte er nun mal mit der gleichen Intensität wie Saumagen. Da reichte schon die halbe Stunde Trennung, um erneut begeistert
auf die Suche nach ihr zu gehen.
Ich rannte ihm nach, weil ich mir unschwer vorstellen konnte, was Harber von
einem Dackel an seinem Tatort halten würde, aber so weit kam es nicht. Alli legte wieder einmal einen seiner gefürchteten Stopps hin und stemmte alle vier Beine gleichzeitig in den Boden. Er
schnüffelte aufgeregt, sträubte Nackenfell und Rute, bog die Schnauze gen Himmel und begann zu heulen. Laut
und langgezogen tönte sein Wuhuuuuuuu in den wintergrauen Morgen.
Mittlerweile hatte ich ihn erreicht, aber bevor ich die Leine an seinem Geschirr
befestigen konnte, warf er sich herum und raste, immer noch fiepend, zurück zum Auto. Kopfschüttelnd schaute ich ihm nach, und Tabea, die ebenfalls angelaufen kam, um ihn am
Betreten des Tatortes zu hindern, sagte verblüfft: »Was ist denn in den Hund gefahren? Der sah ja aus, als hätte er den Leibhaftigen gesehen. Ich glaube, er hat etwas in die Nase gekriegt,
das ihn in Panik versetzt hat. Würde doch zu der Wolfstheorie passen, oder?«
»Keine Ahnung, ich habe ihn noch nie so erlebt, aber er hat ja vermutlich auch
nie einen Wolf gerochen.«
»Würde er auf Wildschwein ebenso seltsam reagieren?«
»Kann ich dir nicht sagen, aber wenn hier eine Rotte durchgezogen wäre, hätte die Spuren hinterlassen, die keiner übersehen würde … ach, guck mal, da kommt dein Chef.«
Gleich drei PKW und ein Bus bogen in den Wirtschaftsweg ein und herausquollen,
neben der Mordkommission, Leute in weißen Ganzkörperanzügen. Die Spurensicherung, auch bekannt als Erkennungsdienst, schleppte schwere
Metallkoffer und machte sich an die Arbeit, rund um die Leiche akribisch nach
Spuren zu suchen.