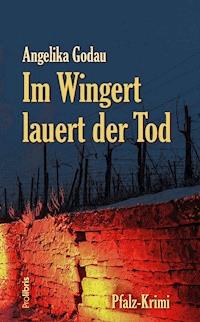Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich saß seit einer gefühlten Ewigkeit im Wartezimmer von Doktor Brandt und bemühte mich, die Gespräche um mich herum zu überhören. Schwangerschaftserbrechen, Komplikationen bei Geburten oder Stillprobleme waren nicht wirklich meine Lieblingsthemen. Also stellte ich die Ohren auf Durchzug und konzentrierte mich auf die Autozeitung, die sicherlich ein Jahr alt war. Auch in "Maimorde" hat Detlev Menke es nicht leicht. Wieder einmal findet er eine Leiche, und das kommt selbst seiner Freundin, der taffen Oberkommissarin Tabea Kühn, verdächtig vor. Handelt es sich bei dem Toten doch um den Ehemann der Frau, mit der ihn mehr als eine flüchtige Bekanntschaft verbindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angelika Godau
Maimorde
Dirk-Laker-Verlag
www.dilav.de
E-Book-Ausgabe
Veröffentlicht im Dirk-Laker-Verlag
Dirk Laker, Bielefeld 2020
© by Angelika Godau
Lektorat: Dirk Laker
-1-
Melanie Kreutzer lag mit geschlossenen Augen und fest zusammengepressten Lippen auf dem Untersuchungsstuhl. Ihre feuchten Hände umklammerten die Griffe an den Seiten, und sie schickte ein Stoßgebet nach dem anderen zu einem Gott, an dessen Existenz sie nicht glaubte.
Zwischen ihren gespreizten Beinen saß Doktor Andreas Brandt und drückte mit einer Hand auf ihren Bauch während er mit der anderen ihren Muttermund abtastete.
„Also, Melanie“, sagte er, während er die Handschuhe auszog, „du bist eindeutig schwanger, auch wenn ich das sehr seltsam finde. Nicht nur ich war mir zu hundert Prozent sicher, dass du und Roger in dieser Hinsicht nicht kompatibel seid. Ich meine, wie lange habt ihr es versucht, wie viele Ärzte konsultiert, wie viele Wundermittel ausprobiert. Und nun plötzlich, nach all den Jahren, ich verstehe es nicht und habe dafür nur eine Erklärung …“
„Brauchst du auch nicht, kein Mensch ist allwissend, nicht einmal ihr Ärzte. Wir haben eben die Hoffnung nie aufgegeben.“
„Ach was, mit Hoffnung hat das nichts zu tun, ich war schließlich nicht der einzige Spezialist, der zur gleichen Diagnose gelangt ist. Ihr beide seid zwar körperlich gesund, aber irgendetwas hat nicht gepasst. Das kommt gelegentlich vor, auch wenn es medizinisch nicht zu erklären ist. Aber davon mal ganz abgesehen, glaubst du, dass diese Schwangerschaft eine gute Idee ist? Du weißt doch selbst, wie du die letzten zehn Jahre verbracht hast. Du hast verdammt viel …“
„Daran musst du mich nicht extra erinnern. Das weiß ich schließlich, aber ich habe aufgehört, schon lange. Ich trinke keinen Tropfen mehr, und das wird ganz sicher so bleiben. Was ist? Alles in Ordnung?“
Doktor Brandt schüttelte resigniert den Kopf und führte behutsam das Ultraschallgerät in die Vagina ein. Melanie richtete sich weiter auf, um den Monitor besser sehen zu können.
„Ist alles gut?“, fragte sie leise und noch einmal lauter, als er nicht antwortete. „Ist alles in Ordnung mit meinem Kind?“
„Um das sicher beurteilen zu können, ist es zu früh, aber, soweit ich es sagen kann, bist du in der sechsten Woche, und das deckt sich mit deinen Angaben zur letzten Periode. Jetzt müssen wir erst die Laborwerte abwarten, aber, wie gesagt, es besteht erhebliche Gefahr, dass das Kind durch deine …“
„Du wiederholst dich. Ich bin sicher, dass mit meinem Baby alles okay ist. Ich würde es spüren, wenn es nicht so wäre.“
„Gut, wie du meinst. Dann lass dir draußen einen neuen Termin geben. Hast du es Roger schon gesagt?“
„Nein, noch nicht. Ich sage es ihm, sobald die Laborergebnisse da sind und ich sicher sein kann …“
„Ach, sieh an, Melanie, ganz so sicher, wie du tust, bist du dir also doch nicht.“
„Ich schon, aber du kennst Roger und vor allen Dingen seine Mutter. Die werden beide mit den gleichen Bedenken kommen, wie du auch. Also ist es besser, etwas in der Hand zu haben, was ihre Zweifel zerstreut. Wehe, du verrätst vorher etwas.“
„Ich unterliege der Schweigepflicht, die gilt auch bei Freunden. Solltest du eigentlich wissen“, gab Doktor Brandt etwas pikiert zurück und fügte nach kurzem Zögern hinzu: „Behalte auf alle Fälle mal im Hinterkopf, dass die Entwicklung des Fötus vielleicht nicht … ich meine, Alkoholismus der Mutter verursacht nicht selten eine Alkoholembryopathie und das ist …“
„Hör sofort auf, den Teufel an die Wand zu malen“, unterbrach sie ihn, erhob sich und verschwand hinter dem Vorhang, um sich wieder anzuziehen.
„Vergiss trotzdem nicht, dir einen neuen Termin geben zu lassen. Sobald ich die Laborwerte habe, rufe ich dich an. Ach, und sag Roger doch bitte, dass ich heute Abend etwas später komme, ich habe noch eine Patientin.“
Melanie Kreutzer verließ die Praxis mit neuem Termin, obwohl sie wusste, dass sie nicht wiederkommen würde. Sie wollte nicht hören, dass ihr Kind womöglich nicht gesund war. Behindert, weil sie zehn Jahre lang exzessiv getrunken hatte und eine Schwangerschaft wirklich das letzte war, womit sie gerechnet hatte. Dabei war Roger geradezu besessen von seinem Wunsch nach einem Kind und hatte sie jahrelang von Arzt zu Arzt geschleift, jede medizinische Möglichkeit ausgeschöpft. Der Erfolg war ausgeblieben und seine Enttäuschung darüber, hatte er sie spüren lassen. Du bist schuld, stand deutlich in seinem Gesicht geschrieben. Im Auto sitzend starrte sie auf das Ultraschallbild, das Brandt ihr in die Hand gedrückt hatte. Das, was einmal ihr größter Triumph werden sollte, war ein winziges Etwas, kaum größer als ein Stecknadelkopf. „Du darfst nicht behindert sein, bitte, bitte. Du musst ein wunderschönes, kluges Kind werden, das ist wichtig“, flüsterte sie beschwörend, „nur dann wird es ihnen richtig weh tun.“ Sie presste das Foto an ihre Brust, bevor sie es in ihre Handtasche schob.
-2-
Ich saß seit einer gefühlten Ewigkeit im Wartezimmer von Doktor Brandt und bemühte mich, die Gespräche um mich herum zu überhören. Schwangerschaftserbrechen, Komplikationen bei Geburten oder Stillprobleme waren nicht wirklich meine Lieblingsthemen. Also stellte ich die Ohren auf Durchzug und konzentrierte mich auf die Autozeitung, die sicherlich ein Jahr alt war.
„Wie geht es eigentlich Tabea?“, unterbrach jetzt meine Mutter meine Lektüre, entschlossen, ein Gespräch in Gang zu bringen.
„Gut“ gab ich knapp Auskunft, auch wenn ich ahnte, dass ihr das nicht reichen würde.
„Warum kommt ihr nicht heute Abend mit zu den Kreutzers? Roger wird vierzig und gibt eine Gartenparty. Ich kriege euch kaum noch zu sehen, das finde ich wirklich schade.“
Da ich nicht reagierte, bohrte sie gleich weiter.
„Das wäre doch eine schöne Gelegenheit. Walter kommt auch mit, und der unterhält sich so gerne mit deiner Freundin. Was ist? Kommt ihr?“
„Nicht, wenn ich es vermeiden kann“, wäre eine ehrliche, aber sicher keine kluge Antwort gewesen, daher versuchte ich es mit Ausflüchten.
„Kann ich nicht versprechen, ohne vorher Tabea zu fragen, das weißt du doch. Vielleicht hat sie Dienst, dann geht es so wieso nicht.“
„Nun, dann ruf sie an und frag. Ich möchte es gern wissen, damit ich mich darauf freuen kann.“
„Mama, ich kann sie nicht wegen einer Gartenparty bei der Arbeit stören, außerdem ist heute Freitag, da hat sie …“
„Ach was, sie wird bestimmt gern mitkommen. Ruf sie an, einmal ist bestimmt nicht schlimm.“
Auch die letzte Frau im Wartezimmer hatte mittlerweile ihre Zeitung sinken lassen, jedes Gespräch war verstummt, alles wartete gebannt auf meine Antwort.
Die Begnadigung erschien in Gestalt von Doktor Brandt, der meine Mutter bat, ihm ins Behandlungszimmer zu folgen.
Als sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, drehten sich die Gespräche jetzt um Eltern, Einladungen und unterschiedliche Vorstellungen von Freizeitgestaltung.
Wer mich noch nicht kennt, ich bin Detlev Menke, 27 Jahre alt, Sohn eines Weingutes in der schönen Pfalz, Porschefahrer und Besitzer eines heldenhaften Dackels namens Alligator vom Trifels, genannt Alli. Nach vielen, sehr sorglosen Jahren, die ich hauptsächlich mit Nichtstun und wechselnden Freundinnen zugebracht habe, bin ich jetzt ein viel beschäftigter Detektiv in Bad Dürkheim. Ich habe richtig gut zu tun, wenn ich nicht gerade meine Mutter zum Gynäkologen begleite, weil sie wegen häufiger Schwindelanfälle selbst nicht Autofahren kann. Ich hatte mich vehement gegen dieses Ansinnen gewehrt, denn Frauenärzte waren mir suspekt, aber Wiebke hatte darauf bestanden. Wiebke, meine große Schwester, konnte sehr energisch sein und ließ keine meiner Ausreden gelten.
Ich solle mich gefälligst nicht so anstellen, ich müsse die Mutter doch nur fahren und nicht während der Untersuchung ihre Hand halten. Sie selbst habe einen Termin mit einem Großkunden. Walter könne auch nicht, also sei ich dran, hatte sie argumentiert.
„Na gut, aber ich gehe auf keinen Fall mit rein, ich warte im Wagen“, hatte ich maulend klein beigegeben. Damit war allerdings meine Mutter nicht einverstanden gewesen.
„Nein, bitte komm mit rein, vielleicht will Doktor Brandt ja etwas mit dir besprechen“, hatte sie gebeten und so war ich in dieses Wartezimmer geraten.
Walter war übrigens seit fast zwei Jahren der Freund meiner Mutter, und damit konnte ich mich bis heute nicht anfreunden. Immerhin war sie Mitte sechzig und ich davon überzeugt gewesen, dass Frauen in ihrem Alter vielleicht in einer Rheumagruppe aktiv waren oder zum Yoga gingen, aber doch kein Interesse mehr an Männern hatten. Dazu kam, dass ich Walter schlicht zum Kotzen fand und wenn ich sah, wie er die Hand meiner Mutter hielt, hätte ich ihm eine reinhauen können.
Tabea lachte mich aus und behauptete, ich sei schlicht eifersüchtig. Eifersüchtig auf Walter, wie schräg war das denn?
Tabea Kühn, meine schöne Freundin und Oberkommissarin beim K11 der Ludwigshafener Mordkommission. Sie war, als wir uns kennenlernten, alles andere als begeistert von mir gewesen. Sie hielt mich nicht nur für einen Mörder, sondern auch für einen totalen Loser. Sie nannte mich überheblich, sexistisch, kindisch und noch einiges mehr und bemühte sich kein bisschen, ihre Abneigung zu kaschieren. Ganz im Gegenteil, sie ließ keine Gelegenheit aus, mich deutlich spüren zu lassen, wie unsympathisch ich ihr war. Nicht einmal meine bewährtesten Anmachsprüche hatten ihr ein Lächeln abringen können. Das schaffte dafür Alli, der eroberte sofort ihr Herz. Trotzdem hatte ich mein Leben komplett ändern müssen, damit aus uns ein Paar werden konnte. Ich arbeitete fleißig, verdiente genug Geld, um weder Mutter noch Schwester auf der Tasche liegen zu müssen und guckte andere Frauen nicht einmal mehr an. Hatte sich gelohnt, denn ich war nach wie vor hingerissen von dieser mega Frau.
Sie war schön, was sie völlig nebensächlich fand, klug, humorvoll und erfolgreich in ihrem Beruf. Das war nicht immer so einfach für mich, und manchmal tat ich mich damit noch immer schwer. Mein männliches Ego wollte sie beeindrucken, besser sein. Leider endete das regelmäßig im Chaos. Getreu dem Motto: Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet, hatte ich auch bei ihrem letzten Fall wieder alle Anweisungen und Warnungen ignoriert, um ihr zu beweisen, dass auch ich meinen Job verstand. Es nagte schwer an mir, dass ich den im Fernstudium erlernt hatte, darum war ich manchmal etwas übereifrig.
Zum Glück war am Ende alles gut ausgegangen, und noch bevor Tabea mir den Kopf abreißen konnte, weil ich mich wieder einmal eingemischt hatte, passierte etwas, womit ich in tausend Jahren nicht gerechnet hätte.
Der Sandmann, Norman Sand, Tabeas Kollege und nicht gerade ein Fan von mir, warf sich für mich in die Bresche. Er behauptete im Brustton der Überzeugung, er verdanke mir sein Leben. Das war zwar etwas übertrieben, aber unterbrach abrupt Tabeas Zorn und ich gebe zu, mir ging es runter wie Öl. Tabea war versöhnt, der Sandmann wieder gesund und der Täter dingfest gemacht. Weihnachten konnte kommen.
Mein Plan sah vor, unseren ersten gemeinsamen Heiligen Abend ganz besonders romantisch zu begehen, und ich hatte alles bis ins Detail geplant. Leider hatte ich versäumt Tabea in meine Pläne einzubeziehen, was dazu führte, dass ich am Ende wieder wie der Trottel vom Dienst dastand.
Kurz vor dem vierten Advent hatte ich bei einem Mannheimer Juwelier spontan einen Ring gekauft, einen ausgesprochen teuren Ring. Überzeugt, dass er auf Tabea mächtig Eindruck machen würde, hatte ich ihr das kleine Kästchen hingehalten und gespannt auf ihre Reaktion gewartet. Leider verstand sie die Botschaft nicht, oder wollte sie nicht verstehen. Wie auch immer, sie öffnete es, warf einen Blick hinein, lachte und sagte kopfschüttelnd: „Glaubst Du, Walter wird es gefallen, wenn du deiner Mutter einen solchen Ring schenkst, oder ist der für Wiebke?“
Ihre späteren Erklärungen, warum sie nicht einmal auf die Idee gekommen war, er könnte für sie sein, retteten die Situation nicht mehr. Meinen Ausflug in die Welt der Romantik hatte ich gründlich verkackt. Tabea war mir nicht selig lächelnd um den Hals gefallen, wir waren weiterhin nicht verlobt, nicht einmal eine gemeinsame Wohnung war in Sicht.
Sie fand, wir kannten uns für all das noch lange nicht gut genug, der jetzige Zustand sei völlig okay und Ringe unbequem. Am Ende fuhren wir zwischen den Jahren nach Mannheim und gaben das teure Teil zurück, was dem Juwelier Tränen in die Augen trieb. Bis Silvester hatte ich damit gehadert, danach war ich bereit, es im kommenden Jahr erneut zu versuchen.
Ich wollte und ich würde diese Frau heiraten, das war beschlossene Sache für mich. Solange musste ich daran arbeiten, sie zu einem Umzug in meine Wohnung zu bewegen, damit wir zumindest die Nächte zusammen verbringen konnten.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erschien meine Mutter in der Tür und winkte mich zu sich.
Den etwas klein geratenen Mann im weißen Kittel hatte ich bereits auf diversen Weinfesten und natürlich dem berühmten Dürkheimer Wurstmarkt getroffen, kannte ihn aber nicht näher. Dass ich mal eine Nacht mit seiner Frau verbracht hatte, wusste er offenbar nicht und von mir würde er es auch nicht erfahren.
„Ihre Frau Mutter hat mich ersucht, Ihnen zu sagen, dass sie zu einem kleinen Eingriff in meine Klinik kommen muss. Nichts Besorgniserregendes, aber unumgänglich und möglichst zeitnah. Lassen Sie sich bitte gleich einen Termin geben, guten Tag“, sprach´s, quälte sich ein Lächeln ins solariumgebräunte Gesicht und verschwand.
Wie war der denn drauf? Sollte sich dringend mal eine Ärztesoap anschauen, da konnte der lernen, wie man mit Patienten umging. Kopfschüttelnd wandte ich mich der Dame hinter dem Counter zu, die bereits auf ihren Bildschirm starrte und mich wissen ließ, dass der nächstmögliche Termin in drei Wochen zu haben sei. Fragend schaute ich meine Mutter an, die zustimmend nickte.
Im Auto wolle ich Einzelheiten, aber sie weigerte sich, behauptete, das sei kein Thema für einen Mann, es sei aber nichts Ernstes. Damit musste ich mich zufriedengeben, war aber so besorgt, dass ich versprach, mit Tabea über die Party zu reden. Meine Mutter plauderte locker über Nebensächlichkeiten, aber ich spürte ihre Anspannung. Sie war selten krank, immer voller Tatendrang und einer schier unermüdlichen Energie. Daher war mir der Gedanke, dass sich das mal ändern könnte, bisher nicht gekommen. Zuhause drückte ich ihr, in einem seltenen Anfall von kindlicher Zuneigung, einen Kuss auf die Wange. Sie sah mich verwundert an, lächelte und sagte: „Keine Bange, ich habe nicht vor zu sterben, aber man weiß ja nie. Vergiss also nicht Tabea anzurufen, wir sehen uns heute Abend.“ Damit drehte sie sich um und verschwand im Haus.
Große Worte, überschwängliche Umarmungen oder gar Gefühlsausbrüche gab es in unserer Familie nie. Dafür war keine Zeit.
Mein Vater war früh gestorben und Mutter und Schwester hatten hart arbeiten müssen, das große Weingut rentabel zu führen. Das hatte ich allerdings erst begriffen, als Wiebke an Krebs erkrankt war und mir einige Leute sehr deutlich klargemacht hatten, dass ich ein krasser Egoist war, der nur auf Kosten anderer lebte.
Okay, die Zeiten waren vorbei, Wiebke wieder gesund, und ich ein nützliches Mitglied der menschlichen Gemeinschaft. Ich fuhr vom Hof, nicht ahnend, dass ich schon wieder auf dem Weg in einen Mordfall war.
-3-
„Ich sage es dir noch einmal, hör mit deiner verdammten Sauferei auf. Du bist ekelhaft, wenn du getrunken hast. Ganz abgesehen davon, guck mal in den Spiegel. Dein Gesicht ist aufgedunsen und deine Haare sehen aus, als hättest du sie ewig nicht mehr gewaschen. Wie eine Pennerin. Außerdem hast du mittlerweile mindestens zehn Kilo zu viel. Es wird nicht mehr lange dauern, dann reicht Roger die Scheidung ein und niemand wird ihm das verdenken. Die Leute reden über euch und das kann er sich in seiner Position einfach nicht leisten. Kein Mann zeigt sich gern mit einer Frau in der Öffentlichkeit, die aussieht wie die Putzfrau. Ich habe dich nie gemocht und daraus habe ich weder dir noch Roger gegenüber einen Hehl gemacht. Heuchelei liegt mir nicht. Und darum sage ich dir jetzt ganz offen, dass ich dich mittlerweile geradezu abstoßend finde. Du bist zu gar nichts nutze, nicht einmal ein Kind kannst du auf die Welt bringen. Jammern und saufen, das ist alles, was du kannst; dabei hast du nicht den geringsten Grund. Weißt du, auch wenn Roger es nicht wahrhaben will, ich habe dich schon lange durchschaut. Du bist ganz zufrieden damit, dass du nicht schwanger wirst, du wolltest nie Kinder, du wolltest Karriere machen. Hat wohl auch nicht so geklappt hat, wie du gedacht hast, sonst hättest du deinen Job nicht einfach hingeschmissen. Jetzt geh unter die Dusche und sorg dafür, dass du zumindest heute Abend einigermaßen präsentabel aussiehst. Und noch was, solltest du dich betrinken und die Leute anpöbeln, werfe ich dich eigenhändig aus dem Haus. Ich hoffe, wir haben uns verstanden!“
Carolin Kreutzer winkte ab, noch bevor ihre Schwiegertochter den Mund zu einer Erwiderung aufmachen konnte, drehte sich um und verließ den Raum. Vor der Tür blieb sie stehen, legte eine Hand auf ihr Herz und holte tief Luft. Das hatte verdammt gutgetan. Endlich hatte sie ausgesprochen, was sie schon lange dachte. Melanie war einfach nicht die passende Frau für ihren Sohn. Ja gut, sie war Juristin und einmal recht hübsch gewesen, aber sie kam aus keinem guten Stall, war labil und hatte nicht gelernt, sich in ihren Kreisen zu bewegen. Seit zehn Jahren jammerte sie über ihre Kinderlosigkeit und rannte von Arzt zu Arzt, wenn sie nicht gerade vollkommen betrunken im Bett lag. Roger war wirklich zu vielem bereit gewesen, hatte klaglos Spermatogramme machen lassen und seiner Frau bei diversen Inseminationen die Hand gehalten. Er hatte mit ihr gehofft und getrauert, wenn es wieder einmal nicht funktioniert hatte. Er war mit ihr sogar bis nach Amerika geflogen. Erst als sie begonnen hatte, immer obskurere Heiler aufzusuchen, Schamanen, Gesundbeter und Handaufleger, die alle nur an ihrem Geld interessiert waren, hatte er sich geweigert. Als sie begriff, dass sie ihn nicht mehr umstimmen konnte, hatte sie angefangen zu trinken. Erst nur hin und wieder, aber mittlerweile war sie selten ganz nüchtern. Sie ließ sich gehen, hatte weder ihre Zunge noch ihre Wortwahl unter Kontrolle und vergaß allzu oft, wo sie sich befand und wer sie war. Nein, sie würde Melanie keine Träne nachweinen, im Gegenteil, sie war entschlossen, ihren Sohn zu ermutigen, sich von ihr zu trennen. Die Peinlichkeiten und das Gerede wegen einer Scheidung waren in diesem Fall das kleinere Übel.
Melanie Kreutzer stand bewegungslos mitten im Raum und starrte ihrer Schwiegermutter nach. Die hatte sie in der Diele abgefangen, kaum, dass sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich derartige Vorwürfe anhören musste, aber so deutlich war sie noch nie geworden. Sie warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Flaschen in der Bar, riss sich zusammen und wandte sich ab. Langsam stieg sie die lange Wendeltreppe mit dem kostbaren, geschnitzten Geländer hoch und ging in ihr Zimmer.
Vor dem großen Spiegel ihres Kleiderschranks blieb sie stehen und betrachtete sich kritisch. Es stimmte, sie sah schlecht aus und ihre Haare brauchten dringend einen Friseur. Sie fuhr sich mit den Händen über die Hüften und dann über ihren Bauch, bevor sie sich seufzend auf das breite Bett fallen ließ, die Hände hinter dem Kopf verschränkte und über ihre Situation nachdachte.
Ihre Schwiegermutter hatte keine Ahnung, die sah nur, was sie sehen wollte. Roger war nicht das Opfer, er war der Täter. Jahrelang hatte sie alles getan, um seinen immer zwanghafter werdenden Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Unzählige schmerzhafte, demütigende Untersuchungen und Eingriffe hatte sie über sich ergehen lassen. Sich immer öfter als Versagerin gefühlt, weil einfach nichts klappen wollte. Rogers Beitrag war dagegen lächerlich gewesen, auch wenn er sich von seinen Eltern wie ein Held feiern ließ.
Als sie ihn vor fünfzehn Jahren geheiratet hatte, war es für sie die große Liebe gewesen. Dass seine Eltern, und dabei besonders Carolin, über seine Wahl alles andere als begeistert waren, hatte ihr Glück kaum getrübt. Kreutzers gehörten zu den reichsten Familien, der ansonsten eher armen Pfalz und vererbten ihr Vermögen von einer Generation zur nächsten. Für sie war es daher selbstverständlich, dass ihr ältester Sohn sich eine Frau suchen würde, deren Eltern das ebenso hielten. Umso entsetzter waren sie, als Roger ihnen ein Mädchen präsentierte, dessen Eltern geschieden waren und deren Mutter sich das Studium buchstäblich vom Munde abgespart hatte. Dass die angehende Schwiegertochter einen hervorragenden Abschluss vorweisen konnte und einer vielversprechenden Zukunft als Anwältin entgegensah, interessierte sie nicht sonderlich.
„Am Ende zählt nur, aus welchem Stall jemand kommt“, beendete ihr Schwiegervater jede Diskussion. Roger und sie hatten über derart antiquierte Ansichten gelacht, waren jung und zumindest ihr war Geld völlig egal gewesen. Sie hatten von einer gemeinsamen Kanzlei geträumt, vom eigenen Haus und waren sich ihrer ewig währenden Liebe sicher gewesen. Nächtelang konnten sie über Mandanten oder juristische Fragen fachsimpeln, sich zwischendurch lieben und danach weiter diskutieren. Oftmals bis zum Morgengrauen. Ob sie jemals über eigene Kinder gesprochen hatten, daran erinnerte sie sich nicht mehr, auch nicht, ob sie selbst den Wunsch nach Kindern gehabt hatte. Ihre eigene Kindheit war von der Enttäuschung der Mutter geprägt, die von ihrem Freund verlassen worden war, kaum dass er von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. Regelmäßig hatte sie darüber geklagt, wie schwer ihr Leben war, wie jeder Mann das Interesse an ihr verlor, nur weil sie ein Kind hatte. Daran erinnerte sie sich gut, und auch an das diffuse Gefühl von Schuld, so als könne sie etwas dafür, dass die Mutter unglücklich war. Trotzdem hätte sie sicherlich Kinder gewollt, irgendwann, aber erst nachdem sie sich als Anwältin einen Namen gemacht, mit Roger zusammen brisante Fälle bearbeitet hatte. Das erste Jahr ihrer Ehe war genauso verlaufen, wie sie es sich erträumt hatte, aber dann fragten seine Eltern immer öfter, wann es denn endlich so weit sei. Anfangs hatte Roger lachend erwidert, sie müssten noch etwas üben, aber irgendwann hatte auch er damit angefangen.
„Andere Frauen sind auch berufstätig und bekommen Kinder, das ist doch heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Meine Mutter ist da und wird dich sicher unterstützen. Ach komm, Melli, lass und ein Baby bekommen.“
Sie war dazu noch nicht bereit gewesen, und je mehr er sie bedrängte, umso weniger konnte sie es sich vorstellen. Ein Kind in die Welt zu setzen, um die Schwiegereltern zufrieden zu stellen, fand sie lächerlich. Sie war eine großartige Anwältin und plötzlich drehte sich die Welt nur noch darum, wann sie endlich schwanger wurde. Alles in ihr hatte sich dagegen gesträubt, und sie nahm heimlich weiterhin die Pille. Natürlich war es ihre Schwiegermutter gewesen, diese misstrauische, alte Hexe, die dahinterkam und umgehend ihren Sohn informierte. Anstatt sich darüber zu empören, dass seine Mutter in ihren Schubladen schnüffelte, war er nur sauer auf sie gewesen. Hinterhältigkeit, Berechnung und Karrieregeilheit hatte er ihr vorgeworfen. Aus rein egoistischen Motiven würde sie ihm das Recht, Vater zu werden, verweigern. Nicht einmal den beschissenen Hinweis, dass er genug Geld verdiente, um eine Familie ernähren zu können, hatte er sich verkniffen. Sie hatte sich nicht verteidigt, warum nur nicht? Warum hatte sie nicht ausgesprochen, wie anmaßend und unverschämt sie sein Verhalten fand? Weil er sie nicht verstanden hätte? Warum war hatte sie ihn nicht verlassen, irgendwo weit weg ein anderes, eigenes Leben begonnen. Sie hatte es nicht getan, weil sie ihn immer noch liebte und auch, weil irgendwo, ganz tief in ihrem Inneren eine Stimme ihm Recht gab.
Es war normal, dass er sich Kinder wünschte, es war die Bestimmung einer Frau Kinder zu bekommen, eine liebevolle Mutter zu sein, ihren Ehemann glücklich zu machen. Sie schämte sich, dass sie so egoistisch war, lieber ihrem Beruf nachgehen zu wollen. Wochenlang war er damals mit vorwurfsvoller Miene durchs Haus gelaufen, kaum dass er ein Wort mit ihr gewechselt hatte. Jeder ihrer Versuche, ein Gespräch in Gang zu bringen, wurde von ihm abgeblockt. Irgendwann hatte sie kapituliert, sich eingeredet, ein Kind müsse nicht das Ende ihrer Karriere bedeuten, ein Kind würde sie und Roger wieder näher zusammenbringen. Ihrer einzigen Bedingung, ein eigenes Haus, damit sie nicht länger mit den Schwiegereltern unter einem Dach leben mussten, hatte er sofort zugestimmt.
Fünf Jahre später wohnten sie immer noch zusammen und das eigene Haus war längst kein Thema mehr zwischen ihnen. Dafür umso öfter ihre Kinderlosigkeit. Anfangs war es nur eine leichte, allmonatliche Enttäuschung gewesen, aber nach und nach war ein Drama daraus geworden. Ihr Liebesleben, einst prickelnd und leidenschaftlich, wurde für ihn zur Manie und für sie zu einer lästigen Pflicht. Roger wollte nicht einsehen, dass man auch ohne Kinder ein glückliches Leben führen konnte. Jeder Versuch, mit ihm darüber zu reden, endete auf die gleiche Art.
„Du weißt doch genau, wie sehr ich mir ein Kind wünsche, und meine Eltern hätten so gern einen Enkel und späteren Erben für die Kanzlei. Bitte Melli, lass es uns weiter versuchen.“
Leider änderten die Besuche bei den verschiedensten Ärzten nichts, sie waren aus medizinischer Sicht beide gesund und gemeinsamen Kindern stand, außer der Tatsache, dass sie keine bekamen, nichts im Weg.
„Du bist zu angespannt, Melli, immer mit deinen Gedanken bei den Mandanten. Hör auf zu arbeiten, ich glaube, dann klappt es eher.“
Ihren Protest, dass sie gerne arbeitete, ihr der Job Freude machte, sie ausfüllte, hatte er nicht gelten lassen.
„Ich glaube aber, dass es dich zu sehr anstrengt und du darum nicht schwanger wirst. Wenn du mich liebst, dann tu mir den Gefallen und hör auf. Ich habe Mandanten genug, wir sind auf deine nicht angewiesen und selbstverwirklichen kannst du dich, wenn du erst unser Kind im Arm hältst. Außerdem, wenn der Kleine erst mal in den Kindergarten geht, kannst du ja halbtags wieder einsteigen.“
Natürlich hatten auch seine Eltern ihr immer wieder zugesetzt, ihr Egoismus und Herzlosigkeit vorgeworfen. Sie sei schuld am Unglück ihres Sohnes, weil sie nicht wirklich bereit sei, ihm den natürlichen Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Mit der Zeit war sie sich wie ein Monster vorgekommen, nicht normal, irgendwie anders als andere Frauen. Nach einem besonders heftigen Streit, in dem zum ersten Mal das Wort Scheidung gefallen war, hatte sie aufgegeben. Sie bat ihren Chef, den Seniorpartner einer alteingesessenen Kanzlei, um ein Gespräch. Sie kannte Dr. Krübel schon seit sie in den Kindergarten gegangen war, ihre Mutter hatte für ihn als Schreibkraft gearbeitet. Er reagierte entsetzt, als sie ihn bat, ihre Mandanten auf die anderen Anwälte zu verteilen.
„Melanie, überleg dir das bitte. Du solltest das nicht überstürzen. Du kannst doch nicht vergessen haben, wie schwierig das Studium war, den Stolz deiner Mutter, als du alle Prüfungen bestanden hattest. Willst du das alles wegwerfen? Dein Mann ist doch auch Anwalt, was sagt denn er dazu?“
Als sie nicht geantwortet hatte, schien er zu ahnen, um was es ging und nickte langsam: „Oh, ich glaube, ich verstehe. Du tust das gar nicht für dich, du tust das für ihn. Dann kann ich dir nur umso eindringlicher raten, es dir noch einmal zu überlegen. Nimm dir meinetwegen eine Auszeit, aber schmeiß jetzt nicht alles hin.“
Sie hatte nicht auf ihn gehört, blieb fortan zu Hause und verbrachte ihre Tage in endloser Langeweile. Sie hatte Fieber gemessen und Kurven angelegt, kiloweise Obst und Gemüse gegessen und nach dem Sex die Beine in die Luft gehalten, schwanger geworden war sie trotzdem nicht.
Der einzige, der für sie Verständnis aufgebracht hatte, war Torben, Rogers jüngerer Bruder. Er ließ sich nur selten bei der Familie sehen, tingelte durch die Welt, frei und ungebunden.
„Heiraten und dann so ein Leben führen, wie all diese Spießer, wie Roger? Das ist nichts für mich, du siehst doch, was dabei herauskommt“, hatte er gelacht. „Du warst mal eine mega Frau, Melanie, eine stolze Rose, die ich bewundert habe. Heute bist du nur noch ein Veilchen, sittsam, bescheiden und rein, ein blasses Blümchen, das keiner mehr sieht. Genau, ich werde dich ab jetzt Veilchen nennen, so lange, bis du dich endlich wehrst und nicht länger von dieser Familie fertigmachen lässt. Glaubst du denn, denen geht es um dich? Für die bist du austauschbar, nur ein Uterus, sie wollen ihren Erben, egal, von wem. Ja, auch Roger, dem ist es schon als Kind nur darum gegangen, unsere Eltern zufrieden zu stellen, der brave, bessere Sohn zu sein. Ein Mann, der seine Frau liebt, guckt nicht zu, wie sie immer unglücklicher wird. Ich an seiner Stelle wäre längst mit dir weggegangen. Verlass ihn und komm mit mir. Ich verspreche, dich nicht damit zu nerven, unbedingt ein Kind zu bekommen.“
Er hatte gelacht, sein Glas ausgetrunken und war wieder für Monate verschwunden; keiner wusste, wohin. Sie hatte Roger nie von diesen Gesprächen erzähl. Sie wollte nicht noch Öl ins Feuer gießen. Er hielt ohnehin nichts von seinem jüngeren Bruder, für ihn war er ein verantwortungsloser Taugenichts.
„Torben lebt nur auf Kosten anderer. Würden die Eltern ihn nicht ständig finanziell unterstützen, müsste er wohl unter einer Brücke campieren. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert, in dem jeder nur das tun kann, was ihm Spaß macht. Aber so war er schon immer. Während ich im Studium geackert habe, ist er durch Nepal getrampt, hat in obskuren Ashrams nach dem Sinn des Lebens gesucht und sich einen Scheiß um die Familie geschert. Er taucht auch heute nur auf, wenn er wieder einmal pleite ist.“
Darum hatte sie die Worte von Torben verdrängt und schließlich sogar getan, was sie bisher vehement abgelehnt hatte: Sich von Andreas Brandt untersuchen lassen. Er war der Mann ihrer besten Freundin Julia und auch mit Roger und ihr selbst befreundet. Sogar ihr Schwiegervater kannte ihn schon aus alten Studientagen. Daher war ihr der Gedanke peinlich gewesen, auch wenn er als Koryphäe auf dem Gebiet der ungewollten Kinderlosigkeit galt. Es war Roger gewesen, seine Verzweiflung, seine dauernden Vorwürfe, die sie am Ende doch in seine Praxis gebracht hatten. Nach einem kurzen Blick in die dicke Akte vorausgegangener Untersuchungen, hatte er genickt und sie dann schnell und geschickt untersucht. Seine Worte hallten bis heute in ihrem Kopf nach.
„Melanie“, hatte er gesagt, und seine Stimme war so emotionslos gewesen, als würde er über das Wetter reden. „Melanie, lass uns nicht lange drum herumreden, wir wissen beide, dass du eigentlich kein Kind willst. Es ist nicht dein Körper, es ist dein Unterbewusstsein, das sich weigert, eines zu empfangen. Daran kann man arbeiten, hast du schon einmal über eine Therapie nachgedacht?“
Sie hatte genickt und geschwiegen, auch wenn sie ihn am liebsten geschlagen hätte. Woher nahm er sich das Recht, eine solche Diagnose zu stellen? Hatte er die leiseste Ahnung davon, wie sehr Roger sie mit seinem zwanghaften Kinderwunsch unter Druck setzte? Bestimmt nicht. Vermutlich hatte ihr Mann sich noch darüber beklagt, dass seine böse Frau hinter seinem Rücken die Pille schluckte und er sich somit vollkommen vergeblich abrackerte. Nein, alle waren sich einig, sie war diejenige, mit der etwas nicht stimmte und die zum Psychiater gehörte. Einen Augenblick war sie versucht gewesen, es einfach herauszuschreien.
„Ja, es stimmt, ich bin ein Monster. Keine richtige Frau, weil ich viel lieber Karriere machen möchte, als Kinder zu kriegen. Und diesen ganzen Schwachsinn hier, den mache ich nur für Roger und meine beschissenen Schwiegereltern.“
Davor bewahrt hatte sie nur die Gewissheit, dass er sie nicht verstehen, höchstens für hysterisch halten würde. Zu Hause angekommen, hatte sie einen doppelten Wodka runtergekippt und einen zweiten gleich hinterher. Erstaunt darüber, dass sie sich danach umso vieles leichter fühlte, war sie dazu übergegangen, regelmäßig nach dem Abendessen ein, zwei Gläser zu trinken. Roger, der immer mehr arbeitete und immer später nach Hause kam, hatte vorwurfsvoll den Kopf geschüttelt und ihr Vorhaltungen gemacht.
„Melanie, du solltest nicht so viel trinken. Was, wenn du schwanger wirst und das Kind damit schädigst?“
Sie hatte genickt, versprochen nicht mehr zu trinken und es nicht gehalten. Im Gegenteil, ihre endlosen Tage, das Genörgel ihrer Schwiegermutter und die Enttäuschung ihres Mannes brachten sie immer öfter dazu, schon morgens anzufangen. An einem Abend, sie hatte mehr als gewöhnlich getrunken, weil sie wieder einmal mit Carolin aneinandergeraten war, war es zum Eklat gekommen. Er hatte nach ihr gegriffen und doch tatsächlich: „Na, dann wollen wir mal“ gesagt.
„Hör auf“, hatte sie geschrien, „hör sofort auf, mich rammeln zu wollen, nur um ja keine Gelegenheit zu verpassen, deinen Samen in ein zufällig vorbeikommendes Ei zu spritzen.“
Er hatte sich von ihr abgewandt und geantwortet, sie sei frigide, ihre Eier längst vertrocknet und ihm sei die Lust, sie zu ficken, schon lange vergangen. Jede Katze könne Junge kriegen, nur sie kein Kind. Er hatte sein Bettzeug gepackt und war aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen.
Zuerst war sie erleichtert gewesen, aber mit der Zeit ertrug sie diesen Zustand immer weniger. Sie würde sich scheiden lassen, in ihren Beruf zurückkehren, endlich das tun, was sie gern tat. Sie brauchte die Kreutzers nicht, keinen von ihnen. Mit jedem Glas nahm ihre Entschlossenheit zu, aber wenn sie am nächsten Morgen verkatert und mit höllischen Kopfschmerzen aufwachte, verließ sie der Mut. Von ihrem früheren Selbstbewusstsein, ihrem Vertrauen in sich selbst, war nichts mehr übriggeblieben. Sie fühlte sich leer und diffus schuldig. Das war so unerträglich, dass sie immer größere Mengen Wodka brauchte. Irgendwann kam ihr der Verdacht, Roger schliefe mit anderen Frauen. Darüber hatten sie mehr als nur einen hässlichen Streit gehabt. Sie hatte geweint und geschrien, er geleugnet. Als er sie dabei erwischt hatte, wie sie seine Manteltaschen nach Beweisen durchsuchte, hatte er gedroht, sie in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Sie leide unter Paranoia, sei hysterisch und er habe sie langsam endgültig satt. Er stieß sie zurück, wenn sie taumelnd und lallend versuchte, ihn zu verführen. Seine angewiderten Blicke taten ihr körperlich weh, aber aufhören zu trinken konnte sie schon lange nicht mehr. Immer öfter gelang es ihr nicht einmal, in der Öffentlichkeit den Schein aufrecht zu erhalten.
Ausgerechnet am 70. Geburtstag ihres Schwiegervaters war es dann zum Eklat gekommen. Während der Feier im Golfclub, zu der aus dem Nichts heraus auch Torben erschienen war, hatte sie sich mit Roger gestritten. Ein Wort hatte das andere ergeben, und ein Wodka war dem nächsten gefolgt, bis sie irgendwann schwer betrunken über ihre eigenen Füße gefallen und nicht mehr hochgekommen war. Am Boden liegend hatte sie Roger lallend angeklagt, eine andere zu haben. Alle Gäste hatten es mitbekommen und betreten zugeschaut, wie ihr Mann sie hochgezogen und zum Auto geschleppt hatte.
Zwei Tage später fuhr er sie in eine elegante, diskrete, und weit entfernt von Bad Dürkheim liegende Klinik. Es war ihre erste, vierwöchige Entziehungskur. Außer Torben, der zu ein paar kurzen Besuchen gekommen war, hatte sie niemanden von der Familie zu sehen bekommen.
„Ach Veilchen, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, ist weniger von der Frau übrig, die ich gekannt habe. Willst du dich umbringen, oder was wird das? Hör auf mit der Sauferei, nimm dein Leben wieder selbst in die Hand und ergreif die Flucht. Mach´s wie ich, hau ab, bring möglichst viele Kilometer zwischen dich und den Kreutzerclan. Ich helfe dir, du musst es nur sagen.“
Sie hatte ihm zugehört, genickt und gewusst, dass sie nicht mehr die Kraft finden würde, etwas zu ändern.
Auch der Erfolg des Entzugs hatte nicht lange angehalten, schon zwei Wochen nach ihrer Entlassung war sie rückfällig geworden. Rogers Schweigen, die bösen Blicke ihrer Schwiegermutter und jeder Blick in den Spiegel waren zu viel für sie gewesen. Sie traute sich kaum noch aus dem Haus, mied jeden Kontakt, trank oft bis zur Bewusstlosigkeit. Ihr Aussehen war ihr längst gleichgültig, sie ließ sich gehen, lief in ausgebeulten Jogginghosen und schlabbrigen T-Shirts herum. Obwohl sie kaum noch regelmäßige Mahlzeiten kannte, nahm sie Kilo um Kilo zu. Roger sah sie nur noch selten, er ging früh aus dem Haus, wenn sie noch ihren Rausch ausschlief und kam zurück, wenn sie längst wieder lallend auf ihrem Bett lag. Jahre waren so vergangen und dann hatte Roger ihr eröffnet, dass er sich scheiden lassen würde.
„Das weißt du doch selbst“, hatte er gesagt, „unsere Ehe ist am Ende. Wir haben keine Kinder und uns nichts mehr zu sagen. Meine Eltern sind verzweifelt, weil es keinen Erben für die Kanzlei gibt, und ich will mir nicht den Rest meines Lebens ihre Vorwürfe anhören müssen. Du bist glücklich mit deinen Flaschen, du wirst mich daher kaum vermissen. Ich werde dich finanziell nicht hängen lassen, das versteht sich von selbst. Allerdings knüpfe ich das an die Bedingung, dass du aus dieser Gegend verschwindest. Wir haben genug Mandanten durch dein peinliches Benehmen in der Öffentlichkeit verloren.“
Schweigend hatte sie ihm zugehört. Sie wusste, dass nichts, was sie jetzt sagen konnte, ihn umstimmen würde. Sie hatte bereits zu viel getrunken und in ihrem Kopf herrschte Chaos. Erst am nächsten Morgen war sie in der Lage gewesen, den Kampf aufzunehmen. Über ein Jahrzehnt hatte diese Familie alles getan, ihr Selbstwertgefühl zu zerstören, indem man sie auf die Fähigkeit reduziert hatte, ein Kind zu gebären. Nie hatte sie den Satz ihres Schwiegervaters vergessen, Eine Kuh, die keine Milch gibt, kommtzum Abdecker. Roger hatte ihm nur halbherzig widersprochen und sie war weinend auf ihr Zimmer geflüchtet. Jetzt, mit vierzig, alkoholabhängig und ohne Job, wollte er sie also loswerden. Vermutlich, um mit einer anderen den Wunsch seiner Eltern nach einem Erben zu erfüllen. Nein, das würde sie nicht zulassen, sich nicht einfach beiseiteschieben lassen. Julia musste ihr helfen, ihre alte Freundin aus Kindertagen wusste sicher, was sie jetzt tun konnte, wie sie sich verhalten sollte. Frisch geduscht und halbwegs zurechtgemacht war sie am nächsten Morgen zu ihr gefahren, hatte sie um Verzeihung bitten wollen, dass sie sich so lange nicht bei ihr gemeldet hatte. Es war anders gekommen, banal und so billig, dass sie fast laut aufgelacht hätte. Ihr Ehemann und ihre beste Freundin trieben es auf der edlen Kücheninsel. Julia hatte die Beine fest um Rogers Hals geschlungen und beide waren so vertieft, dass sie die Zuschauerin am Fenster überhaupt nicht bemerkten.
Mit fest zusammengebissenen Zähnen war sie in einen abgelegenen Wingert gefahren, hatte dort das Auto abgestellt, und dann Wut und Enttäuschung so laut herausgeschrien, dass eine Schar Krähen erschrocken aufflog und krächzend das Weite suchte. Danach hatte sie sich zusammengerissen und einen Plan ausgedacht, den sie am Abend Roger präsentieren konnte.
Geduscht, zurechtgemacht und vollkommen nüchtern, hatte sie ihm erklärt, sie wolle noch einmal in diese Klinik nach Zweibrücken gehen und sich danach einen Job suchen. Sobald sie den gefunden habe, sei sie bereit, der Scheidung zuzustimmen. Er hatte sie verwundert angeschaut, die Schultern gezuckt und zugestimmt.
Während ihres Aufenthaltes wälzte sie in langen Nächten Pläne, brachte Julia auf hundert verschiedene Arten um, konfrontierte Roger mit dem, was sie gesehen hatte. Sie ließ ihrer Fantasie freien Lauf, während sie sich real auf die profanste Art rächte, die man sich denken kann, sie ging mit dem Pfleger Björn Henning ins Bett.
In ihren Therapiesitzungen wiederholte sie in einer Endlosschleife, dass ihr Mann sie mit der besten Freundin betrog, um dann irgendwann, zu ihrer Verwunderung feststellen zu müssen, dass ihre Wut auf Roger verschwunden war. Nach drei Wochen war sie überzeugt, dass Julia die alleinige Schuld traf. Männer waren leicht verführbar und sie selbst hatte ihn mit ihrer Trinkerei in die bereitwillig geöffneten Arme ihrer besten Freundin getrieben. Diese falsche Schlange wollte ihr den Mann wegnehmen, aber das würde sie nicht zulassen, egal, was sie dafür tun musste.
Als sie schließlich nach Hause zurückkehrte, war ihre Verzweiflung gänzlich kühler Planung gewichen. Die erste Zeit hatte Roger sie argwöhnisch beobachtet, war aber nach einer Weile zugänglicher geworden und irgendwann gelang es ihr, ihn zu verführen. Dabei war etwas von der früheren Nähe zwischen ihnen entstanden und sie noch einmal auf seinen Kinderwunsch zu sprechen gekommen. Ein einziger Satz nur, aber Rogers Reaktion war unerwartet heftig gewesen. Er hatte sich abrupt auf den Rücken gedreht, eine Weile geschwiegen und dann gesagt: „Melanie, hör auf mit diesem Thema, ein für alle Mal! Ich habe jahrelang alles dafür getan, dass du schwanger wirst. Du weißt doch, wie wichtig ein Erbe für uns alle gewesen wäre. Jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt will ich nicht mehr. Du hast zehn Jahre lang tagtäglich getrunken, das hinterlässt Spuren, wer weiß also, was dabei herauskäme? Das Risiko ist mir viel zu groß. Wenn du weiterhin auf Alkohol verzichtest, kann es von mir aus so bleiben, wie es jetzt ist.“
Nach einem Blick in ihr Gesicht hatte er sich ihr zugewandt und ungeduldig gesagt: „Melanie, ich meine das bitter ernst.