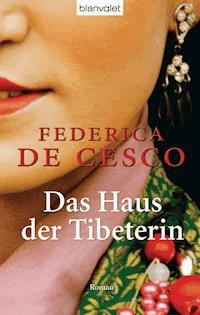Inhaltsverzeichnis
DIE AUTORIN
Widmung
Inschrift
Was bisher geschah
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Copyright
DIE AUTORIN
Federica de Cesco, geboren in der Nähe von Venedig, wuchs mehrsprachig in verschiedenen Ländern auf und studierte in Belgien Kunstgeschichte und Psychologie. Nachdem sie bereits über 50 erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher verfasst hat, begeistert sie seit ihrem Bestseller »Silbermuschel« auch zahllose erwachsene Leser, zuletzt mit »Die Augen des Schmetterlings«. Federica de Cesco lebt mit ihrem Mann, dem japanischen Fotografen Kazuyuki Kitamura, in der Schweiz.
Von Federica de Cesco ist bei cbt ebenfalls erschienen:
Im Zeichen der roten Sonne (30398)Im Zeichen des himmlischen Bären (30399)
Für Ellen Eberle
»Folge in Sinnen und Trachten stets der Eingebung deinesGewissens. Erwarte nicht, dass andere dein Tun billigen.Jener, der nach bestem Gewissen lebt und in Edelmut stirbt,erkennt und gehorcht nur seinen eigenen Gesetzen.«
Tausendundeine Nacht
Was bisher geschah
Im 2. Jahrhundert nach Christus herrscht über Yamatai, eine Provinz im Süden des heutigen Japan, die Priesterkönigin Himiko. Das Volk lebt in Frieden und Wohlstand. Doch die uralte Dynastie ist erschöpft, ihre Lebenskräfte verbraucht. Um die Reinheit der königlichen Linie zu erhalten, verführt Himiko ihren jüngeren Bruder Susanoo. Eine Tochter wird geboren: Toyo, die »Schimmernde Perle«. Das Mädchen wird als Schamanin (Orakeldeuterin) im Dienst der Sonnengöttin Amaterasu erzogen.
Als Toyo vierzehn Jahre alt ist, bricht eine Naturkatastrophe über das Land herein. Susanoo wird beschuldigt, durch einen Frevel die Gottheit erzürnt zu haben. Himiko scheut sich, das Urteil über ihn auszusprechen, und überträgt Toyo die Entscheidung über Leben und Tod. In Unkenntnis darüber, dass Susanoo ihr Vater ist, belegt ihn Toyo mit dem Bannfluch. Um seine Ehre zu rächen, schmiedet Susanoo eine magische Waffe, das »Sternenschwert«, und greift an der Spitze der gefürchteten »Sperbermenschen« die Hauptstadt Amôda an. Dank ihrer hellseherischen Fähigkeit kann Toyo den Überfall vorausahnen und ihre Mutter warnen. Drei Tage und drei Nächte gelingt es Königin Himiko, die Stadt zu halten. Dann wird sie im Kampf verwundet. In ihrer Not beauftragt sie Toyo, über das Meer zu segeln und den König von Nimana (dem heutigen Korea) um Hilfe zu bitten. Es gelingt Toyo, den jungen Prinzen Iri als Verbündeten zu gewinnen. Der Ansturm der Steppenreiter rettet die Stadt vor der Belagerung. Susanoo demütigt Iri im Zweikampf, doch als er erfährt, dass seine Schwester im Sterben liegt, legt er ihr das Sternenschwert zu Füßen. Die Königin weiht die Waffe der Sonnengöttin. Sie lässt die feindlichen Prinzen schwören, es nie für ehrlose Zwecke zu verwenden. Dann stirbt sie. Susanoo wird in Ketten gelegt. Das Todesurteil ist schon gesprochen, als Toyo die Wahrheit über ihn erfährt. Da befreit sie Susanoo aus dem Kerker: Er wird Yamatai verlassen und ein neues Königreich gründen. Dann, entgegen ihren Gefühlen, nimmt sie Iri zum Gemahl: Das Matriarchat wird vom Patriarchat der Steppenreiter abgelöst.
Fünf Jahre vergehen. Susanoo herrscht über das Land Izumo. Toyo hat Iri alle politische Macht übertragen. Der junge Fürst hat seinen Herrschersitz nach Amôda verlegt, wo er unter dem Titel »Sujin« (Allerhöchste Majestät) regiert. Der Eroberungsdrang liegt ihm im Blut: Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Handelswege in alle vier Himmelsrichtungen unter seine Kontrolle zu bringen und das Ostmeer zu erreichen. Bei seinem Feldzug stößt er auf den Widerstand der Ainu-Stämme, den Ureinwohnern Japans. Unter der Führung ihres Königs Azamaro schlagen sie Iris Reiterheer zurück. Die Ainu, die sich selbst die »Kinder des Nordsterns« nennen, betrachten den Bären – Symbol dieses Gestirns – als ihren Schutzgeist. Azamaros Tochter Kubichi wurde auf dem »Kunne-Iomante«, dem »Heiligen Berg«, von einer Bärin zusammen mit ihren Jungen gesäugt und übt über diese Tiere eine geheimnisvolle Macht aus.
Um endlich den Sieg zu erringen, bricht Iri den Schwur, den er einst leistete: Er bemächtigt sich des »Sternenschwertes«. Doch sein Heer erleidet eine vernichtende Niederlage. Und das Orakel sagt, dass nur Susanoo, der Mann, der die Waffe einst schmiedete, das magische Schwert führen kann. Im Auftrag des Königs reitet Toyo nach Izumo und überzeugt Susanoo, als Verbündeter an Iris Feldzug teilzunehmen. Während der Schlacht tötet er Azamaro im Zweikampf. Entgegen Iris Willen veranlasst er, dass der Leichnam des Königs seinem Volk zurückgegeben wird.
Um ihren Vater zu rächen, führt Kubichi die »Heiligen Bären« in den Kampf, doch sie wird gefangen genommen. Susanoo verliebt sich in die stolze »Bärenprinzessin«. Er heiratet sie nach den Bräuchen der Ainu und zieht damit den Zorn Iris auf sich.
Und jetzt: Der Winter bricht herein. Das königliche Heer hat in der Festung von Tatsuda, am Grenzgebiet der Ainu, Quartier genommen. Iri kann die Schmach, die Susanoo ihm angetan, nicht vergessen und sinnt auf Rache. Und Toyo bewacht das »Sternenschwert«, das Susanoo ihrer Obhut anvertraute …
1
Ich schreckte aus tiefem Schlaf auf. Irgendetwas hatte mich geweckt. Einen Augenblick lang lag ich wie erstarrt und lauschte. Alles war still. Und dennoch …
Der Tag brach an; schon war die Decke aus Zedernholz zu erkennen. Der Raum war durch Schiebetüren in verschiedene kleine Zimmer aufgeteilt. Die schwarz geränderten Binsenmatten, die den Boden bedeckten, waren seidenweich. Zum Schlafen wurden Decken darüber ausgebreitet. Mein Gemach führte auf eine Veranda, die durch eine Holztreppe mit dem Wehrgang verbunden war. Ich hasste die Festung, die aus einem Gewirr von Mauern mit verschachtelten Zinnen, strohgedeckten Gängen und sandbestreuten Innenhöfen bestand. Ein außergewöhnlich hoher Wachtturm überragte die Burg. Der Graben, der die äußeren Mauern umgab, war so tief, dass die Soldaten ihn den »Bodenlosen« nannten. Mineralien hatten dem Wasser seine eigenartige grüne Färbung gegeben.
Die Festung Tatsuda erhob sich am Rand eines Landstrichs, der mit Schilf und Buschwerk bewachsen war und sich nach Süden bis ans Meer ausdehnte. Es war ein Sumpfgebiet, von unterirdischen Quellen durchzogen. Im Norden und Osten schlossen sich Laub- und Nadelwälder an. Es war Spätherbst. Tagsüber schien die Sonne warm, aber in der Nacht fegte der kalte Wind die Treppen hinauf, pfiff unter den Türen hindurch und wirbelte das Stroh auf dem Boden auf. Die Blätter fielen von den Bäumen und der Wallgraben schimmerte im Nebel.
Ich schlief allein: Immer seltener teilte ich das Lager des Königs. Er nahm das hin von mir; doch ich spürte, dass er sich insgeheim vor mir fürchtete. Bewegungslos starrte ich in die Schatten der Dämmerung. Ein Bild stieg in meinen Gedanken auf: Ein schwarzer Hengst raste an den Wachtposten vorbei, stürmte durch den Torbogen in den Innenhof. Ein seltsamer Schmuck, in Form einer Knochensichel, war mit Lederbändern an seiner Mähne befestigt. Ich sah, wie ich selbst im sinkenden Sonnenlicht an das Tier herantrat, den Schmuck aus der schweißgetränkten Mähne löste; ich sah, wie ich Iri, meinem Gemahl, entgegenschritt, ihm wortlos die Sichel hinhielt. Ich erinnerte mich an alles: an das Schweigen, an Iris Gesicht und an die mörderische Wut, die in seinen Augen glühte. Ich hörte ihn die Worte ausstoßen: »Ich werde ihm bei lebendigem Leibe das Herz aus der Brust reißen!« Dann hatte er sich abgewandt, war hinter den Pfosten verschwunden. Zurück blieben die Schatten und die bedrückende Stille. Die Krieger senkten die Köpfe und Furcht flackerte in ihren Augen … Ich aber hatte mein Schlafgemach aufgesucht. Vor meinem Bronzespiegel kniend, hatte ich die Sichel um meinen Hals gelegt. Sie war Schmuck und Waffe zugleich; sie hatte schon Menschen getötet. Bei jedem Atemzug spürte ich die Sichel auf meiner Haut. Manchmal, im Halbschlaf, streichelten meine Finger über die glatt polierte Fläche. Es war ein aufwühlendes Gefühl, das mein Herz schneller schlagen ließ und meine Träume zu der Frau hintrug, der dieser Schmuck gehörte …
Ich erinnerte mich an etwas, das weit zurücklag. Ein Mann beugte vor mir das Knie. Er trug einen schwarzen Mantel. Sein langes Haar berührte den Boden. Mit langsamen Bewegungen löste er ein Schwert aus seiner Schärpe und legte es in meine Hände. Ich hörte seine dunkle, ruhige Stimme: »Bewahrt es sorgfältig auf, Priesterin. Ich brauche es jetzt nicht mehr.«
Ich vermeinte die eiskalte Berührung des Stahls noch in meinen Handflächen zu spüren. Das Schwert, das er mir anvertraut hatte, war kein gewöhnliches Schwert: Es war einzig in seiner Art. Sieben flammengleich gebogene Klingen traten aus dem mächtigen Schaft. Der Griff war aus massivem Silber. Die in den Stahl eingravierten Geheimworte waren gleichsam auch in mein Gedächtnis eingeprägt:
»Zur Mittagszeit, am elften Tag des fünften Monats des vierten Jahres von Taihô, wurde das Schwert mit den sieben Klingen vollendet, aus mehr als hundertmal gehärtetem Eisen. Es wehrt die Gefahr ab in der Schlacht, es ist Prinzen und Königen würdig …«
Wir nannten die Waffe das »Sternenschwert«, denn in ihm lebte der Geist der Sterne, die Kraft des Alls. Es war von Susanoo-no-Mikoto, dem Herrscher von Izumo, in einer einzigen Nacht geschmiedet worden. Zweimal hatte mein königlicher Gemahl versucht, das Schwert in seinen Besitz zu bringen. Er verstieß dabei gegen die uralte Tradition, die vorschrieb, dass ein Krieger seine Waffe selbst zu schmieden hat. Die Gottheit zürnte ihm deswegen und strafte ihn hart. Nur Susanoo war dazu berufen, das Sternenschwert zu führen. Aber Susanoo hatte den König gedemütigt und sich des Hochverrats schuldig gemacht. Er hatte sein Schwert der Sonnengöttin geweiht und es meiner Obhut übergeben.
Jetzt ruhte das Schwert, in weiße Seide gehüllt, in einer Truhe aus Ebenholz. Es wurde im Heiligtum aufbewahrt. Zwei Priesterinnen, Etsu und Hana, bewachten es abwechselnd Tag und Nacht. Ich selbst war als Sonnenpriesterin dem Dienst der Göttin Amaterasu, dem Quell allen Lebens, verschrieben. Von frühester Kindheit an hatte ich gelernt, meine hellseherischen Fähigkeiten zu entwickeln, Visionen heraufzubeschwören und Träume zu deuten. Seit der Rückkehr des schwarzen Hengstes spürte ich, dass sich etwas ereignen würde. Das Gefühl war unheimlich und Furcht einflößend wie ein Albtraum. Ich wusste, dass Iri auf Rache sann. Kühl und berechnend schmiedete er seine Ränke, so wie eine Spinne ihr Netz webt …
Ich lag schon eine Zeit lang wach; mein Kopf schmerzte und mein Atem ging schwer. Meine Lippen waren trocken, und ich fragte mich, ob ich wohl Fieber hatte. Doch meine Stirn war kühl und meine Glieder überliefen keine Schauer. Dennoch fühlte ich, dass mir die Gottheit eine Warnung schickte. Mir war, als spürte ich, geheimnisvoll über mir schwebend, ihre Gegenwart.
Ich warf meine Decke zurück und stand auf. Rasch ordnete ich mein Gewand und strich mir das wirre Haar aus dem Gesicht. Meine bloßen Füße glitten lautlos über die weichen, elastischen Bodenmatten. Behutsam ließ ich die Schiebetür zur Seite gleiten. Meine Dienerin Maki schlief auf einer Matte vor meinem Gemach. Ich wollte sie nicht wecken und stieg vorsichtig über sie hinweg.
Tatsuda war eine Kriegsfestung. Der Kaiser hatte sie prunkvoll ausstatten lassen, aber ihre besondere Bestimmung ließ es nicht zu, dass das Heiligtum abseits der Wohnräume auf Pfählen errichtet wurde. Die Kultgegenstände wurden in einem Raum aufbewahrt, der mit meinen Gemächern durch einen Korridor verbunden war. Leise schritt ich den Gang entlang. Ich hatte die Lederbänder aufgeknotet und die Sichel von meinem Hals genommen. Instinktiv hielt ich sie nicht wie ein Schmuckstück in der Hand, sondern wie eine Waffe, die sie eigentlich war. Vor dem Heiligtum kniete ich nieder und klopfte leise mit den Fingerspitzen an die Schiebetür, in der Annahme, dass die wachende Priesterin mich hören würde. Doch nichts rührte sich. Ich vernahm nur mein eigenes Herzklopfen und das Rascheln meines Seidengewandes, als ich die Tür zur Seite schob. Im Halbdunkel sah ich den Tragaltar aus Pappelholz zwischen den rot lackierten Pfosten. Über dem Altar hing eine armdicke »Shimenawa«, die »Schnur der Läuterung«, aus geflochtenem Reisstroh. Diese Schnur grenzte die heiligen Dinge von den weltlichen ab. Dünne Streifen aus geweihter Seide, die ich selbst gewebt hatte, waren girlandenförmig daran befestigt. Vor dem Altar stand die Truhe aus Ebenholz und davor sah ich die beiden Priesterinnen regungslos am Boden liegen. Eine heiße Zorneswelle stieg in mir hoch. Wie konnten die Frauen ihre Pflicht vergessen und schlafen! Meine Empörung jedoch verflog schlagartig. Die Haltung der Priesterinnen hatte etwas Unnatürliches an sich. Ich trat näher und beugte mich über Etsu, die Ältere. Ich berührte ihre ausgestreckte Hand: Sie war schlaff und warm. Zwischen ihren halb geschlossenen Lidern schimmerte das Weiße der Augen. Hana lag neben ihr und atmete mühsam. Ihre Schultern hoben und senkten sich bei jedem Atemzug. Das aufgelöste Haar klebte an ihrem Gesicht. Mit einem Mal begriff ich: Den Frauen war ein Schlaftrunk eingeflößt worden! Ich richtete mich auf. Meine Augen hasteten durch den Raum, blieben an der Truhe vor dem Altar haften. Da sah ich, dass sie leer war. Die Seide schimmerte wie bläuliches Flusseis im Morgenlicht. Das Sternenschwert war verschwunden! Einige Atemzüge lang stand ich wie versteinert. Meine Ahnung hatte mich nicht getäuscht! Dann flammte Wut in mir auf; sie brauste in meinem Kopf, schüttelte meinen Körper, bis ich fast wahnsinnig wurde. Ich wusste, wer den Befehl gegeben hatte, das Sternenschwert aus dem Heiligtum zu entfernen. Mit beiden Händen umklammerte ich die Knochensichel, bis ein stechender Schmerz mich wieder zur Besinnung brachte: Ich wandte die Augen von der leeren Truhe ab, sah den blutigen Einschnitt in meiner Handfläche, dort wo die Schneide der Sichel in meine Haut gedrungen war. Das Blut quoll aus der Wunde und floss über mein Handgelenk. Dunkle Tropfen fielen auf die Matte. Ich dachte mit stumpfem Geist: »Ich werde die Matten erneuern müssen …«
Ich wandte mich ab. Verließ das Heiligtum. Die Blutstropfen hinterließen eine rote Spur, als ich durch den Gang zurückschritt. Maki war erwacht. Sie kniete auf der Matte, ordnete hastig und verstört ihr Gewand. Als sie mich sah, öffneten sich ihre Lippen zu einem Schrei, doch sie gab keinen Laut von sich. Ich hörte, wie die Festung erwachte. Gedämpft drangen die Geräusche aus der Halle die Treppe herauf. Diener fegten die Höfe und schrubbten die Holzböden mit heißem Wasser, während die Wachtposten sich Befehle zuriefen. In den Stallungen wieherten die Pferde. Die geschwungenen Dächer leuchteten im rosigen Sonnenlicht.
Mit ruhiger Stimme sagte ich zu Maki: »Verbinde meine Wunde und kleide mich an. Lasse den König wissen, dass ich ihn zu sprechen wünsche.«
2
Maki pflegte meine Hand und band ein weißes Tuch um die Wunde. Ich befahl ihr, mir mein Priestergewand anzulegen. Über ein Untergewand aus kühler weißer Seide wurde ein scharlachfarbener Umhang geworfen. Seine Ärmel, die Schmetterlingsflügeln glichen, reichten bis zum Boden. Eine weiße Kordel, deren Knoten zu einer Acht geschlungen war, umschloss meine Taille. Mein Haar, das ich einst der Göttin geopfert hatte, war wieder gewachsen und fiel mir über die Schultern. Maki band es mir im Nacken mit einem Reisstrohband zusammen. Mein Gesicht wurde weiß gepudert, die Lippen karminrot geschminkt. Ich war sehr ruhig. Ich wusste, der Kampf hatte begonnen, und ich war bereit.
Der Page, den ich ausgeschickt hatte, kam zurück. Er warf sich vor mir auf die Knie und sprach: »Majestät, der König hat soeben die Ratssitzung einberufen. Doch er bittet Euch um die Ehre, ihn nach Beendigung der Sitzung in Euren Gemächern zu empfangen.«
Ich spürte, wie mir unter der weißen Schminke die Röte ins Gesicht schoss. Zwar wusste ich, dass Iri die Gewohnheit hatte, seine Ratssitzungen in der ersten Stunde nach Sonnenaufgang abzuhalten, doch der Sinn seiner Botschaft war klar: Er ließ mich wissen, dass er mein Anliegen als unbedeutend von sich wies. Das war nicht allein eine Kränkung, sondern auch eine Herausforderung.
Wortlos entließ ich den Pagen. Maki hielt mir meinen Bronzespiegel entgegen. Ich prüfte mein Gesicht, das Perlmutter gleich unbeteiligt kühl und unergründlich schimmerte. Plötzlich verwischte sich das Bild vor meinen Augen: Mir war, als glitzerten Wellen auf der Fläche des Spiegels, als wäre mein Körper von Wasser umfangen. Das Blut rauschte und dröhnte in meinen Ohren. Mein Herz begann, stürmisch zu klopfen: Ich wusste, dass mir die Gottheit ein Zeichen sandte.
Fast gewaltsam riss ich mich von der Betrachtung des Spiegels los. Ich erhob mich und Maki ordnete die Falten meines Gewandes. Sie schob kniend die Schiebetür auf. Ich verließ das Gemach, schritt langsam durch die Gänge, vorbei an den Wachen, die in Abständen von zwanzig Schritt Aufstellung genommen hatten und von den schrägen Sonnenstrahlen grell beleuchtet wurden. Meine Schleppe glitt über die Matten wie purpurroter, knisternder Schaum.
Vor dem Sitzungssaal, zu beiden Seiten des Tores, standen regungslos, Schulter an Schulter, die Wachen, die Rechte am Schwertgriff, die Linke an der Scheide, bereit zuzuschlagen. Die königliche Standarte war vor den Torflügeln aufgepflanzt: geschmückt mit Sonne und Mond; denn so wie diese Himmelskörper ihr Licht bei Tag und Nacht über die Welt verbreiten, so erhaben leuchtete der Herrscher über sein Volk. Ein Adler saß auf der Querstange der Standarte, an die er mit einer Eisenkette gefesselt war. Sein Name war Kana, der »Goldene Bote«. Er galt als Sinnbild der königlichen Macht, doch seine Funktion war nicht nur symbolisch: Der Herrscher benutzte ihn, um im Krieg den Feind aufzuspüren. Als ich mich ihm näherte, wippte er gereizt auf seinen Fängen. Er ließ ein scharfes Zischeln hören und plusterte die Federn auf. Der Wärter, der am Boden kauerte, zog an der Kette und pfiff beruhigend zwischen den Zähnen. Der Adler senkte wieder die Flügel. Den Blick geradeaus gerichtet, ging ich an ihm vorbei. Ein Offizier salutierte und öffnete mir den Torflügel. Ich trat in den Sitzungssaal. Die vergitterten Fensterschlitze ließen nur spärliches Sonnenlicht herein. Fackeln erhellten den Saal. Die mächtigen Deckenbalken glänzten wie Bernstein. Wohlriechende Hölzer glimmten in kunstvoll verzierten Bronzegefäßen. Die Ratsmitglieder saßen mit untergeschlagenen Beinen vor der Estrade, auf der der König Platz genommen hatte. Generäle und Offiziere hatten ihre Schwerter vor sich auf den Boden gelegt. Ihre Gesichter waren unbewegt, ihre Blicke durchdringend und kalt. Das Licht der Fackeln funkelte auf den Brustpanzern; die bunten Seidengewänder schillerten bei jeder Bewegung im wechselnden Spiel der Flammen.
Iri saß auf einem Brokatkissen in der Mitte der Estrade. Er trug ein bronzefarbenes Gewand mit Flügelärmeln, darüber einen leichten Harnisch aus Bambus und Silberplättchen. Nach Art der Tungusen war das Haar hochgesteckt und hinten zu einem Knoten gewunden, der mit einer Goldspange gehalten wurde. Zwei Schwerter – ein kurzes und ein langes – steckten in seiner Gürtelschärpe. Sein Gesicht mit den hohen Wangenknochen wirkte kühn und hart, seine schrägen Augen blitzten mit kühler Arroganz, während er die Worte seines Vetters Yi-Am, der zugleich Oberbefehlshaber seiner Flotte war, sinnend zur Kenntnis nahm.
»Majestät«, sagte Yi-Am, »die Ainu haben eine schwere Niederlage erlitten. Außerdem sind im Winter die Flüsse mit Packeis bedeckt und nicht schiffbar. Wir sollten den Frühling abwarten. Sobald das Eis geschmolzen ist, können wir mit einem einzigen raschen Vorstoß über die Inseln gelangen und das Ostmeer erreichen.« Er verbeugte sich steif und schien auf eine Antwort zu warten. Doch Iri strich nur schweigend über den feinen schwarzen Bart, der seine schön geschwungenen Lippen umrahmte.
Oba, einer der Befehlshaber, ein pockennarbiger Mann mit groben Gesichtszügen, verneigte sich und ergriff das Wort. »Majestät, der Herrscher von Izumo ging zum Feind über, und es besteht die Gefahr, dass er Euch in den Rücken fällt. Wenn Ihr den Vorstoß nach Osten wagt, würdet Ihr Eure Provinzen schutzlos zurücklassen. Eure Flanken wären nicht gedeckt und ein Rückzug nicht gesichert …«
Ich hörte Iri kurz und leise auflachen und spürte, wie mein Atem schneller ging. Ich kannte dieses Lachen und den gefährlichen sanften Klang, den er seiner Stimme immer dann gab, wenn er sich am stärksten fühlte.
»Der Herrscher von Izumo beging Verrat an meiner Ehre, an der Ehre seines Volkes und an der Ehre seiner Vasallen. Seine eigenen Verbündeten werden ihn meiden wie die chinesische Krankheit. Nur sehr wenige – außer seinen eigenen Landsleuten – werden seinen Befehlen Folge leisten. Was die Ainu betrifft … sie sind Tiere«, fügte er verächtlich hinzu. »Nichts anderes als Tiere …«
»Jawohl, Majestät, aber gefährliche!«, sagte Yi-Am, der genau wusste, wann er sich einen Scherz erlauben konnte. Der Erfolg blieb nicht aus: Iri schlug sich auf die Schenkel und schüttelte sich vor Lachen und alle anderen lachten beflissen mit.
Doch plötzlich verstummte Iri. Über Yi-Ams Schultern hinweg richtete sich sein Blick auf mich, als ich aus dem hellen Torbogen trat. Stille breitete sich aus. Die Männer berührten mit den Handflächen den Boden und verneigten sich. Langsam schritt ich durch den Saal und warf einen langen Schatten vor mir auf die Fliesen. Es war nichts Ungewöhnliches, dass ich in der Ratssitzung erschien, aber Iris Leute konnten sich nur schlecht daran gewöhnen: Sie kamen aus einem Land, in dem Frauen den Geschäften der Krieger fernblieben. Mein karminroter Überwurf glänzte wie Kupfer im Fackelschein, und ich spürte, wie der Atem der Männer sich beschleunigte. Ich kam zu ihnen nicht als Königin, sondern als Sonnenpriesterin, und jeder wusste, dass dies etwas zu bedeuten hatte. Den Kopf hoch erhoben, schritt ich weiter. Mein Blick ließ nicht von Iri, der wie eine bronzene Gottheit auf der Estrade thronte. Die Wut brannte in mir. Doch mein Ausdruck blieb kühl, meine Bewegungen gemessen, während ich vor die Estrade trat und mich förmlich verneigte. Iri erwiderte gelassen meine Verbeugung, aber seine Augen flackerten nervös: Ich merkte, dass er auf der Hut war.
»Im Namen aller Anwesenden heiße ich Euch willkommen, Toyo-Hirume-no-Mikoto«, sagte er verbindlich. »Es ist uns eine große Ehre, Euch in der heutigen Sitzung begrüßen zu dürfen. Wir haben Dringendes zu besprechen und Euer Rat ist uns sehr willkommen.«
Er winkte einem Diener, der in aller Eile ein Kissen herbeischaffte. »Geruht, Majestät, an meiner Seite Platz zu nehmen.«
Ich rührte mich nicht und antwortete auch nicht mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln. Es kostete mich meine ganze Kraft, meine Erregung zu verbergen, doch ich wusste, dass die ungeheure Spannung trotzdem zu spüren war. Iri wartete, anscheinend gleichmütig. Die Männer verharrten regungslos, mit steinernen Gesichtern.
Ich holte tief Atem. Die Hände in den weiten Ärmeln meines Gewandes verborgen, sprach ich mit klarer, ruhiger Stimme: »Eure Majestät möge zur Kenntnis nehmen, dass in dieser Nacht das Sternenschwert aus dem Heiligtum geraubt wurde. Der Anstifter dieser Tat soll von Schreckgespenstern verfolgt werden. Die Gunst der Göttin sei ihm für alle Zeiten verwehrt!«
Eine Bewegung ging durch den Raum. Die Männer wechselten bestürzte Blicke. Ihr Erstaunen war echt. Ich sah, wie Iris Rücken sich versteifte. Eine Ader begann, an seiner Stirn zu pochen, und seine Augen zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen. »Beschuldigt Ihr mich, das Schwert aus dem Heiligtum entfernt zu haben?«
»Bestreitet Ihr es?«, erwiderte ich eisig.
Er starrte mir ins Gesicht und ich hielt seinem Blick stand. Unsere Augen maßen sich unnachgiebig. Es wurde noch stiller im Raum. Die Männer hielten den Atem an.
Unvermittelt zischte Iri: »Dem Schwert eines Verräters gebührt es nicht, im Heiligtum aufbewahrt zu werden. Ich gab den Befehl, es zu entfernen. Ich ließ es aufs Meer hinausbringen und dort versenken.«
Der Raum drehte sich und es wurde mir schwarz vor den Augen. Meine Glieder jedoch zitterten nicht, und ich hielt mich aufrecht, aber die Furcht schnürte mir die Kehle zu. Mir schien, dass der Raum sich in Nebel auflöste. Ich sah ein grünes, schillerndes Leuchten, in dessen Mitte ein strahlenähnliches Feuer glühte, das zuerst in ein bleiches Weiß, dann wieder in Silber zurückschlug. Ein Stöhnen entfuhr mir. Ich schnappte nach Luft, füllte meine Lungen damit und stieß sie langsam wieder aus. Die Vision erlosch. Ich starrte in Iris hochmütiges Gesicht und kämpfte gegen die Wut an. Keuchend stieß ich hervor: »Ich, Toyo-Hirume-no-Mikoto, Priesterin der Sonne, klage Euch des Frevels an. Fürchtet den Zorn der Göttin!«
Iris Lippen wurden weiß. »Das Schwert war mit Unheil behaftet. Habt Ihr vergessen, dass mein Bruder Itzuse durch diese Waffe den Tod fand?«1
»Ihr hattet die Riten missachtet! Die Kraft des Schwertes wandte sich gegen Euch!«
Iri blieb mir die Antwort nicht schuldig. »Euer Verwandter beging nicht allein Verrat, er hat auch seine Seele den Mächten der Finsternis verschrieben!«
Im Gegensatz zu Iris scharfer Stimme klang meine eigentümlich sanft. »Was sind Licht und Finsternis, wenn nicht das wechselvolle Spiel der unergründlichen Ordnung?«
Iri blickte mich an, als ob er mich mit den Augen erschlagen wollte. »Das Schwert ist versenkt und wird niemals wieder auftauchen! Die Macht des Herrschers von Izumo ist gebrochen. Heute Nacht ließ ich ihm durch eine Brieftaube die Botschaft übermitteln, dass sein Schwert auf dem Meeresgrund verrostet. Wenn er es zurückhaben will …«, Iri gluckste hämisch, »… dann soll er sich in einen Fisch verwandeln!«
Ich holte tief Atem. »Der Herrscher von Izumo«, sprach ich, »vertraute das Sternenschwert meiner Obhut an. Indem Ihr die Waffe aus dem Heiligtum entfernen ließt, habt Ihr die Göttin und mich, ihre Priesterin, beleidigt. Es ist meine Pflicht, der Ehre der Göttin und meiner eigenen Ehre Genugtuung zu verschaffen.«
Im tiefen Schweigen ließ ich meine Blicke über die Männer schweifen. »Alle, die Ihr hier anwesend seid, wisset, dass ich, wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, in einem Boot aufs Meer hinausfahren werde. Man rufe die Krieger zusammen. Vor den Augen der Armee will ich tauchen und das Schwert aus dem Ozean bergen. Jeder soll Zeuge sein, wie ich der Gottheit die Entscheidung über Leben oder Tod überlasse.«
3
Meine Worte fielen mit vernichtender Schärfe in die Stille. Ich sah, wie das Blut aus Iris Gesicht wich. Doch sein Mund blieb verschlossen wie eine zugeschnappte Stahlfalle, während ich mich verneigte und ihm den Rücken zuwandte. Niemand bewegte sich, als ich den Raum verließ. Draußen schlug mir die Helligkeit entgegen. Meine Lider zuckten im grellen Sonnenlicht. Die Burgmauern warfen scharfe Schatten auf den Sand. Hoch oben auf dem Wall gingen zwei Wächter aneinander vorbei und kreuzten ihre Speere zum Gruß. Die Standarten leuchteten in der eisigen blauen Herbstluft.
Ich schritt durch den Hof und stieg langsam die Treppe hinauf. Mein Zorn war verflogen: Unsagbarer Schmerz drückte mich nieder. Als ich fast oben angelangt war, blieb ich stehen und lehnte mich schwer atmend gegen die Mauer. Mein Schluchzen drohte mich zu ersticken, aber es gelang mir, die Tränen zu unterdrücken.
Ich ging weiter. Zwei Männer meiner Leibgarde standen vor meinen Gemächern. Maki kam herbeigeeilt. Sie kniete vor mir hin und löste die Riemen meiner Sandalen von den Füßen. Dann schob sie die Schiebetür beiseite. Als ich die Schwelle überschritt, sah ich gleich die beiden Priesterinnen, die auf der Matte knieten. Sie hatten die Hände flach auf den Boden gelegt und hielten den Kopf gesenkt. Stumm verharrten sie in dieser unterwürfigen Haltung.
Ich wandte mich an Etsu. Sie hob demutsvoll den Kopf, doch blickte weiterhin zu Boden.
»Sprich!«
Etsus Lippen verzerrten sich. »Majestät, wir können mit dieser Schande nicht weiterleben. Wir bitten Euch, unserem Leben ein Ende setzen zu dürfen.«
»Ich brauche Euer Leben!« Meine Stimme klang schneidend.
Etsu kniff die Lider zusammen und schwieg. Hana rührte sich nicht. Ihre Stirn lag auf der Matte, und ich merkte, dass sie weinte.
Ich aber stand tränenlos aufrecht und fuhr fort: »Heute Nacht wurde die Göttin beleidigt. Es ist unsere Pflicht, ihrer Ehre Genugtuung zu verschaffen.«
Etsu holte gepresst Atem. »Verzeiht. Wie lange werden wir diese Schmach noch ertragen müssen?«
»Seine Allerhöchste Majestät legte das Gelübde ab, an der äußersten Grenze des Landes ein Heiligtum zu bauen. Ihr werdet Euer Amt im Dienste der Gottheit noch so lange verrichten, bis dieses Heiligtum fertiggestellt ist. Dann werde ich Euch gewähren, was Ihr begehrt.«
Etsus Stimme war nur ein Hauch. »Wie Ihr befehlt, Majestät. Nehmt unseren Dank entgegen.«
Beide Frauen verneigten sich und ich erwiderte ihre Verneigung. Sie erhoben sich und schritten zur Tür. Maki verbeugte sich und schloss die Tür hinter ihnen. Ich war allein, Maki zählte nicht. Ich ließ mich auf die Matte sinken und heiße Tränen flossen mir über die Wangen. Ich weinte lange, vor Verzweiflung und Einsamkeit. Dann trocknete ich mein Gesicht, ließ mich sorgfältig von Neuem schminken und befahl Maki: »Man soll die Sänfte bereitstellen.«
Die Nachricht, dass ich ins Meer tauchen würde, um das Sternenschwert zu bergen, hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Iri war meinem Entschluss gegenüber ohne Einfluss. Als Sonnenpriesterin stand ich höher als jede weltliche Macht. Sollte es mir gelingen, das Schwert zu bergen, war seine Legende gefestigt: Niemand, nicht einmal der König, würde es nunmehr wagen, sich an der Waffe zu vergreifen. Doch sollte ich mein Leben dabei verlieren, würde sich die Sage von Iris Unbesiegbarkeit über die ganze Inselgruppe verbreiten. So blieb ihm die geringe Hoffnung, aus der Begebenheit Nutzen zu ziehen, und er war klug genug, dem Gottesurteil nichts entgegenzusetzen.
Ich dachte an die Nachricht, die er dem Herrscher von Izumo gesandt hatte. Wie würde Susanoo sie aufnehmen? Würde er sein Heer rüsten und sich mit den Ainu verbünden, um Tatsuda anzugreifen? Ich fuhr mit der Hand über meine Stirn. Ich fühlte, dass ich schwitzte. »Nein«, murmelte ich halblaut, »das wirst du nicht tun. Vorausgesetzt dass du nicht dazu gezwungen wirst …«
Ich konnte hören, wie unten im Hof die Krieger sich sammelten. Das Geräusch der Männerstimmen erfüllte die Luft, als ein Diener kam und meldete, dass die Sänften bereit seien. Ich verließ mein Gemach. Etsu und Hana folgten mir mit gesenkten Blicken, die Hände in den weiten Ärmeln ihrer Kleider verborgen. Ich trug ein Gewand aus blendend weißer Seide. Eine scharlachrote Schärpe war um meine Hüften geschlungen. Alle Augen richteten sich auf mich, als ich auf den Stufen vor den Pfosten erschien. Ein dumpfes Murmeln stieg aus der Menge. Der Wind peitschte die Standarten. Die Wachen standen regungslos Spalier, als ich unter dem braunen Strohdach der Galerie zwischen ihnen hindurchschritt. Alle trugen lange, mit Wimpeln besetzte Lanzen.
Iri saß, einer Statue gleich, in einer nicht verhängten Sänfte, die von vier geharnischten Kriegern getragen wurde. Seine Bronzerüstung schmiegte sich so eng an seinen Körper, dass sie mit seiner Haut verwachsen schien, und die goldenen Zierketten bebten bei jedem Atemzug. Sein Helm war mit Goldplatten an Stirn und Wangen belegt und mit einem geschnitzten Hirschgeweih geschmückt; einen Bogen und Pfeilköcher trug er über der Schulter, als zöge er in den Krieg. Er deutete eine Verbeugung an, die ich kühl erwiderte. Unsere Augen sprachen vom Kampf, den wir miteinander ausfochten.
Die zehn ausgesuchten Männer meiner persönlichen Leibgarde umstanden meine Sänfte. Ihr Befehlshaber hieß Yeasu. Er war breitschultrig und stolz, die Augen pechschwarz und scharf, dunkelhäutig das Gesicht.
Ich bestieg die Sänfte und nahm mit aufrechter Haltung darin Platz. Maki zog die Vorhänge dicht zu, während Etsu und Hana hinter mir in einen Tragsitz stiegen. Yeasu gab den Befehl zum Aufbruch. Die fünfzig Reiter, die den Zug anführten, setzten sich in Bewegung. Die Träger schulterten die Stangen der Sänften und folgten dem Zug. Die Sänfte des Königs wurde vorangetragen, meine war gleich dahinter. Weitere hundert Reiter schlossen sich uns an. Das Fußvolk bildete den Schluss.
Die Hufe schlugen mit dumpfem Geräusch auf den Sand, während der Zug den Innenhof durchquerte. Vor dem Tor und auf allen Mauern der Befestigungsanlagen hatten schwer bewaffnete Wachen Aufstellung genommen. Der mächtige hölzerne Querriegel wurde zurückgeschoben; die riesigen eisenbeschlagenen Flügel des Festungstores schwangen auf. Das Fallgitter war hochgezogen. Die Holzbrücke dröhnte, als die Hufe darüber hinwegklapperten. Durch die Ritzen der Vorhänge sah ich den smaragdgrünen Wasserspiegel des Grabens. Eine Weile lang folgten wir der Ringmauer. Wir stiegen eine leichte Anhöhe hinunter und schlugen dann den Weg zum Meer ein. Das grelle Sonnenlicht drang durch die Vorhänge, die sich im Wind bauschten. Ich bedeckte meine Lider mit den Händen und betete zur Göttin: »Mutter, du ewig Strahlende, die du alles beherrschst, was sich unter dem Himmel erstreckt, das Land und das Meer, lass nicht zu, dass du geschmäht wirst, sondern behandle mich wie deine Tochter!«
Als wir den Strand erreichten, frischte der Wind auf. Die Sänften wurden im Sand abgesetzt. Maki zog die Vorhänge zurück; ich blinzelte in die gleißende Helle, atmete den Geruch von Seetang und Salz. Das Meer war wie flüssiger Türkis, von schäumenden Wellen gekrönt. Hier und da ragten Felsklauen hervor. Das Wasser sah sehr kalt aus.
Ein Baldachin war für den König und sein Gefolge an einer geschützten Stelle errichtet worden. Iri nahm mit seinem Hofstaat auf Brokatkissen Platz, während sich die geharnischten Reiter in einer langen Phalanx aufstellten. Hinter ihnen drängte sich das Fußvolk. Alle Anwesenden mussten ihre Schnallen, Gürtel und Bänder lösen; keine einzige Schnur durfte verknotet sein, so verlangte es das Ritual.
Obwohl so viele Menschen am Strand versammelt waren, wurde es still, als ich der Sänfte entstieg. Die See schäumte, die Standarten flatterten ungestüm. Der Wind wirbelte den mehlfeinen Sand auf. Zwischen meinen Zehen knirschten Sandkörner, Haare und Augenbrauen waren weiß überpudert. Die Sonne leuchtete grell und hart am Himmel. Ich hob den Blick, versuchte, ihrem Glanz standzuhalten, und rote Kreise begannen, sich vor meinen Augen zu drehen.
Mit einer Rute aus Weidenholz zogen Etsu und Hana einen Kreis in den Sand. Ich kniete mich in seiner Mitte nieder und sprach halblaut das Gebet, das mir zur Vision verhelfen sollte: »Mein Körper besteht nur aus Augen. Schaut ihn an! Betrachtet ihn und fürchtet euch nicht! Ich sehe in alle Richtungen …«
Ich löste meine Schärpe und die Bänder in meinem Haar. Dann legte ich mich im Sand nieder und streckte die Arme über dem Kopf aus. Hana hatte kleine Bambuspflöcke in den Boden geschlagen. Mithilfe von Reisstrohschnüren fesselte Etsu meine Hand- und Fußgelenke daran. Während sie diese Handlung vollzog, wurde von den Anwesenden erwartet, dass sie die Augen senkten und nicht hinsahen. Ich wurde gefesselt, »um nicht von den Geistern gepackt zu werden«. Eine ganze Weile schon starrte ich in die Sonne. Sie war riesengroß und weiß: ein Feuerbündel. Bald ging mein Atem schwer und röchelnd. Ich straffte die Arm- und Beinmuskeln und versuchte, die Fesseln zu lösen. Vergeblich riss und zerrte ich an den Schnüren; sie waren so geknotet, dass sie immer tiefer ins Fleisch schnitten, je mehr ich daran zog. Während Hana mit einem Stab auf eine kleine hölzerne Trommel schlug, hatte Etsu ein Feuer angezündet. Als die Kohlen rot glühten, warf sie eine Kirschbaumrinde in die Flammen. Ich atmete den schweren, süßlichen Rauch ein, der mit jedem Windstoß über mein Gesicht wirbelte. Ich keuchte, glaubte zu ersticken. Meine Augen brannten wie Feuer, die Sonne schien in mein Gehirn zu dringen. Ihr weißer Kern flackerte so glühend und wild, dass es mein Wahrnehmungsvermögen überstieg. Mit letzter Kraft stieß ich die geheiligten Worte hervor: »Der Weg ist bereit, der Weg ist offen für mich!« Und die Priesterinnen antworteten, wie es das Ritual vorschrieb: »Lasst den Weg sich für sie öffnen!« Ein scharfer, unerträglicher Schmerz fuhr wie ein Dolchstoß durch meinen Kopf. Ich schrie; ich hörte mich schreien. Der Schrei gellte über den Sand, gellte über die Wogen. Ich spürte, wie meine Seele sich aus dem Körper losriss und in die flammende Helle tauchte. Ich hörte das Stöhnen und Wispern unzähliger Stimmen. Ich hatte keine Furcht, ich wusste, dass es die Stimmen der Verstorbenen waren, die mir den Weg zeigten. Die Stimmen wurden immer verworrener, immer lauter; verwandelten sich in ein auf- und abschwellendes Rauschen. Ein Schleier schien sich von meinen Augen zu lösen: Grüne, flimmernde Helle umgab mich. Es war jenes smaragdgrüne Leuchten, von goldenen Strahlen durchwoben, das ich in einer früheren Vision schon gesehen hatte. Ein unentwegtes Zittern bewegte das Grün, wobei die Helligkeit zu- oder abnahm. Und durch das Flimmern und Leuchten vernahm ich ein Pochen, das sich mit dem Klopfen meines Herzens, dem Auf und Ab meines Atems vermischte. Plötzlich sah ich dort im Lichtkern eine große, dunkle Masse. Es waren drei riesige Steine, die mit mahlenden Bewegungen langsam hin- und herglitten und eine schmale Öffnung sichtbar werden ließen, deren Form sich ständig veränderte. Ein Sog trieb mich auf diese Öffnung zu. Die Steine wuchsen in die Höhe, hingen über mir wie drohende schwarze Schatten. Ich rief die Göttin um Hilfe an, tauchte in den klaffenden Spalt. Die Felsen glitten über mir hinweg und vor mir lag im schimmernden Glanz der Meeresgrund. Hin und wieder senkte sich ein goldener Lichtvorhang auf den Meeresboden und sprühte in Myriaden glitzernder Funken auf. Ein tiefes Keuchen und Schnaufen übertönte das Rauschen: Es waren die Meerestiere, die den Ozean bewachten. Ich sah bronzefarbene Wale, Seehunde mit schimmernden Augen und Fische mit Schuppen aus leuchtendem Filigran. Ein silbernes Tuch umhüllte die Delfine und ein Perlenmantel bedeckte die Fangarme der Tintenfische. Ich sah wogenden Seetang, purpurne Korallenbüsche und langsam kreisende Algenranken. Ich tauchte immer tiefer. Glitzernde Wesen mit feurigen Augen und Schaumschweifen gaben mir das Geleit. Das Wasserrauschen durchdrang mich. Ich selbst war das Meer, war eine der Erscheinungen aus Licht, die sich im Rhythmus der Wellen langsam und stetig bewegten. Jetzt glitt ich auf einen Felsen zu, an dem weiße Korallenschlacke haftete. Ich sah ihn sehr deutlich: Er hatte die Form eines Dreiecks, das sich nach oben verjüngte. Im Schatten des Felsens ragte ein silbernes Gewächs aus der Tiefe empor. Im spiegelnden Wasser nahm es immer mehr feste Umrisse an … und mit einem Mal erkannte ich das Leuchten der sieben stählernen Klingen!
Ich schrie auf und mein Schrei schien das Meer zu spalten. Das Wasser begann, mich nach oben zu treiben, dann aufwärtszuwirbeln. Ich schrie, schrie ohne Unterlass. Und plötzlich, mit einem gewaltsamen Schock und unerträglichem Blenden gab der Ozean mich frei. Ich keuchte, stöhnte, füllte meine Lungen mit Luft. Über mir leuchtete wie ein Feuerball die Sonne, und ich spürte, dass ich aus meiner Trance erwacht war …
Zitternd, schweißgebadet brachte ich die rituellen Worte über die Lippen: »Ich habe etwas zu sagen …«
Ich fühlte, wie meine Fesseln gelöst wurden. Etsu und Hana halfen mir, mich aufzurichten und hinzuknien. Meine Augen, die zu lange dem Glanz der Sonne ausgesetzt gewesen waren, tränten und brannten wie Feuer. Ich ließ meine Blicke über das Meer schweifen. Meine Lider flatterten, ein milchiger Schleier schien an meinen Pupillen zu haften. Doch langsam kehrte mein Sehvermögen zurück. Ich erblickte den dreieckigen Felsen, fast frei stehend unweit der Uferklippen, sah den weißen Schaum, der die rasiermesserscharfen Zacken umspülte.
Ich streckte die Hand aus und flüsterte: »Das Sternenschwert befindet sich am Fuß dieses Felsens. Ich werde jetzt tauchen und es aus dem Wasser holen.«
Etsu richtete sich auf. Sie verneigte sich vor dem König und wiederholte laut meine Worte. Ein Stimmengewirr erhob sich aus den Reihen der Krieger. Iri hatte sich nicht gerührt. Seine schimmernden Augen waren ausdruckslos auf mich gerichtet.