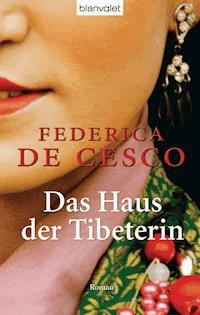5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur widerwillig gibt das Meer der Erinnerungen sorgsam gehütete Geheimnisse frei ...
Exquisit verwebt Bestsellerautorin Federica de Cesco dramatische Spannung mit betörender Sinnlichkeit. Ein Zauber, dem ihre Leser schon seit langem verfallen sind!
Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Beata Sforza, die als Meeresbiologin das rote Meer und den Pazifik erforschte, wieder zurück nach Malta, in das elegante Haus ihres vereinsamten Vaters, in dem die Schatten der Vergangenheit leise zu flüstern scheinen. Diesmal ist sie nicht der einzige Gast – nach langen Jahren schweigender Abwesenheit ist auch ihre Großtante Francesca heimgekehrt.
Als Beata von Francesca einen Schal aus kostbarer Muschelseide entgegennimmt, ist ihre Neugier geweckt. Sie ahnt, dass das tragische Schicksal ihrer Großmutter Cecilia damit verwoben ist. Doch Francesca hütet Cecilias Tagebuch wie ihren Augapfel. Beata begeistert sich spontan für das einzigartige Seidengewebe, das in den Tiefen des Meeres nur noch selten aufzuspüren ist. Ihre Leidenschaft als Forscherin ist geweckt. Mit Kazuo, einem japanischen Journalisten, begibt sie sich auf die Suche nach den seltenen Muscheln. Doch nur widerwillig gibt das Meer der Erinnerungen seine sorgsam verborgenen Geheimnisse frei. Und Beata erkennt, dass der Zauber der Muschelseide bis heute – und bis nach Japan wirkt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
FEDERICA DE CESCOMuschelseide
FEDERICA DE CESCO
Muschelseide
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
Verlagsgruppe Random House Fsc-DEu-0100
1. AuflageCopyright © 2007 by Blanvalet Verlag,in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.ISBN 978-3-641-01219-9V003
www.blanvalet.de
Für die beiden MeeresfrauenBeata Abela, Malta,Suma Noji, Tokyo,...und wie immer:für Kazuyuki.
»Sollte meine Stimme in eurem Ohr verklingenund meine Liebe eurer Erinnerung entschwinden,dann werde ich wiederkommen.«
KHAIL GIBRAN, »Der Prophet«
Prolog
Wenn es wahr ist, dass die Göttin einst Maltas Inselwelt formte, dann kann es nicht sein, dass sie plötzlich verschwunden ist. Die Göttin ist immer da, sie hat viele Gesichter. Dabei sind die Bildwerke der Menschen nur ein verhüllendes Kleid und geben der Fantasie viel Spielraum. Die urtümliche Kraft zeigt sich in jeder Darstellung, wir erkennen sie wie durch Glas oder auch wie durch Wasser. Die Madonna von Marfa war die Schutzpatronin des Meeres, das ihr innewohnende Herz. Sie war in ungefähr achtzehn Metern Tiefe in einer Grotte angebracht und mit Plastikblumen geschmückt, als gebe es das Bestreben, möglichst viel Materie zu zeigen, um die Erscheinung den Menschen vertrauter zu machen. Kitsch stammt aus der realen Welt, er störte mich nicht. Und der Tauchgang war problemlos. Ich schwamm in einer Art riesiger Badewanne, bis ich eine senkrecht abfallende Steinwand erreichte. Hier ließ ich mich gemächlich fallen, immer am Felsen entlang. Die Klippen stiegen dunkel und geheimnisvoll empor, blasse Seeanemonen klebten an den Steinen. Vor der Statue, die bald in Sicht kam, flitzten silbrige Fischchen hin und her. Ich näherte mich ihr in jener Art schwebender Glückseligkeit, die unter Umständen gefährlich sein konnte. Die Luftblasen, die ich auslöste, gurgelten in meinen Ohren. Die Felsen waren von unterschiedlichem Schwarz und teilten sich in ein Gewirr von Spalten. Wie ein Traumbild trat die Steingestalt aus der Grotte hervor. Ein paar Beinschläge brachten mich näher an sie heran. Die Figur war nicht sehr groß. Ein Bein war leicht angezogen, wie es bei Darstellungen der Madonna oft vorkommt, sodass es eine schöne Linie bildete. Plankton und Mikroorganismen verwandeln Gegenstände unter Wasser, und auch die Plastikblumen verloren so jede Farbe. Die Form der Hände war plump, das geneigte Profil kaum zu erkennen, doch mir schien, dass ihre Lippen ein Lächeln andeuteten. Ich bremste meinen Schwung und sprach zu ihr im Geist das erste, was mir in den Sinn kam: »Heilige Maria, mach, dass Francesca mir nichts nachträgt!«
Später würde ich vielleicht herausfinden, welche diffusen Befürchtungen und Vorstellungen die lautlosen Worte ausdrückten. Jetzt aber tauchte ich rasch durch die schmale, nur wenige Meter lange »Grotte des Zackenbarsches «, wo ich den Ausgang bereits als hellen Fleck wahrnahm. Ich schwamm zielstrebig und kraftvoll, ließ mich auch nicht von dem Schatten ablenken, der seitwärts über den Felsen hinweg zog. Wie ein flatternder Mantel, der sich im Wasser blähte und eine senkrecht stehende Lichtsäule erzeugte. Das bronzene Haar, das dabei empor wirbelte, mochte eine Sandwolke sein, von der Strömung getragen. Illusionen unter Wasser sind gefährlich. Zu wem gehörte dieses Profil, das heranschwebte, sich leicht verdrehte und ein glänzendes Auge zeigte, das vorüber glitt? Wo hatte ich dieses Antlitz, das sich nun wieder zurückzog, schon gesehen, und nicht nur einmal im Leben? Ich nahm die Erscheinung so hin, wie sie war, eine Woge aus geschmeidiger Bewegung, die sich im Dunkel der Tiefe mit langsamer Drehung auflöste. Der Mensch muss verrückt sein, wenn er solchen Dingen Beachtung schenkt, und ich war nicht verrückt. Es sind Gestalten und Träume, die aus dem Meeresgrund wachsen. Unerklärlich treiben sie umher, gleiten auseinander, und fort. Erscheinungen dieser Art erzeugen keinen Schrecken, aber es ist nötig, sie mit Argwohn zu betrachten. Ich schwamm schnell daran vorüber, dem Sonnenlicht entgegen. Ich tauchte aus den Wellen, holte gierig Luft. Dann fiel ich, müde und entspannt, in das glitzernd aufspritzende Wasser zurück. Kleine Schaumbläschen platzten auf meiner Haut, und mein tiefes, stetiges Atemgeräusch erfüllte mich mit Behagen.
I. Kapitel
Im Mai kehrte Francesca aus New York zurück. Ich hatte sie nie gesehen, obwohl ich vor einigen Jahren einmal versucht hatte, sie zu treffen. Aber daraus war nichts geworden, und ich nahm es nicht tragisch. Wir hatten viele Verwandte, ich kannte längst nicht alle. Wie alt mochte Francesca jetzt sein? Neunzig, sagte mein Vater, und ich konnte es kaum glauben. Aber es stimmte. Sie hatte die Familie als Achtzehnjährige verlassen. Und seitdem war sie nie mehr nach Valletta gekommen.
»Aber warum denn nicht?«, fragte ich.
»Warum?«
Er erwiderte erstaunt meinen Blick, und ich nahm seine Verlegenheit wahr. Neuerdings wollte er, dass ich ihn Ricardo nannte. Wobei ich nicht wusste, ob es ein Zugeständnis an das Zeitgemäße war, das er im Grunde seines Herzens missbilligte, oder eine wehmütige Erinnerung an meine Mutter. Ricardo äußerte sich nicht dazu: Er liebte das Ungesagte, das Leise. Auch jetzt schüttelte er nur den Kopf und reichte mir Francescas Brief, der an diesem Morgen eingetroffen war, über den Tisch. Ich überflog die wenigen Zeilen. Die schwarze Tintenschrift war nachlässig, eher ein Gekritzel. Sie wolle kommen, schrieb sie, und dort sterben, wo sie geboren war. Wir sollten ihr ein Zimmer mit Bad bereit machen. Falls es inzwischen eines gäbe, sonst würde sie lieber ein Hotel beziehen. Moderner Komfort habe doch wohl auch in Valletta Einzug gehalten, oder etwa nicht? Der Ton war spröde, sarkastisch. Zwischen den Zeilen lag eine Anmaßung, die mir gefiel. Ich fand ihr Schreiben amüsant und, aus Familiensicht, sehr unkorrekt.
Badezimmer hatten wir inzwischen drei, auf jedem Stockwerk eines. Mutter hatte sie in ehemaligen Abstellkammern einbauen lassen. Die Kacheln unter den Füßen und die Toilettendeckel waren sogar im Sommer eiskalt. Wir behalfen uns mit elektrischen Öfchen. Ein Fortschritt allerdings, und besser als nichts.
Mutter war im vergangenen Oktober gestorben. Polyarthritis. Es lag bei ihr wohl in der Familie. Ein älterer Bruder hatte die gleiche Krankheit gehabt. Man hatte allzu lange unter sich und standesgemäß geheiratet, den Kindern fehlten die Abwehrkräfte. »Fin de race«, so nennen es die Franzosen. Und in der Nacht vor Mutters Begräbnis hatte Ricardo einen Hirnschlag erlitten. Eine schreckliche Nacht, die fürchterlichste meines Lebens. Wir mussten ohne ihn den Sarg in die Erde lassen. Vielleicht wollte er nicht dabei sein, oder er konnte ihre rasch entschwindende Gegenwart nicht ertragen, wollte sich mit ihr ins Dunkel fallen lassen. Jetzt ging es ihm besser. Ich sorgte dafür, dass er morgens und abends seine Tabletten nicht vergaß.
Ich legte Francescas Brief akkurat in den Umschlag zurück.
»Zimmer haben wir genug. Und Badezimmer auch. Warum hat sie uns nicht schon früher besucht?«
»Sie arbeitet viel«, antwortete er ausweichend. »Ihre Bilder haben Erfolg. Sie hat etliche Preise gewonnen.«
»Verheiratet?«
»Dreimal. Und dreimal geschieden.« Ricardo seufzte. »Kein Wunder, dass es sie nie nach Europa gezogen hat. Wir sind in diesen Dingen altmodisch.«
»Malta liegt doch nicht am Hintern der Welt«, erwiderte ich, wobei er leicht stutzte. Obwohl er mit zunehmendem Alter die Form weniger wichtig nahm, reagierte er auf schnodderige Redensarten empfindlich. Doch er ging nicht darauf ein und sagte lediglich:
»Sie hat offenbar vergessen, dass wir im Haus so viele Treppen haben. Vielleicht sollte ich es ihr schreiben?«
»Denkst du nicht, dass sie sich beleidigt fühlen könnte?« »Beleidigt? Warum denn beleidigt?«, fragte er.
Seine Verwunderung wirkte nicht gerade unecht, aber ich entdeckte in seiner Gegenfrage doch eine Betonung, die unverkennbar auf Besorgnis hinwies. Als ob ich etwas sagen könnte, das er nicht hören wollte.
»Na ja, sie könnte meinen, dass du sie nicht hier haben willst.«
Offenbar hatte ich den Nagel auf dem Kopf getroffen, denn er entgegnete:
»Warum bleibt sie nicht, wo sie ist, wenn sie Bescheid weiß?«
Draußen war es bereits warm, und wir aßen im »Sommerspeisesaal« mit Blick auf den Garten. Säulen aus Stuck, hellblau bemalt, Möbel im Empirestil und heitere Gemälde an den Wänden – die düsteren hingen ein Stockwerk höher. Der Tisch, an dem Vater und ich uns gegenüber saßen, war mit Silber und altem Porzellan gedeckt und für eine Großfamilie gemacht. Zwischen uns lag ein vier Meter langes Tischtuch mit Klöppelstickerei. Die Stuhllehnen wiesen geschnitzte Blumen und Traubendolden auf. Nach einer Weile erschien Domenica, wechselte die Teller, brachte gebratene Leber, geschmorte Kartoffeln und Spinat aus der Küche, die ein Stockwerk tiefer lag, auf silbernen Platten herein. Mein Vater hatte nichts dagegen, dass Domenica neuerdings Hosen trug. Ihre Beine waren kurz und kräftig, ihre Augen so grau wie ihr Haar. Sie lächelte warmherzig, machte mit den Lippen ihre summenden Geräusche. Domenica war sprachlich zurückgeblieben. Das Bändchen unter ihrer Zunge war zu kurz, die Gaumenmuskulatur verkümmert. Ihre Eltern, einfache Leute, hatten nicht gewusst, dass eine kleine Operation im Kindesalter das Zungenbändchen hätte lösen können.
Ich sagte ihr, dass wir uns selbst bedienen würden. Sie ging, und ich füllte Ricardos Teller, bevor ich das Schweigen brach.
»Ich würde mich eigentlich freuen, sie zu sehen. Wie alt warst du, als sie ging?«
»Das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich war noch klein, vier Jahre alt. «
»Erinnerst du dich an sie? «
»Ein wenig.«
»Ihre Mutter hieß Cecilia, nicht wahr?«
»Tante Cecilia habe ich nie gekannt. Sie starb 1917, als Francesca auf die Welt kam.«
»Ich finde das entsetzlich. So jung!«
»Jung aus deiner Sicht«, antwortete er. »Damals hatte eine Frau dieses Alters oft schon Kinder. Und manch eine starb im Kindbett. So war das eben.«
Sein Gehirn hatte keinen Schaden genommen, nur das leichte Zittern seiner Hände würde bleiben. Er begrüßte jeden mit Namen, verwechselte keinen. Er spielte Schach, sah fern, las Zeitungen in verschiedenen Sprachen. Dr. Lewis war sehr zufrieden mit ihm. Kürzlich hatte er zu mir gesagt:
»Es ist gut, dass Sie da sind. Spielen Sie eigentlich Tennis?« »Ziemlich schlecht, tut mir leid.«
»Das macht nichts. Sie sollten jetzt etwas Tennis mit ihm spielen. Er braucht frische Luft. Spaziergänge liebt er ja offenbar nicht.«
»Er hasst sie.«
»Frühmorgens, wenn es noch nicht zu warm ist, wäre es ideal. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, bei ihm zu bleiben?«
Ich hatte erwidert: »Nicht im Geringsten«, ohne das Gefühl zu haben, dass ich log.
Ich war die einzige Tochter, daran wurde ich hier immer wieder erinnert, auch wenn mein Beruf mir Freiräume bot. Sogar Affären waren heutzutage keine Schande mehr, die man züchtig verbarg; man redete nur wenig darüber. Heuchelei gehörte schon dazu. Über das, was mein Vater davon hielt, machte ich mir keine Illusionen. Ohnehin fuhr ich ja ständig in der Welt herum. Dann gab es noch Georges, meinen allzu cleveren Bruder, in maßgeschneiderte Anzüge und diskrete Krawatten eingezwängt. Er lebte mit seiner Frau Alice in London, war Bankkaufmann bei der Lloyds, steckte mitten in einer Karriere, so vielversprechend und steil, dass er daneben nur noch an das eine denken konnte, nämlich daran, wie man Söhne in die Welt setzt. Ihrer hatte er inzwischen drei. Schnatternde kleine Ungeheuer, trippelnd, strampelnd und schreiend, die meines Vaters Geduld gehörig auf die Probe stellten. Ich war froh, sie nicht um mich herum ertragen zu müssen.
Nun also Francesca. Weshalb gerade jetzt? Wir hatten ihr natürlich eine Anzeige geschickt, deswegen vielleicht. Viel Zeit blieb ihr ohnehin nicht mehr. Du lieber Himmel, sie war neunzig! Ich wusste nicht, woran es lag, dass sie sich derart abgeschottet hatte. Ich hatte mir selten Gedanken über sie gemacht. Sie lebte in den Staaten, und Punkt. Ich hatte auch Verwandte, die in Südafrika lebten.
Die Leber war zu hart gebraten. Ich schob sie an den Rand des Tellers und nahm mir vor, es Domenica zu sagen. Ricardo aß mit Widerwillen ein paar Bissen. Während wir lustlos Spinat und Kartoffeln verspeisten, blickte Francesca uns an. Genau genommen war es ihr Porträt, das auf uns hinab sah. Mir war bekannt, dass Francesca damals einen ihrer üblichen Skandale produziert hatte, als sie sich wie ein Filmstar porträtieren ließ, in rotem Bustierkleid, die Schultern nackt. Dazu trug sie Handschuhe, lang bis zum Ellbogen und ebenfalls rot, und hielt eine Zigarette. Ich fand das Bild schön, es drückte so viel Lebenskraft aus. Die nackten Schultern waren breit, der Hals war lang und graziös, und sie trug den Kopf sehr hoch. Das schwarze Haar war über der Stirn zu einer Art Rolle eingeschlagen, in der eine Spange steckte. Die Brauen waren über der Nase dicht zusammengewachsen, der Mund knallrot bemalt. Ich hatte selten ein Gesicht gesehen, das so viel Herausforderung und Kühnheit zeigte. Wie eine Piratin kam sie mir vor. Ich fühlte mich ihr auf einmal sehr nahe.
Sie musste sich in diesem Haus in der St. Dominik Street sehr fremd gefühlt haben. Sie hatte die Freiheit gewählt, lange bevor auch ich meinen eigenständigen Weg ging. Aber bei mir war alles ganz anders gewesen, ich hatte nicht für nichts und wieder nichts rebellieren müssen. Schon als Schulkind war ich mit Leidenschaft geschwommen, zuerst im Schwimmbecken meiner italienischen Großeltern, dann im Meer. Zwischen sechzehn und zwanzig, in dem Alter, in dem Jugendliche am kräftigsten sind, hatte ich an Wettschwimmen teilgenommen und Pokale gewonnen. Die Eltern sahen es gern. Sie fanden es auch gut, dass ich in Monaco Meeresbiologie studieren wollte. Aber statt wie es sich gehörte bei Verwandten zu wohnen, zog ich in eine WG, wo es laut und chaotisch und alles andere als brav zuging. Ich war im Internat von Nonnen erzogen worden, jetzt erprobte ich die große Freiheit. Die Eltern hielten betroffen durch, bis ich von allein zu Verstand kam. Ich beendete mein Studium; danach fing der Ernst des Lebens an.
Dass junge Forscher zunächst wenig verdienen, erfuhr ich bald am eigenen Leib. Meine Eltern fragten nie, brauchst du Geld? Ich wusste, dass ich auf sie zählen konnte, aber ich hätte sie nur darum gebeten, wenn ich ausgeraubt worden, schwer krank gewesen wäre oder in Gips gelegen hätte, und nichts von alldem traf ein. Ich gab vier Jahre lang Schwimmunterricht, arbeitete in einem Warenhaus in der Sportabteilung. Wir Malteser sind zäh. Hätten wir keine Willenskraft, wären wir jetzt Türken. Wir auf unseren Inseln verhalten uns, als dösten wir zwischen Kirchen und Denkmälern vor uns hin, aber der Eindruck täuscht. Zorn und Spott liegen uns mehr als Jammern und Hadern. Wir blicken auf eine zu harte Vergangenheit zurück, als dass wir uns – weil wir heutzutage wohlhabend sind – hätten unbehaglich fühlen können. Ricardos sanfte, höfliche Art zeigte nicht, dass er dem Johanniterorden angehörte, in dessen Verwaltung er eine bedeutende Rolle spielte. Ebenso selten sprach er von seinen Bankgeschäften, die er in den letzten Jahren ohnehin nur als Berater weiterführte.
Ich verkaufte also Badeanzüge, Schnorchel und Schwimmflossen, acht Stunden am Tag, in der Touristensaison auch sonntags, und lernte in der Freizeit Apnoetauchen. Was faszinierte mich daran? War es das Herantasten an die eigenen Grenzen, die sportliche Herausforderung, die Formen und Farben und Gelassenheit der Tiefe? Ich konnte es nicht sagen, es war eine Mischung von alldem. Ich lernte auch, wie man mit einer Unterwasserkamera umgeht, und konnte im Stab von Jean-Michel Cousteau mitwirken, als er einen Dokumentarfilm an der libanesischen Küste drehte. Ein unglaubliches, unverschämtes Glück: Jemand fiel aus, sie suchten Ersatz, und ich war gerade an der richtigen Stelle. Ein paar Jahre lang gehörte ich dann dazu. Wir waren ein Team von Archäologen, Biologen, Geologen und Zoologen, die auf Cousteaus Forschungsschiff die Weltmeere bereisten. Alle gut eingespielt, alle solidarisch. Daneben hatte ich im Freitauchen einige Rekorde gebrochen, war in die Schlagzeilen der Illustrierten gekommen. Auf diese Weise war »Azur«, ein internationaler Kosmetikkonzern, auf mich aufmerksam geworden. 1999, als Cousteau seine Ocean Future Society gründete, verließ ich ihn, weil Azur mir ein Exklusivangebot gemacht hatte. Der Konzern stellte Hightechkosmetik auf der Basis von Mineralstoffkonzentraten her, die aus gewissen Algen gewonnen wurden. Da die marine Welt beträchtlichen Schaden genommen hatte, bestand meine Aufgabe darin, nach jenen Algen zu forschen, die die kostbaren Spurenelemente noch enthielten. Darüber hinaus entsprach ich als sportliche junge Frau dem »Image« der Marke und wurde auch bei Werbefotos für Sonnenschutz und Selbstbräuner eingesetzt. Nachdem ich etliche Jahre von der Hand in den Mund gelebt hatte, genoss ich den Luxusjob. Der europäische Sitz des Konzerns befand sich in Hamburg.
Als ich mir nach einigen Jahren eine Wohnung leisten konnte, wählte ich die Schweiz, vorwiegend ihrer guten Flugverbindungen wegen. Ich kaufte ein Loft in Zürich, geräumig, transparent und minimalistisch. Ohne Teppiche und ohne Gemälde, weder heitere noch düstere. Die Eltern erschraken ein wenig vor dem Kubus, meinten jedoch, dass ich mein Geld gut angelegt hätte. Inzwischen tauchte ich im Roten Meer, in der Karibik, in den Gewässern von Okinawa und Hawaii und auch im Amazonas-Delta. Neugier und Begeisterung erfüllten mich, ich hatte Zeit zum Bewundern, Zeit auch, mich zu fürchten, das gehörte dazu. Ich sammelte Erfahrungen und Erlebnisse, Erinnerungen und Bilder für eine Zukunft, von der ich nicht wusste, wann sie beginnen würde, bis sie mir unvermittelt hautnah kam. Da gab ich vieles auf, aber nicht alles.
Mein Vater hatte bemerkt, dass ich Francescas Porträt betrachtete, und nickte mir zu.
»Sie war sehr ungestüm. Lavinia und sie hatten immer Streit.«
Lavinia, Ricardos ältere Schwester, war Musiklehrerin gewesen. Sie hatte Generationen von Schülern die Freude am Gesang genommen und zwei Verlobte in die Flucht geschlagen. Vor drei Jahren war sie ledig – aber nicht jungfräulich – verstorben, und alle fühlten sich wohler.
Ich sagte:
»Wer vertrug sich schon mit Tante Lavinia? So großkotzig, wie sie war.«
Dass die Eltern 1953 zur Krönung Elisabeths II. nach London gereist waren, hatte sie mir jedes Mal unter die Nase gerieben, wenn ich nicht gehorchte. Mir, dem ungezogenen Mädchen, würde Ihre Majestät nie eine Einladung schicken. Weil mir Ihre Majestät schnurz war, zerrte mich Lavinia an den Haaren, was sehr weh tat. Sie sperrte mich auch in die Besenkammer, wo ich die Tür mit Fußtritten traktierte und fürchterlich schrie.
»Sie war nicht ... wie du sagst«, Ricardo räusperte sich. »Sie war nur konsequent. Und Francesca trug viel Unruhe im Blut.« »Ich doch auch.«
»Du nicht, nein. Du warst immer vernünftig.«
Was er sagte, klang sehr überzeugt. Ich bewunderte seine Fähigkeit, die schlaflosen Nächte zu vergessen, die ich ihm beschert hatte. Ich ließ ihn seine Erdbeeren essen und enthielt mich jeder Zwischenfrage, weil ich nicht wollte, dass er, wie so oft, die Unterhaltung abrupt beendete. Das bisschen, was ich von Francesca wusste, machte mich zunehmend neugierig.
Zum Kaffee setzten wir uns in den Wintergarten. Je nach Temperatur, Wind und Licht war es hier sehr angenehm. Ricardo hatte immer eine blasse Gesichtsfarbe gehabt; jetzt zeigte das helle Licht, wie alt und fahl seine Haut schon war. Immerhin hielt er Maß im Essen, sodass er nicht zum Fettkloß geworden war wie seine Ahnen, deren Wohlstand noch am Körperumfang bemessen wurde. Im Raucherzimmer hing das Bild der kleinen, überfütterten Catharina. Sie war 1828 an Herzversagen gestorben. Dreizehn war sie nur geworden.
Ich schenkte Ricardo Kaffee ein. Er dankte mit freundlichem, zerstreutem Kopfnicken. Ich sagte:
»Vor zwei Jahren, als ich in New York war, habe ich bei Francesca angerufen. Ich sprach mit einem Mann, der mir sagte, dass sie in ihrem Atelier in Merrywood sei. Er gab mir ihre Telefonnummer. Ich rief ein paar Mal an, aber sie nahm den Hörer nicht ab. Dann ging mein Flug, und aus dem Treffen wurde nichts.«
»Schade«, erwiderte er unverbindlich. »Sie hätte sich gewiss gefreut, dich zu sehen.«
»Ach, ich weiß nicht. Sie hatte ja meine Handynummer. Aber sie hat nie zurückgerufen.«
Eine verpasste Gelegenheit, wie es oft vorkommt. Im Nachhinein tat es mir leid. Immerhin mochte Francesca ihre Gründe haben.
»Sie hat auch Marina kein einziges Mal getroffen. Für sie sind wir weit weg und einfach nur langweilig.« Ricardo schaute durch mich hindurch, bis ich wieder kribbelig wurde.
»Langweilig?«
Er nickte unbestimmt.
Einmal las ich ein Interview mit ihr in der Vogue.« »Ach ja? Wann war das?«
»Vor zwei Jahren oder so. Sie führt ein interessantes Leben, und hier in Valletta ist ja kaum etwas los ... «
»Ricardo, das sollte ihr inzwischen egal sein. Sie ist neunzig!«
»Auf den Bildern in der Vogue sah sie noch recht gut aus.
Du hast zumindest eine Beschäftigung, die dir Abwechslung bringt. Aber Francesca! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich bei uns wohl fühlen würde ...«
Es war, als redete er mit vollem Mund. Früher war mein Vater ein unterhaltsamer Mann gewesen, der sich über sich selbst und unsere Familie sehr geistreich äußerte. Wo war seit Mutters Tod der Humor geblieben? Er nahm an nichts mehr teil oder allenfalls oberflächlich. Er machte auch mit mir keine Ausnahme. Seine hellen Augen registrierten mein Gesicht und nahmen gleichzeitig die Abwesenheit Francescas zur Kenntnis. Ich kannte Ricardo und spürte instinktiv, dass er sie nicht hier haben wollte. Seiner Natur nach war er konservativ, mit dem ganzen Ballast, der dazugehörte. Hinter seinem unaufrichtigen Schweigen lag verkrustete Abwehr, Bestürzung und gleichzeitig auch unterschwellig so etwas wie ein Ertapptsein. Er fürchtete Erklärungen; offenbar hatte er für das, was er sagen konnte oder wollte, noch keine fertige Fassung. War es eine Schwäche in seinen Augen, sich gehen zu lassen? Ich machte den nächsten Anlauf, mit ihm zu reden, und ließ es bleiben, als er den Kopf von mir weg drehte.
»Sei mir nicht böse, Beata. Ich bin müde.«
Die Form wurde gewahrt oder zumindest der Anschein. Er war wahrhaftig müde, eine Nachwirkung der Medikamente. Heute Abend Tennis spielen? Nein, ihm stand nicht der Sinn danach. Ich wurde ungeduldig, nach dem Essen musste ich Bewegung haben. Ich sagte, er sollte sich ausruhen. Er bewegte schlaff die Hand, rutschte leicht nach vorn und blieb, schwerfällig ein- und ausatmend, in dieser Stellung sitzen. Seine Augenbrauen zuckten, er lebte sein Leben hinter wässrigen Augäpfeln. Kranke Menschen ziehen sich nach innen zurück, in die Gefangenschaft der eigenen Heimlichkeiten. Nichts wie raus, dachte ich, er deprimiert mich. Ich ließ ihn in der gläsernen Helle dösen, mit Gedanken, die gewiss unerfreulich waren. Francesca?
2. Kapitel
Ich stieg die ausladende Treppe aus rötlich geädertem Marmor hinauf, ging durch das blaue Zimmer, das rote Zimmer, das grüne Zimmer, so benannt nach Vorhängen und Tapeten. Ich ging auf Teppichen unter Kronleuchtern mit Glasbehang, kam an Bücher- und Spiegelwänden vorbei, an Sofas und Lehnsesseln. An Tischen, großen und kleinen, mit Marmorplatten oder Einlagen aus Perlmutt, an Kredenzen und Vitrinen voller Nippes und alten Fotos. Im blauen Zimmer stand der indische Schrank, riesig und gespenstisch verschnörkelt; im roten der chinesische Schrank, schwarzer Lack mit goldenen Bäumen, Wolken und Drachen. Den Konzertflügel im grünen Zimmer wagte nicht einmal meine Mutter anzurühren. Sie spielte nur Gitarre, dafür aber gut.
An den Wänden hingen Ölgemälde, grell beleuchtet oder halb verschwunden in der Dämmerung. Kopien der spanischen oder italienischen Schule, schwermütige Gefühlsergüsse von anno dazumal. Zur Rechten der heilige Sebastian, Schutzpatron der Schwulen, mit Blut bemalt und elegant verrenkt. Zur Linken die heilige Agatha, unerbittlich lächelnd ihre abgeschnittenen Brüste vorweisend. Neben ihr der heilige Petrus, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Etwas weiter Jesus im Olivengarten, Jesus mit der Dornenkrone, Jesus am Kreuz und Jesus im Grab. Als Nächstes die Jungfrau, blond gelockt und dümmlich-verklärt, mit ihrem fetten Kind auf dem Schoß. Des Weiteren der große Sieg von 1565 gegen Suleyman den Prächtigen, der Beschuss von Sankt Elmo, die Schlacht von Birgo. Aufgewühlte Wellen, die Türkenköpfe – unlogischerweise alle noch mit Turbanen versehen – an Land spülten. Gleich gegenüber die Ahnen, mit ihren Geschichten von Heldentum, Krieg, Totschlag und Vergeltung. Grimmig blickende Ritter, hoch zu Ross oder stehend, das Schwert in der einen Hand, in der anderen die Ordensflagge, weißes Kreuz auf rotem Grund. Damen, jung und rosig oder mit Altfrauengesichtern, für den Ball oder den Kirchgang gekleidet. Wohlbeleibte Gentlemen aus der Zeit Königin Viktorias, mit gewaltigen Schnurr-, Backen und Vollbärten. Ferner eine Anzahl vergrößerter Schwarzweißaufnahmen: Valletta im Ersten Weltkrieg, Valletta im Zweiten Weltkrieg. Die Trümmer, die Flugzeuge, die Kanonen. Es gab Tage, an denen ich diese Ansammlung überhaupt nicht mehr wahrnahm, und andere, an denen sie mir ganz massiv jede Freude verdarben, ich mich bedrückt, überfordert und gequält fühlte.
Wie würde sich Francesca heutzutage wohl über das Sammelsurium äußern? Würde sie wie ich davon träumen, all die starrenden Augen mit einem spitzen Gegenstand zu durchbohren? Für mich ging eine Linie zurück zu Vorfahren, die ich nie geliebt hatte. Ihre Albträume waren nicht meine Albträume; ich hatte andere, die pragmatischer und womöglich vorbeugender waren. Diverse klinisch Verrückte in den Verästelungen unseres Stammbaums (als Fresko an die Wand der Bibliothek gemalt) bezeugten, dass Zerstörungswut allenthalben gesünder war als Verdrängung.
Unser Haus, La Casa degli Uccelli – das Vogelhaus – , lag mitten in der Stadt. Francescas Mutter Cecilia hatte noch erlebt, wie die weiblichen Familienmitglieder an Sonn- und Feiertagen im Salon beteten, wenn beim Gottesdienst die gewaltige Pforte der Marienkirche auf der anderen Seite der schmalen Straße offen stand und die Frauen, auf samtbezogenen Bänken vor dem Fenster kniend, dem Gottesdienst beiwohnen konnten, ohne das Haus zu verlassen. Der Gedanke an Cecilia brachte es mit sich, dass ich ein paar Treppenstufen höher stieg und ein Zimmer betrat, nicht sehr groß, aber sonnig, mit Blick in den Garten. Es wurde als Näh- und Bügelzimmer benutzt, aber Mutter hatte es immer als »Francescas Zimmer« bezeichnet.
Der Parkettboden quietschte unter dem abgenutzten Teppich. Schrank und Kommode waren in schnörkellosem Jugendstil gehalten. Ein weißes Tuch schützte die alte Singer-Nähmaschine vor Staub, daneben stand ein Wäschekorb aus Plastik. Auf dem Bett mit der hellen Sommerdecke stapelten sich frisch gewaschene Handtücher. Über dem Kopfende hing ein frommes Bild, die Muttergottes mit dem Jesuskind. Ein alter Stich, mit den Augen der Romantik nachempfunden, kitschig, aber nicht beängstigend. An den Wänden sah ich Aquarelle in einfachen Rahmen. Eine aggressive Irisblüte, geschwungen wie ein Dolch, zwei kämpfende Ratten, Wespen auf einer faulen Birne. Alle trugen die Signatur F. S. R.: Francesca Sforza-Richards. Die Aquarelle, schrill koloriert, zwischen Phantasie und hartem Realismus, beunruhigten. Als ob die junge Künstlerin den Betrachter herausforderte. »Ich weiß, dass ich gut male, aber die Bilder sollen nicht schön sein.«
Tatsächlich zielten die Aquarelle auf Konfrontation, vermittelten einen Eindruck von Verwundbarkeit und Zorn. Als ich langsam im Zimmer umherging, bemerkte ich ein Foto in einem silbernen Rahmen. Fotos standen bei uns in allen Zimmern, auf den Kaminsimsen, auf den Schreibtischen, in allen Sitzecken. Die Großeltern, die Eltern und Geschwister, die Verwandten, die Gäste, die Erzieher, die Dienstboten auch. Alte Reiseerinnerungen, neue Ferienaufnahmen. Die Fotos gehörten dazu, sie waren einfach da, alltäglich und von mir unbeachtet. Aber dieses Bild auf dem Nachttisch zog meine Blicke an. Ich trat näher, nahm es behutsam in die Hand. Es zeigte ein Mädchen, dreizehn oder vierzehn Jahre alt, in einem weißen Kleid mit Matrosenkragen. Sie hatte üppige, dunkle Locken und trug ein ebenfalls weißes Band im Haar. In der Hand hielt sie einen Tennisschläger. Cecilia, dachte ich. Es gab noch andere Bilder von ihr, Gruppenaufnahmen, wo sie bloß ein Gesicht unter vielen war. Auf diesem Bild war sie deutlich zu sehen. Der Blick war eigensinnig, scharf. Der Wille, der ihr zartes Gesicht verhärtete und nahezu versteinerte, gab ihr einen Ausdruck, den meine Eltern wohl als altklug bezeichnet hätten. Beata, sei nicht altklug, hatte ich oft zu hören bekommen, wenn ich zu argumentieren begann. Und gleichzeitig war es ein liebenswertes Gesicht, unbefangen und schelmisch. Menschen auf alten Fotos merkt man stets an, dass sie einer anderen Zeit angehören, dass sie unwiderruflich diese Welt verlassen haben. Was war die Unsterblichkeit anderes als die Fähigkeit, in die Zukunft zu springen, hoch über die Köpfe der Nachkommen hinweg – platsch! – wie ein Schwimmer ins Wasser? Ich lächelte vor mich hin, als sei ich hinter einen geheimen Sinn gekommen. Nur, wenn die Kraft des Geistes sie nicht in den Raum hebt, bindet der Tod die Menschen an die Erde. Francescas Mutter war vor neunzig Jahren gestorben und vermittelte den Eindruck, als könnte sie gleich aus dem Rahmen steigen, ihr Kleid glatt streichen, die Locken schütteln und mir zulächeln.
»Ich war eine Zeit lang fort. Da bin ich wieder!«
Möglicherweise hatte ich sie sogar gesehen. Nein, rief ich mich fast augenblicklich zur Vernunft, hör gefälligst auf, dir das einzubilden! Wobei ich mich gleichzeitig wunderte, dass ich so wenig von ihr wusste. Weil ich zuvor mit anderem beschäftigt gewesen war, bloß deswegen? Wer war ihr Mann? Warum war von ihm niemals die Rede gewesen? War er im Krieg gefallen? Hatte er Cecilia verlassen oder sie ihn? War zwischen ihnen etwas vorgefallen? Wenn ja, was? Scheidungen kamen ja damals nicht in Frage. Der Mann ging zu den Huren. (Und später zu den Striptease-Tänzerinnen.) Die Frau, je nach Veranlagung, betete oder nahm sich einen Liebhaber. Nur Gott in seiner Milde und der Beichtvater als geistiger Tröster wussten Bescheid, und beide hielten den Mund. War womöglich Francesca, wie man damals sagte, mit dem »Makel der Unehelichkeit« geboren worden? Unsere bigotte Familie musste sauertöpfisch bestrebt gewesen sein, das Missgeschick zu vertuschen. Ricardos zugeknöpftes Verhalten ließ auf alte Hemmungen schließen, auf ein in Fleisch und Blut übergegangenes Redeverbot, auch wenn Sitte und Standeskodex ihren Griff längst gelockert hatten.
Arme Cecilia! Sie war hundert Jahre zu früh zur Welt gekommen. Aber, sprach ich im Geist zu ihr, vielleicht hast du dein kurzes Leben gelebt, wie du wolltest?
Du siehst wirklich nicht aus wie eine, die sich unterkriegen lässt, stellte ich anerkennend fest, als ein Lichtreflex auf das Glas fiel. Das Gesicht veränderte sich nicht, aber mir war, als ob in den dunklen Augen ein Leuchten geboren wurde. Von wer weiß woher erreichte mich ein Klang, eine Art fernes, ersticktes Gelächter. Es hörte sich hübsch an, dieser Ton, als ob man kleine Muscheln schüttelte. Es musste von draußen kommen, von der Straße. Aber unter dem Fenster lag nur der Garten, und die Mauern waren hoch. Immerhin standen alle Fenster offen; vielleicht kam das Gelächter aus einem benachbarten Haus.
Während ich das Bild betrachtete, fühlte ich seine harte Beschaffenheit, den versilberten Rahmen, das Glas. Aber dahinter war etwas, das zu vibrieren schien. Natürlich bildete ich mir das nur ein, aber mir war plötzlich, als erhielte ich einen Schlag in die Magengrube. Eine Erinnerung stieg in mir empor. Sie war in einzelne Stücke zerfallen und hatte mit meiner Mutter zu tun. Ich mühte mich, diese Stücke schön auseinanderzuhalten, weil mir einzig die Trennung half, den Schreck von damals zu vergessen.
»Schluss jetzt, Beata! Du bist wirklich ein ganz dummes, emotionales Schaf!«
Ungeschickt stellte ich das Bild zurück an seinen Platz, ging eilig aus dem Zimmer und schloss die Tür. Mir schien, dass ich viel Lärm dabei machte, und mein Vater sollte seinen Mittagsschlaf halten. Für gewöhnlich wurde mein Privatleben von Bewegungsdrang geprägt und nicht von Neurosen. Ob man Gespenster sah oder nicht, mag von der Verdauung abhängen. Außerdem neigte ich zu Speck an den Hüften.
In meinem Zimmer steckte ich mein Haar hoch, stopfte ein paar Sachen in eine Sporttasche. Ein paar Minuten später verließ ich das Haus im Laufschritt.
Valletta döste in der Mittagsglut, alle Kirchenglocken schwiegen, die ockerfarbenen Sandsteine saugten Helle auf. Vor den Restaurants und Espressobars, zwischen Licht und Leuten, warfen dunkelrote Sonnenschirme Schatten auf erhitzte Gesichter. Ich ging schnell, ließ die Fußgängerzone hinter mir. In der Saint Johns Street, unweit des Busbahnhofs, holte ich meinen Wagen aus der Garage und fuhr nach Marfa.
Weil die Straßen in der Mittagszeit wenig befahren waren, erreichte ich Marfa-Ridge in knapp einer Stunde. In Marfa hatte ich schon als Kind getaucht, und eigentlich kannte ich das Gebiet viel zu gut, aber es war bereits Nachmittag, zu spät für einen längeren Ausflug. Und weil Francesca bald in mein Leben treten würde, wollte ich – gewissermaßen als Beschwörung – der Madonna von Marfa einen Gruß darbringen. Francescas Brief war der einer Frau, die mit neunzig noch unsentimental, herb und voll wilden Lebens war. Kein Wunder, dass mein Vater sich vor ihr fürchtete, dass er ihr am liebsten geschrieben hätte, sie solle bleiben, wo sie war. Aber er würde es nicht tun. Er überließ sich seiner Apathie, genoss sie sogar, jetzt, da ich alles für ihn erledigte und er einfach nur dasitzen konnte. Na gut. Ich ließ ihm vieles durchgehen, weil er gelitten hatte. Aber mit Francesca war es doch anders. Die Vorstellung, dass ich bald eine Frau treffen würde, die zwar zur Familie gehörte, die ich aber zeitlebens nie gesehen hatte, war mir zwar unbehaglich, wie ich feststellte, unbehaglich auch die Frage, was ich mit ihr würde reden können; jedoch erkannte ich gleichzeitig, dass ich mich gerade auf diese Ungewissheit freute. Mit Francesca wollte ich mich nicht auf ein Kräftemessen einlassen, sondern sie stattdessen als Verbündete gewinnen.
Tauchanzug, Maske, Schnorchel und gut gepflegte Flossen hatte ich immer im Wagen dabei. Dazu einige DIN-Pressluftflaschen, eine handliche Unterwasserlampe sowie den unentbehrlichen Adapter. Die Ausrüstung war minimal, aber im Moment benötigte ich keine komplizierte.
Ich parkte neben dem Bootshaus, nahm Flossen und Maske und suchte die richtige Stelle. Inzwischen war es fast vier, aber die Sonne stand hoch. Außer einigen Touristen, die ihre Haut der Sonne aussetzten, bis sie aufgedunsen und rot war, sah ich nur wenige Leute. Ich zog mein T-Shirt über den Kopf. Unter den Jeans trug ich nur ein Bikinihöschen, sodass ich bequem in den Taucheranzug schlüpfen konnte, ein Shorty mit elastischen Halsbündchen, den ich für gewöhnlich beim Training im Schwimmbad trug. Die Maske war schon abgenutzt und dadurch erst richtig bequem. Auch die Flossen waren bereits leicht verformt. Unbeholfen stapfte ich über den Sandstein, setzte mich mit gekreuzten Beinen und möglichst aufrechtem Rücken in den Schatten. Das Wasser schimmerte in allen Farben wie in einem Aquarium. Und jenseits der Riffe war das tiefe Blau der Hochsee, auf das ich nun meine Augen richtete, während ich einige Minuten lang die Brust-, Bauch- und Lungenspitzenatmung übte. Dann ließ ich mich in das kühle, glitzernde Nass gleiten. Ich füllte meine Lungen mit Luft und schoss los. Meine Spezialdisziplin war das Streckentauchen, die sogenannte dynamische Apnoe, die es ermöglichte, unter Wasser eine große Distanz zurückzulegen. Ich benutzte dabei den Delfin-Beinschlag mit seinen synchronen Aufwärtsbewegungen, obwohl ich, im Gegensatz zu vielen Tauchern, mit der Monoflosse wenig anfangen konnte. Sie gab mir das Gefühl, eingeschnürt zu sein, ich hasste das. Ich schwamm abwechselnd mit nach vorn gestreckten Armen, die Hände übereinandergelegt, oder hielt sie entspannt am gestreckten Körper, um keinen unnötigen Wasserwiderstand zu erzeugen. Ich hatte ziemlich lange gebraucht, bis ich in der Lage war, die ganze Kraft aus den Hüften aufzubringen, ohne dass der Oberkörper dabei einknickte. Jetzt hatte ich den Dreh gut raus, und als ich tiefer ging, war ich recht glücklich und entspannt.
Drei Minuten später kam ich an die Oberfläche, atemlos, aber nicht entkräftet. Eine kleine Welle wirbelte mich herum, und ich sah über mir den blauen Himmel. Was war es, was ich da unten gesehen hatte? Wasser ist unser Ursprung, aber nicht mehr unser Element. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, Trugbilder sind anderen Stoffs. Taucher sind oft von ihnen umgeben. Die geheimnisvolle Maschinerie unseres Gehirns entzündet, lenkt und steigert bisweilen seltsame Empfindungen und Gedanken. Erfahrung führt dann das rechte Maß zu den Dingen herbei, lässt nicht zu, dass wir uns in Irrgärten verlieren. Wer weiß, was mit dieser Erscheinung war? Und wenn ich es wüsste, was wäre damit erreicht? Nichts Besonderes, nichts Neues. Ich wollte mich jetzt lieber mit Francesca befassen. Eine Weile lag ich ruhig auf dem Wasser, atmete tief und entspannt, bevor ich mich herumwarf und der nahen Küste entgegen schwamm.
3. Kapitel
Sie trug Rot: Es war wie eine Kampfansage. Wir waren fast zu spät gekommen, weil ein stinkender Bus, prall gefüllt mit Touristen, die Straße versperrte. Ich fuhr, weil mein Vater seinen Führerschein abgegeben hatte. Das Flugzeug war schon gelandet. Die Abendsonne glühte, der Wind jagte Wolkenfetzen über den Himmel. Der Flughafen war klein und sehr übersichtlich. Wir standen im klimatisierten Warteraum, wo smarte Piloten und elegante Stewardessen eisgekühlte Cola und Orangensaft tranken. Es herrschte ein Kommen und Gehen von braungebrannten, lebensfrohen Menschen. Und mein Vater dagegen, wie farblos und still! Ich ging eilig voraus, er trottete hinterher, in seiner Einsamkeit gefangen. Sein Leben war leer, jeder konnte es sehen, aber niemand beachtete ihn.
Und dann kam Francesca, schob ihren Gepäckwagen selbst. Der erste Eindruck, den ich von ihr hatte, war, dass sie auffallend war, außergewöhnlich. Alte Menschen müssen entscheiden, ob sie gesehen werden wollen oder nicht. Mein Vater zog sich zurück, wurde unscheinbar, Francesca setzte ihre neunzig Jahre hochmütig in Szene. Sie war nicht sehr groß, mit dünnem Knochenbau, ohne Bauch, ohne Busen; eigentlich war sie mehr der Schatten einer Frau, aber ein Schatten, unruhig und leuchtend, wie von Feuer umgeben. Ihre linke Hüfte war verkrüppelt – die Arthrose! –, und sie zog das Bein leicht nach. Ihr schwarz gefärbtes Haar war im Nacken zu einem Knoten geschlungen; es war so stark nach hinten gezogen, dass ihre Stirn hervortrat und die hohen Wangenknochen sich wölbten. Wahrscheinlich hatte sie sich liften lassen, und nicht nur einmal. Ihre Haut war hell, der dünne Mund geranienrot geschminkt; die Wimpern waren getuscht, die schwarzen Augen mit Lidschatten betont. Der locker gestrickte Pullover, die weiten Hosen und sogar ihre High Heels, die bei jedem Schritt klapperten, waren in verschiedenen Rottönen gehalten. Ein Umhang, lässig um die Schulter gelegt, verbarg die entstellte Hüfte. Wir gingen ihr entgegen, ich voraus, meinen Vater im Schlepptau. Dann blieb ich stehen, während er mich überholte und die Ankommende steif umarmte. Francesca ließ es geschehen, wobei sie leicht das Gesicht von ihm fortdrehte und ihre schwarzen Augen auf mich gerichtet hielt.
»Du bist also Ricardo«, sagte sie mit einer Stimme, die rau und unverkennbar amerikanisch war. »Danke, dass du mich abholst.«
»Wie kommt es, dass du mich gleich erkannt hast?«, fragte mein Vater ein wenig verunsichert.
Ihre rot gefärbten Lippen zuckten.
»Wie sollte ich nicht? Die Sforza haben alle das gleiche Gesicht. Wenn du mich genau ansiehst ... sogar ich! « Sie zeigte kurz ihre Zähne, die zwar verfärbt, aber noch ihre eigenen waren. »Wie alt bist du jetzt eigentlich, Ricardo? «
»Vierundsiebzig«, sagte mein Vater. Es klang, als ob er sich entschuldigte. Sie nickte.
»Ja, das habe ich mir ausgerechnet.«
Ihr glitzernder Vogelblick starrte mich unentwegt an.
»Und wer bist du? Meine Großnichte, nehme ich an?«
»Meine jüngste Tochter, Beata«, stellte mich Ricardo vor, während ich ihr zulächelte. »Georges, mein Ältester, ist in London mit Alice verheiratet. Sie besuchen mich manchmal und bringen ihre Kinder mit. Ich bin inzwischen Großvater«, setzte er hinzu, als ob er keine richtige Lust hatte, zu sprechen.
»Du hast mir die Bilder geschickt«, erwiderte sie trocken. »Für Nachwuchs ist also gesorgt.«
Sie stand einfach vor mir und musterte mich von den Füßen bis zum Kopf, über ihren Blick konnte ich mir nicht klar werden. Sie betrachtete mich zwar interessiert und abschätzend, aber gleichzeitig auch mit Sympathie. Schließlich sagte sie:
»Du siehst wie meine Mutter aus.«
Darauf erwiderte ich nicht gleich etwas. Ich war überrascht und hatte Mühe, ihr zu sagen, weshalb.
»Aber das stimmt doch nicht«, meinte Ricardo.
Sie sah ihn an, flüchtig und gleichgültig.
»Wie willst du das beurteilen?«
Ich schluckte und sagte:
»Du meinst das kleine Mädchen im Tenniskleid, auf dem Bild in deinem Zimmer?«
Sie zog die Mundwinkel hoch wie ein Mensch, der lächelt, doch sie lächelte nicht.
»Als sie mich zur Welt brachte, war sie kein kleines Mädchen mehr.«
»Hast du noch andere Bilder von ihr?«
Sie überhörte die Frage. Das ärgerte mich. Ich war es nicht gewöhnt, dass man meine Fragen unbeantwortet ließ. Aus der Nähe gesehen, zeigte ihr Gesicht deutlich die Spuren des Alters: die Haut, blass vor Müdigkeit unter dem Wangenrouge, die spärlichen Brauen, schwarz nachgezogen, die spröden Lippen. Das Weiß ihrer Augen war ungewöhnlich gerötet. Ein goldschimmernder Schal, mit unbestimmtem Muster, war drei- oder viermal um ihren runzeligen Hals geschlungen. Wir gingen zum Wagen, und ich half ihr, das Gepäck einzuladen. Sie hatte recht schwere Koffer und eine Anzahl fest verschnürter Schachteln bei sich. Durch den Zoll war sie problemlos gekommen.
»Der Beamte hat in meinem Pass geblättert und mir einen guten Aufenthalt gewünscht, das war’s schon. Ein sympathischer Mann, groß gewachsen. Die Malteser sehen besser aus als früher.«
»Wir essen zu viel«, erwiderte ich, wobei sie mich ansah, als ob sie an meinem Humor zweifelte. Inzwischen half ich ihr in den Wagen. Sie war agil, viel agiler jedenfalls als mein Vater, der sich nur noch im Zeitlupentempo bewegte. Ich bot ihr den Vordersitz an, während Ricardo hinten Platz nahm.
»Wo werde ich wohnen?«, fragte sie, als ich den Schlüssel ins Zündschloss steckte.
» Domenica hat dein Zimmer hergerichtet.«
» Domenica? «
» Paolas Tochter.«
»Ach so. Und was ist aus Paola geworden?
»Sie ist schon lange tot.«
»Ach, die Toten«, murmelte Francesca. »Sie finden immer mehr Platz in meiner Erinnerung.«
Eine Frage des Alters nahm ich an. Im Gegensatz zu ihr hatte ich die Toten satt. Ich erzählte weiter.
» Domenica hat einen Sprachfehler. Das Zungenbändchen. Du wirst dich an sie gewöhnen müssen.«
»Ich gewöhne mich an alles«, sagte Francesca. »Konnte sie nicht operiert werden?«
»Ihre Familie hatte wohl nicht das Geld«, sagte Ricardo. »Und meine Eltern, du weißt ja, wie sie waren ...«
»Geizkragen, was denn sonst?« Sie zuckte mit den Schultern. »Hast du die Großeltern eigentlich gekannt?«, fragte sie mich.
Da waren sie wieder, die Toten.
»Großmutter lebte schon nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass Großvater zwei Doggen hatte. Parierten sie nicht aufs Wort, schlug er sie mit einer Peitsche. Sie krochen winselnd unter die Tische, ich schrie wie am Spieß, es war ziemlich abscheulich.«
»James hatte die Peitsche aus Rhodesien mitgebracht«, sagte Francesca kalt. »Sie war aus Rhinozerosleder und hing an der Armlehne seines Sessels. Stets griffbereit. James schlug nicht nur Hunde, das kann ich dir versichern. Das Leder war hart geworden von getrocknetem Blut.«
»Kaum bist du da, erzählst du deine Schauergeschichten«, seufzte Ricardo. Er redete ein wenig im Ton der Zurechtweisung. Sie sah ihn kurz im Rückspiegel an.
»Nein. Dazu fehlt mir die Phantasie. Was ist aus der Peitsche geworden, Ricardo? «
»Ich glaube, dass Marina sie weggeworfen hat«, erwiderte er unbehaglich.
Großvater James, der ein erbliches Ministeramt auf Lebenszeit bekleidet hatte, galt bei seinen Zeitgenossen als schlauer Politiker, manisch konservativ und zugeknöpft klerikal. 1962 hatte er an der neuen Verfassung mitgewirkt, die Malta zum unabhängigen Mitglied des Commonwealth of Nations erklärte. Die Proklamation der Republik Malta 1974 und die Kündigung des Truppenstationierungsvertrags mit Großbritannien hatte er voller Genugtuung erlebt, bevor sein Gehirn verkalkte.
Ich sagte zu Francesca:
»Er wurde fast hundert Jahre alt. Am Ende war er vollkommen gaga.«
»Er soll verflucht sein«, erwiderte sie. »Und tausend Jahre in der Hölle braten.«
Sie saß neben mir, kerzengerade, den Blick auf die beleuchteten Straßen und Bauwerke gerichtet. Es waren Fassaden aus verschiedenen Stilepochen, neu aufgebaut und harmonisch zusammengefügt. Francesca roch nach Zigaretten, nach irgend einem Parfüm auch, Ambra und Lebkuchen. Ein etwas aufdringlicher Duft, warm und geheimnisvoll und wie für sie gemacht.
»Ich kann mir kaum vorstellen«, meinte sie nach einer Weile, »dass im Krieg hier alles zerstört war. «
»Das kann keiner, der es nicht miterlebt hat. « Ricardo war sichtlich froh, dass das Gespräch eine andere Wendung nahm. »Der Wiederaufbau dauerte fast zehn Jahre. Die Briten gaben uns so viel Geld und präzise Bauvorstellungen, sodass wir sorgfältig vorgehen konnten. Hochhäuser wirst du hier kaum antreffen, und selbst bei Neubauten berücksichtigen wir die Tradition. «
Sie machte ein gleichgültiges Gesicht, aber sie hörte zu.
»Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass es euch nicht schlecht geht.«
Ricardo widersprach nicht.
»Wir haben noch Defizite in der Handelsbilanz, aber die Touristen bringen Devisen, und die Sache gleicht sich aus.« Ich sagte zu Francesca:
»Warum bist du nicht schon früher gekommen?«
Sie drehte leicht den Kopf zu mir hin.
»Glaubst du, ich wollte wieder in die Zange?«
Weil wir in der Fußgängerzone lebten und vor unserem Haus nur Zubringerdienst gestattet war, stellten wir die Koffer vor die Tür, bevor ich den Wagen in die Garage fuhr. Als ich zurückkam, war Domenica dabei, das Gepäck in die zweite Etage zu schleppen. Sie hatte Francesca umarmt und geküsst und schien glücklich, dass sie da war.
»Erstaunlich, wie rüstig sie noch ist«, sagte Francesca zu mir. »Und sie sieht doch recht gut aus. Warum hat sie nie einen Mann gefunden?«
»Wahrscheinlich hat sie nie einen gesucht«, sagte ich. »Schade. Eine stumme Frau muss manchen Männern doch gefallen.«
Ihre Augen waren ständig in Bewegung, als wollte sie jeden Gegenstand in diesem Haus, in dem sie einst gelebt hatte, mit den Blicken einfangen. Domenica hatte das Zimmer gelüftet, das Bett überzogen, die Näh- und Bügelmaschine entfernt. Sie war schon dabei, die Koffer auszupacken. Francesca brauchte sich um nichts zu kümmern. Domenica schien genau zu wissen, wo die Dinge hingehörten, wie die Kleider aufgehängt, die Pullover gefaltet werden mussten. Auch das Badezimmer war erleuchtet, die Ventilation summte, frische Handtücher hingen bereit. Francesca warf einen Blick in den schlauchartigen Raum und schüttelte den Kopf.
»Grüne Kacheln! Wer hat diese Farbe ausgesucht? Doch sicher Ricardo? «
Mir kam in Erinnerung, dass es tatsächlich stimmte.
»Ich bin für Grün«, hatte er damals gesagt. »Grün wie Wasser, das passt zu jedem Badezimmer.«
Meiner Mutter hätte Weiß besser gefallen. Sie meinte, dass sich keine Frau in einem grünen Badezimmer zurechtmachen konnte. Aber Ricardo hatte den Marmor schon bestellt. Eine Versteigerung, die Fliesen waren günstig zu haben.
»Geizig wie sein Vater«, zischte Francesca. »Marina wird ihn bald satt gehabt haben.«
Das war so falsch, dass ich es ihr sagen musste.
»Nein. Sie waren sehr glücklich miteinander. Und als meine Mutter starb, hatte Ricardo einen Schlaganfall.«
Sie wandte sich ab und sagte über ihre Schulter hinweg: »Kein Mann erträgt es, wenn die Frau zuerst geht. Und ich meine jetzt nicht nur in den Tod.«
Sie teilte ihre Hiebe aus, wie Großvater einst mit der Peitsche. Aber ich nahm ihr die Worte nicht übel, vielmehr spürte ich dahinter die Erinnerungen, die im Alter wiederkehrten und schmerzten.
Wir trafen uns eine Stunde später ein Stockwerk tiefer zum Abendessen. Ich bemerkte, dass Francesca sich neu geschminkt und ein anderes Kleid angezogen hatte, himbeerfarben, aus zerknitterter Rohseide. Sie trug noch den gleichen Schal, der im wechselnden Spiel des aufgefangenen Lichts nicht mehr golden, sondern grün-rosa schimmerte. Ihre Bewegungen waren jugendlich, graziös, ihr Gang jedoch unbeholfen. Früher oder später würden ihr die Treppen zu viel werden. Ich erzählte, dass meine Eltern vorhatten, einen Aufzug einzubauen, aber nichts daraus wurde, weil das Haus schon unter Denkmalschutz stand.
»Das Gegenteil hätte mich erstaunt.« Francesca sprach herablassend. »Tradition versus Fortschritt. Wie es hier ist, macht mich unruhig; hoffentlich komme ich ohne Schlafmittel aus. Zwanzig Zimmer voller Gespenster!«
»Gespenster?« Mein Vater hüstelte nervös. »Unter dem Banner des heiligen Johannes gibt es keine Gespenster.«
Sie standen sich Auge in Auge gegenüber, und Francesca lächelte grimmig.
»Der heilige Johannes, ach ja, der Spiegel aller Tugenden. Der mischte sich nie in meine persönlichen Angelegenheiten. New York war nicht sein Revier. Aber die Gespenster, die wurde ich erst los, als sie eines Tages husch, husch von selbst verschwanden. Ich dachte, die kommen nie wieder, aber sie sind noch hier. Ein ganz anständiger Topf voll, würde ich meinen...«
Ricardo rieb sich die Stirn.
»Ich kann dir nicht folgen, Francesca. Worüber redest du eigentlich?«
»Von Gespenstern. Hörst du sie nie klopfen und klirren und quietschen, als ob ein Ferkel schreit? Siehst du nicht, wie sie mit dem Blut und dem Schweiß aus jedem Gemälde tropfen? Hast du den Ahnen nie ins Gesicht gespuckt? Für mich war es ein ungeheures Vergnügen damals, ich war stets bemüht, es so gut wie möglich zu machen, bemüht, bis mir der Mund austrocknete...«
Ich hörte, was sie sagte, und empfand fast freundschaftlich für sie, weil sie das getan hatte. Ich wagte nicht, sie anzusehen, merkte aber wohl, dass ich zitterte. Die Luft war schwer, angefüllt durch Francescas Gegenwart. Ich merkte, wie Ricardo immer mehr in sich zusammensackte. Diese Frau glänzte, leuchtete so heftig, dass es wirklichen Schmerz bereitete, sie zu ertragen. Sie hielt eine Zigarettenspitze in der Hand und rauchte, obwohl ihr der Arzt – wie sie mir später gestand – das Rauchen verboten hatte.
»Hörst du eigentlich, was ich sage, Ricardo? « Sie blickte ihn unter ihren schwarzen Augenbrauen zornig an. »Sitzt du immer noch auf deinem hohen Ross? Bist du jemals glücklich gewesen in deinem wurmstichigen Panoptikum?«
»Ob ich jemals glücklich war? «, wiederholte mein Vater einfältig. Francescas Brutalität zerrte ihn aus seiner Verschlossenheit, zwang ihn zum Verzicht auf gewohnte Redewendungen, die das Denken vereinfachten, es brauchbar machten zur Selbstberuhigung.
»Als Marina noch lebte, war vieles anders ... «
Die Worte stiegen mühsam an die Oberfläche seines Bewusstseins, wurden ausgesprochen, um etwas zu ersticken, das er nicht wahrhaben wollte. Schwerfällig trat er auf das Barschränkchen zu, das im Hintergrund des Raumes stand.
»Whisky?«
Sie nickte kühl. Er machte sich an der Bar zu schaffen und reichte ihr das Getränk. Francesca näherte das Glas ihrer fein geformten Nase und atmete den Duft des Whiskys ein.
»Oh, der ist schön stark!«
»Auf dein Wohl«, sagte Ricardo.
Er war in eine Art Trance verfallen, dachte offenbar, sie würde ihn jetzt in Ruhe lassen, doch sie ließ nicht locker. »Ganz ehrlich, Ricardo, ich habe oft überlegt, wie du dich fühlen musst. Möglich, dass du dich im Haus nicht mehr zurechtfindest, oder?«
Mein Vater verzog krampfhaft den Mund.
»Ich kann nichts dazu sagen, entschuldige. Ich hatte noch keine Zeit, darüber nachzudenken.«
Francesca kam daher wie ein Erdbeben oder wie eine Springflut. Sie war nicht unbedingt ein ungebetener Gast, aber ihre Anwesenheit versetzte ihn in Schrecken. Er hatte sogar verlernt, wie man Cocktails mixt: Mein rosa Gin war viel zu stark. »Was tust du denn den ganzen Tag?«, konterte sie gehässig. »Ich ... ich ordne Papiere. Und ich lese und spiele Schach.« »Nun, ich hoffe, dass du mit deinem Leben zufrieden bist.« Ricardo trank Whisky mit viel Sodawasser, aber er trank ihn
schnell. Auf seinen Wangen zeigten sich bereits rote Flecken. »Vermutlich lebt man besser, wenn man auf etwas wartet...«
Auf Francescas Gesicht erschien ein doppeldeutiger Ausdruck von Mitgefühl und Bosheit.
»Und worauf wartest du, Ricardo? Nun sag es doch endlich! «
»Auf nichts«, antwortete er halblaut. »Die Familie ist unter der Erde oder in alle Winde verstreut. Willst du unser fin de règne als Zuschauerin erleben, bist du genau im richtigen Augenblick gekommen.«
Sie betrachtete ihn über ihr Glas hinweg.
»Tu nicht so gefühlsduselig, Ricardo! Und im Übrigen, hast du nicht drei Enkelkinder?«
»Vier«, verbesserte er sie, »es sind inzwischen vier.« »Na also! Worüber regst du dich auf?«
»Sie sind mir nicht ans Herz gewachsen«, erwiderte er mit einer Ehrlichkeit, die vielleicht vom Whisky herrührte. Ich war betroffen, doch Francesca zog nur die knochigen Schultern hoch.
»Tja, die Nachkommen entsprechen selten unserem Geschmack. «
Später setzten wir uns an die kostbar gedeckte, von Royal-Worcester-Porzellan und Altsilber glänzende Tafel. Domenica hatte für alles gesorgt, gewissenhaft und zeitlos. Vor Francesca standen in einer Kristallschale duftende Nelken, Anemonen und Pfingstrosen. Auf der Veranda im warmen Licht schwirrten ganze Geschwader von Nachtmotten, und im Garten schrillten nervenaufreibend die Zikaden. Francesca, die ihre Augen immer in Bewegung hatte, rief plötzlich:
»Das überrascht mich aber sehr!«
Sie deutete auf ihr Porträt, auf die schöne junge Frau mit den bloßen Schultern, den herausfordernden Blick. »Ich dachte, James hätte das Bild längst entfernt!«
»Wie?« Ricardo antwortete wie ein Mann, der mit seinen Gedanken ganz woanders ist. »Davon war eigentlich nie die Rede. Außerdem hatte mein Vater in den letzten Jahren ein schlechtes Gedächtnis.«
Sie lachte kurz und verächtlich auf.
»Dann hatte er auch vergessen, dass ihm sein schlechtes Gewissen in die Suppe guckte. Seniler Schwachsinn hat auch praktische Seiten. Schade! Ich hätte ihm gern den Appetit verdorben. «
Domenica hatte ein reichliches Abendessen gekocht, aber Francesca nahm von allem nur einige Bissen. Zeitverschiebung. Müdigkeit. Dafür trank sie recht viel Rotwein, und je mehr sie trank, desto gesprächiger wurde sie und erzählte, wie es bei alten Menschen oft vorkommt, von ihren Krankheiten. Sie litt unter Arthrose, Versteifungen in den Schultern, in den Hüften. Sie wollte sich nicht operieren lassen. Die Angst vor der Narkose, ja, das war es. Fiel bei ihr der Blutzuckerspiegel, wurde ihr schwindelig. Sie hatte auch Herzrhythmusstörungen. Ihr Sehvermögen war noch recht gut, sie benutzte nur eine Lesebrille. Bei Flugreisen platzten ihr Äderchen in den Augen; die Gefahr eines Schlaganfalls war nie ausgeschlossen. Ich war zunächst gelangweilt, merkte aber bald, dass sie nicht darauf aus war, zu lamentieren. Sie stellte uns lediglich vor eine Tatsache, die nicht rosig war: das Alter eben. Ricardo missverstand sie natürlich.
»Brauchst du einen Arzt? Ich kann dir Matthew Lewis empfehlen. Wir sind seit dreißig Jahren befreundet.«
Ihr Mund, der eigentlich nur ein roter Schlitz war, verzog sich.
»Er kann sich über mich hermachen, wenn es so weit ist, und mir den Abgang erleichtern. Bis dahin sterbe ich jeden Tag ein wenig, gemütlich, rational und ohne Tabletten.«
Das war doch zu viel für Ricardo. Seine müde Stimme klang plötzlich gereizt.
»Das sind Dinge, die man denken kann, aber nicht sagt. Wir haben schwere Zeiten durchgemacht, Lebensabschnitte, die betrüblich waren. Wir haben vielleicht ein klägliches Schauspiel geboten, das schon. Aber wir haben es akzeptiert.«
Da warf sie ihre Gabel hin und zischte wie eine Schlange.
»Auch ich habe schwere Zeiten durchgemacht. Und glaube mir, dass ich sie akzeptiert habe. Möglich ist nur, dass ich es künftig nicht mehr will!«
Sie hielt ihre Augen auf Ricardo gerichtet, während er, als ob er auf diese Worte gefasst gewesen war und sie längst befürchtet hatte, es sichtlich nicht wagte, ihr die Stirn zu bieten. Seine Züge verrieten ein Gefühl von Ohnmacht, Schuld und Kummer.
»Mach mir bitte keine Vorwürfe, Francesca«, sagte er leise. »Ich konnte ja nichts dafür.«
Sie holte tief Luft, entspannte sich wieder.
» Ich weiß. Und es tut mir leid, Ricardo. «
Die Worte klangen versöhnlich, doch nach wie vor funkelten ihre Augen unnachgiebig. Ich merkte, wie Ricardos vergebliche Ausflüchte sie immer wieder zu schroffen oder abwehrenden Erwiderungen zwangen. Was war damals geschehen?, fragte ich mich, während Stille eintrat, nur noch die Gabeln gegen das Porzellan klirrten und die Zikaden schrillten. Warum hatte Francesca die Familie verlassen? Bloß für die Selbstverwirklichung? Ach, Unsinn, dachte ich. Früher gab es das Wort ja noch gar nicht. Francesca war etwas Besonderes. Eine alte Frau, gewiss, aber das Feuer in ihr war noch nicht erloschen. Als sie jung war, musste sie immer bekommen haben, was sie wollte. Sie war auch noch heute schön, auf eine triumphale, eitle, zickige Art. Und sie meinte offenbar, dass, wenn sie mit neunzig nicht sagte, was sie zu sagen hatte, sie es niemals mehr sagen würde. Weil ich das richtig fand, hatte ich mich auch nicht eingemischt. Doch nun brach ich das Schweigen.
»Wann hast du aufgehört zu malen?«
Sie reckte die Schultern, betrachtete mich, obwohl kleiner gewachsen, auf gebieterische Art von oben herab.
»Aufgehört? Wie kommst du darauf?«
» Ich dachte, du seist zurückgekommen, weil du nicht mehr malen wolltest ... «, entgegnete ich wie ein dummes Schulmädchen.
»Da hast du danebengedacht«, sagte Francesca schroff.
Sie plante eine Ausstellung in Valletta, die letzte oder die vorletzte, ohne fixe Idee. In ihrem Alter, meinte sie, seien fixe Ideen geschmacklos. Sie hatte alles dabei, was sie zum Zeichnen, Malen und sonst noch brauchte. Eine Staffelei würde sich wohl noch auftreiben lassen, oder? Und irgendwo in diesem Haus würde es doch sicherlich einen Raum geben, den sie als Atelier nutzen konnte.
»Doch, im dritten Stockwerk«, beeilte ich mich zu sagen, um meine Scharte auszuwetzen. » Ein paar Zimmer sind voller Gerümpel. Dinge, die wir längst aus dem Haus schaffen sollten.«
»So? Im dritten Stockwerk?«, sagte sie zwischen den Zähnen. »Da waren schon früher Dinge, die man nicht im Haus haben wollte ... «
Ihr Ausdruck war eisig. Ich wurde allmählich ungehalten. Was hatte ich jetzt schon wieder Falsches gesagt?
»Also, wenn dir die Treppen zu hoch sind ... «
Sie winkte ab, griff nach ihrem Löffel. Sie hatte eine wundervolle Haltung bei Tisch und eine sehr elegante Art zu essen.
»Schon gut, ich werde mir die Zimmer ansehen. Auf die Treppen kommt es nicht an. Aber das Licht, das muss stimmen.«
Der Zitronenschaum, den Domenica gerade serviert hatte, war perfekt gelungen. Doch Ricardo starrte nur stumm auf seine Schale. Ich sah seine Hände zittern und dachte: Er hat genug getrunken. Er fürchtete Francescas Unberechenbarkeit, ihren völligen Mangel an Anpassung und Takt. Sie war eine anstrengende Frau. Noch schlimmer: Er fühlte sich von ihr ungeliebt.
Nach dem Portwein saßen wir nicht mehr lange bei Tisch, mein Vater und Francesca gähnten um die Wette. Der Frühlingsmond schien, und als ich auf die Veranda trat, um Luft zu schnappen, brachte der Wind den Duft der Orangenblüten und den salzigen Geruch des Meeres. Und plötzlich schien die Luft in Schwingungen zu geraten. Zehn Uhr! Sämtliche Kirchenglocken läuteten. Ich liebte die Glocken, ihr Dröhnen zwischen den Häusern, die akustischen Wogen hoch über den Dächern. Als langsam Stille eintrat, spürte ich eine Gegenwart neben mir, roch den Geruch nach Zigaretten, Ambra und Lebkuchen.
Francesca stand rauchend da, ich hatte sie nicht kommen hören. Im Licht, das aus der Fenstertür schien, schimmerte ihr Kleid rubinrot. Sie war eine Frau, die zerknitterte Rohseide zu tragen wusste, ohne dass der Stoff wie ein alter Vorhang baumelte.
»Komisch«, begann sie, »früher habe ich das Gebimmel gehasst.«
Sie stockte. Ich sah sie an, wartete. Kirchenglocken waren keine Luftwellen. Kirchenglocken riefen zum Gottesdienst. Ich machte mich auf die nächste bissige Bemerkung gefasst, doch sie sagte mit einem kleinen Seufzer:
»Heute kommt mir das alles vertraut vor. «
Die Nachtluft war kalt. Ich verschränkte fröstelnd die Arme. »Hattest du nicht manchmal Sehnsucht nach Valletta? « »Nein.« Francescas Antwort kam schnell und entschieden.
»Nur Sehnsucht nach anderen Orten.«
»Mir gefällt es hier eigentlich gut«, sagte ich in freundschaftlichem Tonfall.
Sie schlug eine Mücke tot.
»Dein Umfeld ist zweifellos grandios. Pass aber auf, dass du nicht verblödest.«
»Keine Angst. Inzwischen hat sich vieles geändert.« Sie rauchte in tiefen Zügen.
»Das kannst du nicht beurteilen. Du warst damals noch nicht auf der Welt.«
Ich nickte.
»Zum Glück habe ich die alte Scheiße nicht gekannt.«
Ein Schimmer von Belustigung trat in ihre Augen. Die dünnen Lippen zuckten.
»Dann wartest du also nicht auf einen Mann, wie das früher bei uns üblich war?«
Ich grinste sie an.
»Ganz bestimmt nicht, Tante Francesca. Ich bin Forscherin.«
Falls sie überrascht war, ließ sie es sich nicht anmerken. »Gefällt dir der Beruf?«, fragte sie ganz sachlich.
»Ich könnte mein Leben mit nichts anderem verbringen.« »Nun, das macht die Dinge einfacher für dich.«
»O ja«, sagte ich.
Sie rauchte wortlos, wobei sie in den dunklen Garten blickte. In ihrem Inneren musste eine tiefe Stille sein, die der Stille der Nacht um uns herum entsprach. Ich fragte mich, ob es nicht doch Heimweh war, das sie letztendlich hierher geführt hatte. Aber so, wie ich sie einschätzte, würde sie sich lieber die Zunge abbeißen, als es zuzugeben.
»Müde?«, fragte ich nach einer Weile.
Sie fing die Asche in der hohlen Hand auf.
»Flugreisen machen mich duselig. Ich werde wohl langsam alt.«
»Komm, ich bring dich nach oben«, schlug ich vor. »Die Treppe ist steil.«
Schroff wies sie die Hand zurück, die ich ihr reichte.
»Ich gehe noch nicht an Krücken. Wenn ich hier wohne, muss ich ohne dich auskommen.«
»Ganz, wie du willst, Tante Francesca.«
»Lass das ›Tante‹ gefälligst weg«, sagte sie. »Ich heiße Francesca. «
4. Kapitel
Jahre und Entfernungen bewirken eine Umwandlung, verändern die Beziehungen zwischen den Menschen. An einem anderen Ort ist man selbst anders. Aber die Erinnerungen bleiben.