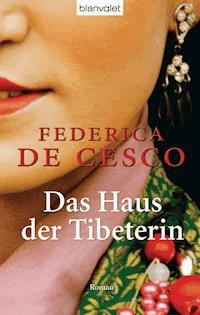Inhaltsverzeichnis
DIE AUTORIN
Widmung
Lob
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zweiter Teil
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Dritter Teil
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Nachwort
Copyright
DIE AUTORIN
Foto: © Kazuy Kitamura
Federica de Cesco, geboren in der Nähe von Venedig, wuchs mehrsprachig in verschiedenen Ländern auf und studierte in Belgien Kunstgeschichte und Psychologie. Nachdem sie bereits über 50 erfolgreiche Kinder- und Jugendbücher verfasst hat, begeistert sie seit ihrem Bestseller »Silber-muschel« auch zahllose erwachsene Leser, zuletzt mit »Die Augen des Schmetterlings«. Federica de Cesco lebt mit ihrem Mann, dem japanischen Fotografen Kazuyuki Kitamura, in der Schweiz.
Von Federica de Cesco ist bei cbt ebenfalls erschienen:
Im Zeichen des himmlischen Bären (30399) Im Zeichen der blauen Flamme (30400)
Für meinen Mann Kazuyuki
»Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.«
Faust 1 (Goethe)
Erster Teil
1
Bei Tagesanbruch erreichte mich die Stimme der Brandung, ein dumpfes Rauschen in meinem Kopf, wie bei einer ans Ohr gehaltenen Seemuschel. Eine Weile gab ich mich Traumbildern hin, blieb ruhig liegen. Es war noch nicht ganz hell und ich wollte noch schlafen … Die Augen fielen mir zu, als ich am Rande meiner Wahrnehmung leicht erschauerte. Aus irgendeinem Grunde war ich unruhig. Ich setzte mich auf, warf mein Haar aus dem Gesicht. Mein Herz pochte. Ein Zeichen? Hatte ich ein Zeichen empfangen? Für gewöhnlich wusste ich, womit ich es zu tun hatte, aber an diesem Morgen war mein Denken verwirrt. Das, was wir »Zeichen« nannten, war häufig nichts anderes als die genaue Beobachtung scheinbar geringfügiger Einzelheiten, die sich nach und nach zu einer Erkenntnis fügten. Am Tag zuvor oder in der Nacht musste ich etwas so Nebensächliches gehört, gesehen oder gefühlt haben, dass ich es aus meinem Bewusstsein verdrängt hatte, etwas, von dem ich jedoch wusste, dass es von großer Bedeutung war. Vielleicht, wenn ich gut nachdachte, würde es mir wieder in den Sinn kommen.
Im Raum nahm das Tageslicht zu. Die heiligen Hähne krähten, begrüßten die Sonne, die rot aus grauen Nebelschwaden glitt, von Atemzug zu Atemzug an Leuchtkraft und Wärme gewann. Die Burg erwachte, Stimmen und Schritte wurden laut. Ich hörte das Schleifen der sich öffnenden Schiebetür, als Miwa, meine Kinderfrau, den Morgentee brachte. Stumm leerte ich meine Schale, schlürfte den süßen Reisschleim, den sie für mich gekocht hatte. Als sie mein Haar kämmte und mit zwei glänzenden Schleifen zusammenband, strich sie mir mit der Hand über die Stirn. Unter dem blauweißen Tuch, das ihr Haar verhüllte, nahm ihr rundes Gesicht einen besorgten Ausdruck an.
»Wie heiß du dich anfühlst! Bist du krank? Tut dir der Kopf weh?«
»Ja, ein wenig«, erwiderte ich.
Sie sagte, ich solle liegen bleiben. Sie würde kommen und mir eine Salbe bringen. Sie ging, zog die Schiebetür hinter sich zu. Ich nahm mir Miwas Rat zu Herzen und legte mich wieder hin. Doch das Lager aus weichen Hanfgräsern war mir unbehaglich und mit meinem Kopf wurde es auch nicht besser. Die Morgensonne schien hell; trotzdem fror ich, mein Magen krampfte sich zusammen und das Rauschen in meinen Ohren nahm zu. Immer wieder dachte ich an eine Muschel, dann an die Brandung, bis das Bild des Ozeans ganz deutlich vor meinem inneren Auge entstand. Miwa würde gleich mit ihrer wohltuenden Salbe kommen, doch ich konnte nicht mehr auf sie warten. Der Sturm der Unruhe, der mich erfüllte, hatte etwas zu bedeuten, etwas, was keinen Aufschub duldete. Ich zog mich mit Anstrengung hoch, streifte ein Gewand über, schlüpfte in bequeme Strohsandalen. Hastig schob ich die Tür auf und rannte durch einen Gang, fiel fast die Stufen der Holztreppe hinunter und lief im Schatten der Mauer durch den gepflasterten Innenhof. Die Burg aus Stein und Mörtel, mit den engen weiß vergitterten Fenstern, vermittelte trotz ihrer Masse ein Gefühl von Schlichtheit und Harmonie. Die großen Torflügel standen offen, die Wächter schenkten mir keine Beachtung, und der Zufall machte, dass ich niemandem begegnete, der an meiner Eile hätte Anstoß nehmen können. Schon erreichte ich die schmale Brücke über den Wallgraben. Eine unterirdische Quelle speiste das grüne Wasser. Unter den Seerosen fingen die Kinder manchmal eigenartige Fische, weiß und blind, die sie ehrfürchtig wieder freiließen. Die Festungsmauer selbst bestand aus großen, grob behauenen Felsblöcken. An allen vier Ecken ragten runde Türme mit Strohdächern empor. Von dort aus konnten die Wächter weit über Meer und Land blicken.
Ein steiniger Pfad führte zum Heiligtum von Sugati, das meine Mutter ein Jahr vor meiner Geburt hatte erbauen lassen, um die Gottheit zu bewegen, ihr eine Tochter als Nachfolgerin zu schenken. Die Gottheit hatte sie schließlich erhört, doch das Geheimnis meiner Geburt quälte mich zunehmend, je älter ich wurde, denn was meinen Vater anbelangte, erzählte man sich allerlei Seltsames. Meine Mutter selbst sprach nie darüber, und es ziemte sich für mich nicht, ihr Fragen zu stellen.
Das Heiligtum war auf mächtigen Pfählen errichtet. Im Laufe der Jahre hatte das verwitterte Gebälk eine dunkle Bronzefärbung angenommen. Ein gewaltiger Firstbalken überragte das Strohdach, und dreiunddreißig mit Moos bewachsene Steinstufen führten zu einem offenen Raum, in dem die Priesterinnen ihre Kulthandlungen vornahmen und die Sonnenwende feierten.
Im Morgenlicht glich das Heiligtum einem Schiff mit geblähten Segeln, das zwischen den Bäumen gestrandet war. Als plötzlich ein Windstoß durch das Unterholz fuhr, gerieten die Schatten in Bewegung, und Sonnenstrahlen schossen wie Feuerfunken über das Dach. Ich blinzelte verwirrt, das Trugbild verschwand. Doch mein Herz war beunruhigt. Als Königstochter und Priesterin hatte ich gelernt, jede Wahrnehmung genau zu beachten, auch wenn die Gefahr, die ich vorauszuspüren glaubte, einer Sinnestäuschung entstammen konnte, die mich in eine falsche Richtung lockte.
Unsere Hauptstadt Amôda lehnte kreisförmig an einem Hang. Als Schutz gegen die Brandungswellen hatten unsere Vorfahren einen Damm errichtet. Die Klippen öffneten sich vor der Mündung eines Flusses, der gut befahrbar war. Dort befand sich auch der Hafen. Seit uralten Zeiten benutzten wir Boote aus geflochtenem Schilfrohr, das mit Lehm abgedichtet wurde. Mit Segeln versehen, waren diese Schiffe durchaus seetauglich. Das Wasser plätscherte gegen die steinigen Ufer, wo Netze zum Trocknen ausgelegt waren. Oben am Hang waren Reisfelder angelegt. Die fruchtbare Erde ließ zwei Ernten im Jahr zu und niemand konnte sich an eine Hungersnot erinnern. Noch zogen Nebelschwaden durch die Wälder, wo alte Männer Holz zum Feuermachen sammelten, denn die Nächte wurden kühler. Nach Osten hin öffnete sich ein sumpfiges Gebiet, das einmal von dem Wasser eines Sees bedeckt gewesen war. Ein geheimnisvoller und gefährlicher Bereich, von unterirdischen Quellen durchzogen, der unserer Heimat Yamatai schon vor undenklichen Zeiten den Namen »Land-inmitten-der-Schilfrohrfelder« gegeben hatte.
Unsere Handwerker waren sehr geachtet, denn sie bearbeiteten die sieben edlen Materialien: Metall, Stein, Holz, Leder, Bambus, Baumwolle und Ton. Es wurden auch Maulbeerbäume angepflanzt und Seidenraupen gezüchtet. In fast jedem Haus stand ein Spinnrad. Doch das Weben galt als Vorrecht der Priesterinnen, das Hin und Her des Schiffchens wurde mit dem heiligen Schöpfungsakt verglichen. Alle Häuser waren aus Holz, und es gab sogar noch Familien, die nach altem Brauch in Pfahlbauten lebten.
Als Herren über die Metalle bildeten die Schmiede eine mächtige Zunft. Das Volk fürchtete sie, denn sie galten als Verbündete der Gottheiten, der »Kami«. Daneben verlangte eine uralte Tradition, dass die jungen Adligen die Kunst der Metallverarbeitung zu erlernen hatten. Jeder Krieger musste seine Waffen selbst schmieden.
Die halbmondförmige Hafenanlage war nach Westen hin offen. Die Seeseite war befestigt. Zahlreiche Segelschiffe und Ruderboote befanden sich in dem Becken. Ein Fischerboot hatte gerade am Strand angelegt. Mit großen Tauen zogen die Männer das Boot auf den Sand, während die Frauen, lachend und scherzend, von hinten schoben. Sie trugen kurze blaue Gewänder, die mit einer Schärpe gehalten wurden, und breite Stirnbänder. Gischt spritzte um ihre stämmigen braun gebrannten Beine. Ich stapfte an ihnen vorbei durch den Sand, ohne dass sie mich erkannten, denn als Königstochter trat ich nie ungeschminkt vor das Volk.
Keiner beachtete mich, als ich den Strand verließ, mich den Klippen zuwandte. Hier hatte das Meer kleine Buchten geschaffen. Im Frühling bauten Strandläufer und Regenpfeifer bis hinunter zur Wassergrenze ihre Nester. Über den Sandsteinfelsen, die weit hinaus ins Meer ragten, flimmerte die Hitze. Die Brandung umschäumte die Riffe und am Horizont schimmerte das Blau des offenen Meeres. Kein Mensch war hier zu sehen, alles schien einsam und weit weg. Ich streifte mein Kleid ab. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet, ging ich dem Meer entgegen. Das Wasser war durchsichtig und warm wie mein Blut. Während ich hinausschwamm, trugen mich die kleinen Wellen auf- und abwärts, und manchmal überspülte mich ein Kamm. Das Wasser war durchsichtig, die Sonnenstrahlen durchbrachen das Blau, ließen Sand und Korallen aufleuchten. Unter mir fiel der sandige Boden sanft ab; die Felsen waren mit Muschelsplittern verkrustet. Ein Schwarm schimmernder Fische breitete sich fächerförmig um einen Korallenstock aus.
Mit einem Mal sah ich den Hai. Er tauchte aus dem Halbdunkel empor und stieg mit ruhigen, mühelosen Bewegungen der Helle entgegen. Sein bronzefarbener Rücken flimmerte in der Sonne. Er war riesengroß und schwamm völlig lautlos. Ich hatte solch einen Hai noch niemals in Küstennähe erblickt. An diesem Tag, an dem mir alles merkwürdig vorkam, wurde auch er zu einem Zeichen, und ich erkannte in ihm einen Boten der Unterwelt.
Doch ich fürchtete ihn nicht; er würde mir kein Leid zufügen, denn ich trug die heiligen »Tamas«, das Symbol des uralten Paktes mit dem Tierreich. Es waren zwei Lederarmbänder, an denen Steine in der Form von Bärenkrallen hingen. Ich wusste von meiner Mutter, dass es sich einst um wirkliche Krallen gehandelt hatte. Töteten unsere Vorfahren einen Bären, verspeisten sie seine rohe Leber und schmückten sich mit seinen Krallen. Auf diese Weise erlangten sie die Stärke des Tieres und machten es zu ihrem Schutzgeist. Es war eine gewaltige heilige Handlung, und sie geschah zu Beginn der Zeiten, als die Geschöpfe manchmal Tiere, manchmal Menschen waren und die gleiche Sprache teilten. Man erzählte sich zwar, dass in den tiefen Wäldern des Nordens noch ein Volk mit den Bären vertrauensvoll lebte und ihre Sprache verstand, aber die meisten glaubten nicht, dass so ein Ding heute noch möglich sei. Jedenfalls trugen nur die Nachkommen des Königsgeschlechtes von Yamatai die »Tamas«, als Zeichen dafür, dass die Kraft der Bären in ihnen wirkte. Für Männer waren die Steine grünlich, für Frauen rötlich, doch durften sie bei bestimmten Anlässen – zum Beispiel Hochzeiten – ausgetauscht werden.
So beobachtete ich furchtlos den Hai, der langsam unter mir vorbeizog und in der Tiefe verschwand. Im Wasser schweiften meine Gedanken stets ab und ich ließ sie ziehen. Erst wenn mein Geist mir völlig weiß und leer vorkam, sprach die Gottheit zu mir und gab mir ein Zeichen, etwas, was gesehen oder gehört werden konnte.
Nach einer Weile ließ ich mich von einer Welle an den Strand tragen und zog mich an den Felsen hoch. Trotz des warmen Windes spürte ich, wie ich fröstelte. Die Unruhe hatte mich nicht verlassen; im Gegenteil, sie kam mir noch stärker und dringender zu Bewusstsein. Eine unerklärliche Angst schnürte mir die Kehle zu. Wachsam und gespannt schweiften meine Augen umher. In der Ferne blähte sich eine weiße Wolke über einer Gruppe kleiner, baumbewachsener Inseln, die bei Ebbe zu Fuß erreichbar waren. Den Leuten von Amôda war dieser Weg vertraut, doch hielten sie ihn vor Fremden geheim. In Kriegszeiten stellte dieser natürliche Pfad eine Bedrohung dar, da die Stadt zur Meeresseite hin nicht befestigt war.
Ich kniff die Augen zusammen, beobachtete die von weißen Wellenkronen umspülten Riffe. Über den Klippen schwebte ein Sperber in weit ausholenden Kreisen. Ab und zu trug mir der Wind seinen kurzen, durchdringenden Schrei zu. Meine Augen, die nichts Ungewöhnliches bemerkten, ließen von ihm ab und wanderten nach Westen, wo sich die Heilige Insel erhob. Sie war einzigartig, sowohl in ihrer Gestalt und Größe als auch ihrer Bedeutung wegen: ein vollkommen ebenmäßig geformter Basaltkegel, der in der Morgendämmerung den ersten Sonnenstrahl einfing. Der Ozean hatte die Klippen so lange umspült, gefeilt und geglättet, bis sie wie schwarz glänzende Spiegel aus den Wellen ragten. Je nach Tages- oder Jahreszeit veränderte das bewegte Spiel von Licht und Schatten ihr Aussehen, verwandelte sie zu Schaum oder Pechkohle, zu Gold oder Kupfer. Bald schwebten sie im schimmernden Nebel, bald erstrahlten sie von Purpur gekrönt. In der Mittagshitze schien die Insel blass und fern, brach aber die Nacht herein, wuchs sie zu einem Dreieck von riesigem Ausmaß heran, das die aufgehenden Sternenbilder verdunkelte.
Ein Seufzer entfuhr mir. Voller Wehmut entsann ich mich der Zeit, die ich auf der Insel verbracht hatte. Das Antlitz der Hüterin des Feuers, die mich in der Lehre der Großen Vorfahren unterwiesen hatte, zeigte sich mir plötzlich mit aller Deutlichkeit. Ich vermeinte, ihre wissenden Augen zu sehen, die Bewegungen ihrer Lippen; glaubte, im Seufzen des Windes ihre leise, klare Stimme zu vernehmen.
»Hüterin des Feuers«, sprach ich zu ihr in der Stille meines Herzens. »Ich spüre Furcht und sehe nicht, was sie verursacht. Du hast mir nie etwas Falsches gesagt. Schicke mir jetzt ein Zeichen, damit mein Geist Ruhe findet.«
Von der Luftströmung getragen, trieb der Sperber über den Bäumen ab. Traumbefangen folgte ich mit dem Blick seinem Flug. Mit einem Mal erfasste mich ein starkes Schwindelgefühl. Der Boden schien unter mir wegzugleiten. Losgelöst von der Erde, flog ich über die Riffe, vereint mit dem Sperber, dessen Raubgier und Kraft ich teilte. Und auf einmal wurde ich zum Vogel selbst, wurde zu Krallen und Schnabel, zu Federn und Flügeln und scharfblickenden Augen. Ich bemerkte die verstohlenen Bewegungen im Unterholz, erlebte den heftigen Schwung, als sich der Sperber wie ein Stein vom Himmel fallen ließ. Er senkte sich im Gleitflug, scheuchte einen Schwarm Wachteln aus dem Gebüsch, die wirr und erschrocken emporflatterten. Doch der Raubvogel schlug keine Beute. Etwas hatte ihn abgelenkt. Er änderte plötzlich die Richtung, schoss dicht an den Bäumen vorbei und drehte seitlich ab. Dann zog er einige aufsteigende Kreise, bevor er sich mit stetigem Flügelschlag entfernte.
Ein Schreckensschrei entfuhr mir. Meine Seele hatte sich von der des Vogels gelöst, der nur noch ein dunkler, immer kleiner werdender Punkt am Himmel war. Ich kam wieder zu mir, bis in die Knochen von eisiger Kälte durchdrungen. Mit zitternden Händen zog ich mein Gewand über den Kopf, sprang auf und floh über den Strand.
2
Man sagte mir später, dass ich im Laufen schrie. Man sagte mir auch, dass ich die Hände rang, meine Wangen zerkratzte, mir die Haare raufte. Ich erinnerte mich kaum mehr daran. Ich erinnerte mich nur noch an das Grauen, das von mir Besitz ergriffen hatte und mich betäubte.
»Die Sperbermenschen!«, schrie ich. »Die Sperbermenschen kommen!«
Es war ein Name, der die Mutigsten erbleichen ließ; ein Name, der das Blut in den Adern der Männer und Frauen zum Stocken brachte. Wo ich vorbeilief, blieben die Leute stehen. Bauern, die mit der Hacke in der Hand vom Feld kamen, starrten mich an, als sei ich eine Irre. Die über ihre Netze gebeugten Fischer sahen beunruhigt auf. Ich rannte an den Lagerhäusern vorbei, wo sich Berge von Warenballen stapelten, bahnte mir einen Weg durch die engen, überfüllten Straßen. Eine Anzahl Männer trat lachend aus einem Teehaus. Ich schleuderte ihnen meinen Schrei ins Gesicht und sie wichen erschrocken zurück. Ich stieß gegen eine Frau, die gebückt unter dem Gewicht eines Baumwollballens daherkam. Sie verlor das Gleichgewicht, taumelte gegen eine Wand. Ihre Last fiel zu Boden. Ich schrie sie an: »Die Sperbermenschen kommen!«
Eine große Wirrnis war in meinem Kopf. Wer hatte dem Feind den Weg über die Inseln verraten? Der Name, den ich zu vergessen geschworen hatte, blitzte wie ein brennender Funke in mir auf. Ich stolperte über einen Stein, fiel der Länge nach hin. Stöhnend raffte ich mich auf. Meine Knie bluteten. Atemlos rannte ich weiter. In düsterer Besorgnis folgten mir aller Augen. Satzfetzen drangen an mein Ohr: »Sie ist es … Toyo-Hirume-no-Miko … die Prinzessin Toyo! Rührt sie nicht an! Die Gottheit spricht aus ihrem Mund … Ein Unglück steht uns bevor …!« Auf diese Weise, getragen von der Kraft meiner Besessenheit, unempfindlich gegen Schmerz oder Erschöpfung, lief ich der Burgfestung entgegen. Vor dem Ausfalltor brach ich zusammen.
Jemand – es musste ein Wächter sein – hob mich hoch, trug mich fort. Mein Kopf schwang hin und her, meine Haare schleiften über den Boden. Schon verdunkelte sich der helle Tag, alle Geräusche verschwanden in weiter Ferne. Die Welt wurde schwarz und still.
Das Erste, was zurückkam, war ein Gefühl der Ruhe. Sanfte Hände legten ein nasses Tuch auf meine Stirn. Ich schlug die Augen auf, erkannte das besorgte Gesicht meiner Kinderfrau. Sie hob meinen Kopf, setzte eine dampfende Schale an meine Lippen. Ich trank gierig, bis die Schale leer war. Dann fiel ich erschöpft auf die Matte zurück. Miwa streichelte meine Stirn, murmelte beruhigende Worte. Die Übelkeit war gewichen, ich empfand nur noch ein starkes Bedürfnis nach Schlaf. Doch zunächst hatte ich etwas zu tun, etwas, was keinen Aufschub duldetete. Ich sagte zu Miwa:
»Bitte meinen Verehrungswürdigen Onkel Tsuki-Yomi zu kommen.«
Sie wiegte bekümmert den Kopf, wollte widersprechen. Ich packte sie am Ärmel.
»Jetzt sofort, Miwa! Hörst du?«
Sie seufzte, bevor sie wortlos den Raum verließ. Mir brach erneut der Schweiß aus. Nach einer Weile hörte ich fernes Stimmengewirr. Die Schiebetür wurde beiseitegestoßen. Ein Rascheln von Stoff und leise, beherrschte Atemzüge machten, dass ich die Augen öffnete und meinen Onkel Tsuki-Yomi »Majestät-Wächter-des-Mondes« in eleganter Haltung auf der Matte knien sah. Sein Gewand mit den breiten Flügelärmeln war schlicht, doch aus allerfeinstem Leinen. Das lange, glänzende Haar umrahmte sein ebenmäßiges Gesicht, in dem die scharfen Augen aufmerksam blickten. Er wusste, dass ich aus meinem Trancezustand erwachte und noch verstört und empfindsam war. Und so sprach er mit großer Behutsamkeit zu mir:
»Ich danke Euch für diese Unterredung. Das Volk und die Wachen sind in Aufregung. Beunruhigende Gerüchte gehen um. Jeder sagt, die Göttin habe Euch ein Zeichen gesandt …«
Während er sprach, versuchte ich, mich aufzurichten. Miwa bemerkte, wie schwach ich noch war, glitt hinter mich, hob mich hoch. Ich sagte stockend:
»Was Ihr vernommen habt, ist wahr. Ich spüre grauenvolle Dinge voraus. Die Sperbermenschen aus dem Lande Kuna rücken über den Inselweg gegen unsere Stadt vor …«
Mein Onkel saß vollkommen ruhig, den Kopf hocherhoben. »Dann werden sie heute Nacht angreifen.«
Ich schluckte würgend. »Ihre Waffen sind bereit.«
Er schob die Hände in die langen Ärmel seines Gewandes.
»Wer ist ihr Anführer?« Seine Stimme klang bitter, doch mit einem Unterton von Hohn, der mir die Hitze in die Wangen trieb.
»Ich … ich konnte ihn nicht sehen. Er trägt eine Maske.«
»Alle Sperbermenschen tragen eine Maske«, erwiderte gelassen Tsuki-Yomi.
Ich bat um Wasser.
Miwa hob den Krug, füllte eine Schale. Ich trank, die Schale schlug gegen meine Zähne; ich verschüttete die Hälfte. Meine Haut prickelte. Worte erklangen in meiner Erinnerung, gleich einem fernen, rauschenden Echo: »Dein Name sei verflucht für die zukünftigen Generationen. Er sei für immer aus dem Gedächtnis und den Träumen verbannt!«
Wer hatte diese Worte, aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Leben, ausgesprochen? Ein verschwommenes Bild tauchte vor mir auf, nahm Gestalt an, wurde deutlicher: Die Sonne brannte wie heißes Silber, der Himmel glühte wie Stahl. Ein Mann war vor dem Heiligtum an eine Steinsäule gefesselt. Blut tränkte seine Kleider, bildete braune Flecken auf dem Sand, spritzte auf den Saum meines Gewandes.
Das Bild zuckte durch mein Gehirn, wie das Flackern eines Blitzes hinter den Wolken. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich erbrach mich auf die Matte.
Als Miwa mir das verschwitzte Gewand wechselte, begriff ich, dass mein Onkel sich zurückgezogen hatte. Ich überließ mich ihren Händen, die mich wuschen, mich auf ein sauberes Lager betteten. Die Müdigkeit löste jeden bewussten Gedanken in mir auf. Jetzt endlich konnte ich schlafen.
Das behutsame Aufgleiten der Schiebetür weckte mich. Meine Kopfschmerzen waren verflogen. Ich fühlte mich ruhig und entspannt. Ich schlug die Augen auf, sah den Raum in goldrotes Abendlicht getaucht. Mir war, als ruhte ich im Innern einer Muschel. Das Bewusstsein einer Gegenwart ließ mich den Kopf wenden. Ich erblickte eine Dienerin meiner Mutter in bescheidener Haltung neben meinem Lager knien. Sie verbeugte sich und teilte mir mit, dass die Königin mich zu sprechen wünsche.
Miwa brachte mir Tee und eine Schale mit kaltem gewürztem Gemüse. Ich aß mit Appetit und spürte meine Kräfte zurückkehren. Dann kleidete mich Miwa in ein seidenes Übergewand, kämmte mein Haar, bis es in glatten Wellen über meinen Rücken fiel. Eine einzige Strähne wurde hochgesteckt, damit der Heilige Kamm der Priesterinnen befestigt werden konnte. Mein Gesicht wurde gepudert, die Brauen mit Holzkohle nachgezogen, die Lippen rot geschminkt.
Die letzten Sonnenstrahlen fielen schräg in die Gänge, als ich mich zu den Gemächern der Königin begab. Obwohl ich aufrecht ging, führte mich Miwa in stummer Besorgnis am Ellbogen. Ich ließ sie gewähren.
Meine Mutter bewohnte den Teil des Gebäudes, der »Ort des Mittelpunktes« genannt wurde und auf Pfählen ruhte. Eine große, offene Halle, in der meine Mutter bei offiziellen Anlässen erschien und ausländische Gesandte empfing, überragte den mit Sand bestreuten Innenhof. Das runde Strohdach wurde von zwölf purpurnen Holzsäulen getragen. Alle Gänge und Säle waren mit schwarz geränderten Binsenmatten ausgelegt. Bei Bedarf konnten die Räume durch Schiebewände vergrößert werden, sodass viele Leute darin Platz fanden. Ein offener Gang führte zu den Wohnungen der Adligen und der zahlreichen Höflinge, während Offiziere und königliche Wachen im Nebengebäude untergebracht waren.
Ich hatte meine Mutter seit mehr als zwei Monden nicht gesehen. Das war nichts Ungewöhnliches. Sie bedurfte der Einsamkeit, um ihren Geist den Schwingungen der Unsichtbaren Welt zu nähern. Dennoch vernachlässigte sie die Geschäfte des Königreiches nicht. Scharfsinn und Klugheit prägten ihre Entscheidungen. Ihre Weisheit rechtfertigte die Strenge oder Milde ihrer Urteile. Unter ihrer Herrschaft war Yamatai ein mächtiges und blühendes Land geworden. Nur an bestimmten symbolischen Tagen zeigte sich die Königin dem Volk. Am ersten Tag des ersten Monats im Jahr ging sie auf die Felder, begleitet von ihren Priesterinnen. Mit einem Pflug brach sie die erste Furche, um das neue Jahr einzuleiten und die Fruchtbarkeit der Erde zu beschwören. In der darauffolgenden Nacht wurden große Feuer angezündet. Die Leute zogen singend und tanzend durch die Straßen, berauschten sich an Reiswein und ergaben sich der Liebe, wie es gerade kam. Zweimal jährlich dann, zur Sonnenwende, brachte die Königin im Heiligtum von Sugati der Sonnengöttin Amaterasu den geweihten Opferreis dar. Sie empfing auch ausländische Gesandtschaften aus Übersee und übernahm den Vorsitz beim üblichen Geschenkeaustausch. Sonst blieb sie dem öffentlichen Leben fern, nahm weder an Jagdausflügen noch Festgelagen, weder am Wettdichten noch an sonstigen bei Hofe üblichen Vergnügungen teil.
Vor dem königlichen Gemach stand keine Wache. Nur ein etwa vierzehnjähiger Junge, schlicht gekleidet und mit einem weißen Stirnband, kniete bescheiden im Halbdunkel. Saho, der Page meiner Mutter, war es, der ihr zweimal am Tag die Mahlzeiten brachte. Die Königin ernährte sich ausschließlich von Reis, Gemüse und Früchten. Es war verboten, ihr beim Essen zuzusehen. Saho ordnete die Speisen auf einem Lacktablett an und zog sich dann hinter die Schiebewand zurück. Hatte meine Mutter ihre Mahlzeit beendet, räumte Saho das Geschirr wieder ab.
Mit einer stummen Verbeugung goss er aus einem Krug etwas Wasser in eine Schale, in der ich mir, wie es der Brauch vorschrieb, die Hände wusch. Nachdem ich sie mit einem weißen Tuch abgetrocknet hatte, kniete Saho erneut nieder und schob die Trennwand beiseite.
Ich betrat das Gemach meiner Mutter.
Nur das Knistern einer Pechfackel, die in einem Eisenring an einem Pfosten befestigt war, durchbrach die Stille. Das Licht schimmerte auf den mächtigen Tragpfeilern; sie waren aus dem geschuppten Stamm einer Tanne gemacht und so poliert, dass sie honigfarben glänzten. In dem Raum, der in seiner kargen Schlichtheit einem Heiligtum glich, befanden sich ein Kohlenbecken auf einem Dreifuß, ein Schreibgestell aus karminrotem Lack, eine Bronzescheibe mit ihrem Schläger und ein Webstuhl. Wie eine stille Lichtfigur kniete Königin Himiko auf einer Matte aus gepresstem Reisstroh.
Das wunderbar schlichte Haar fiel über ihren Rücken und die weiten Flügelärmel bis hinab zu den Hüften. Ihr weißes Gewand mit dem scharlachroten Unterkleid lag in geraden Falten um ihre Knie. Sie saß vollkommen reglos, beide Hände im Schoß gefaltet. In ihrem gepuderten Antlitz lebten nur die Augen, schwarze Steine im Schatten der Wimpern.
Ich sank nieder und berührte mit der Stirn die Matte. So verharrte ich, bis meine Mutter mit den Worten »Komm näher!« die Stille brach.
Ihre Stimme war klar und kühl; eine ruhige, befehlsgewohnte Stimme, die nie laut zu werden brauchte. Und obwohl ihre erste Frage gleichmütig klang, bewirkten ihre durchdringenden Augen, dass mir der Schweiß ausbrach:
»Nun? Was hast du gesehen?«
Ich antwortete, den Blick gesenkt:
»Ich sah einen Vogel. Und dann wurde ich selbst zu diesem Vogel …«
Sie schaute mich an und wartete. Ich befeuchtete meine Lippen.
»Als ich der Vogel war, flog ich über die Inseln. Die Feinde hielten sich im Wald verborgen, aber ich sah ihre Waffen blitzen.«
»Die Sperbermenschen …«, flüsterte sie, überrascht und verächtlich. »Wie konnten sie ein solches Wagnis eingehen?«
Jäh hob ich die Augen, blickte meiner Mutter unhöflich ins Gesicht. Ich hatte niemals darüber nachgedacht, ob es schön wäre oder nicht. Ich entdeckte auf einmal, dass es ein leeres Gesicht war, unseren Metallspiegeln ähnlich, die Licht wie Schatten in sich aufnehmen. Und obwohl kein Wimpernzucken ihre Augen bewegte, wusste ich, dass sie in mir ebenso klar sah wie in den Rissen verbrannter Knochen, wenn sie das Schulterblatt eines Damhirsches in die Räucherschale legte und das Orakel befragte. Und dass sie alle meine Gedanken las, die ich nicht auszusprechen wagte.
Ich schluckte und sagte:
»Sie liegen auf der Lauer und warten auf die Nacht. Ein Mann hat ihnen den Geheimweg gezeigt.«
»Wie kann ein Fremder davon wissen?«
Ich knetete meine Hände und schwieg. Nach wie vor saß meine Mutter vollkommen ruhig. Doch in ihren Augen mit den übergroßen Pupillen glomm ein seltsamer Schimmer auf.
»Ein Mann aus unserem Volk?« Sie sprach gelassen. »Ist es das, was du sagen willst?«
Ich nickte stumm. In mir wollten sich keine Worte bilden. Stattdessen hallte in meinem Kopf ungestümes, stolzes Gelächter wider. Ich entsann mich an wirbelndes Haar, an tiefschwarze Augen mit einem violetten Schimmer, sah über einem bronzenen Helm den hohen Schatten eines Hirschgeweihs.
Der Blick meiner Mutter durchforschte mich unerbittlich. Ich schloss mich ein, verkapselte mich, um ihr meinen Geist zu verbergen. Meine Anstrengung war vergeblich. Sie durchschaute mich. Wortlos bedeckte ich mit dem Ärmel mein Gesicht. Stille. Nur die Fackel knisterte. Als ich schließlich den Kopf hob, bewegte sich meine Mutter zum ersten Mal. Sie wandte sich auf ihren Knien um und ergriff den Schläger. Zweimal fiel das Holz auf die bronzene Scheibe. Der erste Ton verursachte ein Summen, das ich im Boden unter mir spüren konnte. Und während der zweite Ton nachschwang und erlosch, sprach die Königin gleichmütig:
»Man soll das Volk vor der Gefahr warnen. Kommt es zu einer Schlacht, werde ich sie anführen.«
3
Mein Name, Toyo, bedeutet »Schimmernde Perle« und ich galt als die Tochter eines Hirsches. Es hieß, die Königin habe mich im Heiligen Wald von einem Hirsch empfangen, der das Aussehen eines Menschen angenommen hatte, um sie zu verführen. Das einfache Volk schenkte dieser Fabel Glauben. Die Herrscherin stand über allem, erhaben wie die Sonne, die sie verkörperte, fleckenlos und weit entfernt von allen Alltäglichkeiten. All ihr Tun war geprägt von Überirdischem. Und da der Hirsch als eine Gottheit galt, wurde meine Geburt als ein besonders großes Ereignis gefeiert.
Natürlich klatschte man bei Hof, aber die Ehrerbietung, die man der Königin entgegenbrachte, übertrug sich auch auf mich, aufdringliche Gerüchte gelangten kaum an meine Ohren. Als ich jedoch heranwuchs und meine Neugierde geweckt wurde, hörte und sah ich vieles, was mich für das »Wunder« meiner Geburt eine ganz menschliche Erklärung finden ließ.
So nahm ich an, dass meine Mutter, deren Stellung sie nicht zur Keuschheit verpflichtete, ihr Lager einst mit einem Jäger geteilt hatte, was wohl die Fabel des Hirsches erklärte. Auch den Zeitpunkt glaubte ich zu kennen, verlangte doch die Tradition, dass die Herrscherin sich zur Frühlings-Tagundnachtgleiche in Begleitung einer jungen Priesterin in den Eichenwald begab, um im Gebirgsbach die Tücher für die Kulthandlungen zu waschen. Ich stellte mir Himiko vor fünfzehn Jahren vor – anmutig, im hochgeschürzten roten Gewand, das offene Haar bei jedem Schritt wie eine Zauberwolke wehend.
Der Eichenwald erstreckte sich über einen Hügel. Ein Pfad schlängelte sich durch ein Gewirr von Zweigen und hohen Gräsern bergan. Ein Wasserfall rauschte. Er entsprang einer Felswand und ergoss sich wie schäumendes Licht in ein natürliches Becken. Ich stellte mir vor, wie meine Mutter und die kleine Priesterin ihre Körbe niederstellten. Sie wuschen und klopften die Wäsche auf flachen Steinen, spülten sie im klaren Wasser. Dann breiteten sie die Tücher in der Sonne zum Trocknen aus. Es wurde heiß. Insekten flimmerten im Licht. Am Rande des Wasserfalles schillerte ein Regenbogen. Meine Mutter und ihre Begleiterin streckten sich im Schatten aus, um ein wenig zu ruhen. Die junge Priesterin war müde und schlief bald ein.
Ich träumte weiter: Das Knacken von Zweigen ließ meine Mutter aufblicken. Ein Hirsch brach aus dem Dickicht. Das mächtige Tier schien verfolgt zu werden: Seine Flanken bebten, sein Fell war schweißnass. Mit einem Sprung setzte es über den Bach. Kaum war es im Unterholz verschwunden, als ein junger Mann am Fuß des Wasserfalles auftauchte. Er sprang von Stein zu Stein, um das Wasser zu überqueren. Er trug einen Bogen und einen mit Pfeilen gefüllten Köcher. Ich stellte ihn mir hochgewachsen und kühn und schön vor.
Wusste er, dass das Mädchen im roten Gewand die Königin war? Er wusste es sicherlich, doch sah er ihr voll ins Gesicht. Ihre Haut hatte die Farbe von Aprikosen, ihre Augen waren unergründlich. Im flimmernden Halbschatten betrachteten sie sich stumm. Dann legte er die Waffen nieder und ging auf sie zu. Vielleicht war auch sie es, die ihm entgegenschritt, leichtfüßig, bezaubernd … Immer an dieser Stelle gebot ich meiner Fantasie Einhalt.
Weil mir die Wahrheit verborgen blieb, mochte es ja sein, dass mich Trugbilder verwirrten. Denn ich war jung, fühlte zu viel und überlegte zu wenig, hörte nur, was zu hören ich bereit war, und nicht, was wirklich gesagt wurde. Auch das Getuschel der Dienstboten berührte mich nicht. Meine Mutter war die Königin! Ich wagte kaum zu denken, dass ich sie sie vor allem wegen ihres Geheimnisses liebte.
Man entdeckte sehr bald, dass ich eine Schamanentochter war. Dies und meine rätselhafte Abstammung bestimmten schon frühzeitig meine Erziehung. Da ich von der Göttin auserwählt war und diese durch meinen Mund sprach, wurde meine Erziehung älteren Priesterinnen anvertraut. Sie waren weise, gütig und fröhlich, sodass trotz vieler Pflichten meine Kindheit glücklich verlief. Ich lernte, meine hellseherischen Fähigkeiten zu entwickeln, Visionen zu erleben und Träume zu deuten. Man unterwies mich in allen Formen des Tempeldienstes. Ich lernte, Seide zu spinnen, aufzuspulen und zu weben. Als Erbin des Königreiches wurde ich auch in Schreiben, Mathematik und Sternenkunde unterrichtet. Man brachte mir die Eigenschaften der Pflanzen bei, die Geheimnisse der Metalle. Ich lernte die Dichtkunst ebenso wie die Kriegsführung.
Meine Ausbildung sollte jedoch ein plötzliches Ende nehmen. Weil eine Schuld auf mir lastete, verbannte mich meine Mutter auf die Heilige Insel, wo die Hüterin des Feuers mir die volle Tragweite meiner Pflichten vor Augen führte. Es war eine milde Strafe für ein folgenschweres Vergehen; die tragische Verkettung der Ereignisse bedrohte noch heute unser Volk. Doch inzwischen war ich reifer geworden. Und obwohl die Erinnerungen wie schmerzende Wunden in mir brannten, konnte ich der Frage nicht ausweichen: War ich, die ich mich für die Ursache des Unglücks hielt, vielleicht lediglich das Werkzeug jener Höheren Macht, die für Menschen wie für Königreiche das Schicksalsmuster webte?
Ich nahm an, dass meine Mutter die Antwort bereits wusste. Warum hätte sie sonst zu den Waffen gegriffen?
Wir nannten das Volk aus dem Lande Kuna »Sperbermenschen«, weil sie beim Kampf Federmasken trugen, um den Feind abzuschrecken. Sie waren nur einer von einundzwanzig Eingeborenenstämmen, die meine Vorfahren einst unterworfen hatten, denn diese gehörten zu den ersten Menschen, die sich Schwerter aus Bronze gemacht hatten. Die besiegten Ureinwohner, die einst nackt in den Wäldern lebten, hatten mit der Zeit gelernt, sich zu bekleiden und Hütten zu bauen. Sie ernährten sich jedoch weiterhin – allerdings im Geheimen – von rohem Fleisch. Ihr Land war reich an Bodenschätzen. Wir förderten dort Eisen, Kupfer, Gold und Edelsteine, um mit den Ländern von Übersee Handel zu treiben. Als Waldbewohner hatten diese Menschen eine Waffe von tödlicher Wirksamkeit entwickelt: Bei günstiger Windrichtung schossen sie mit Blasrohren Pfeile ab, die mit einem starken Gift getränkt waren. Es hieß, dass sie den Saft bestimmter Pflanzen, die nur bei Neumond wuchsen, auf die verwesten Eingeweide erlegter Tiere einwirken ließen. Das Opfer starb nicht auf der Stelle. Sein Körper wurde nach und nach gelähmt. Das Gehirn blieb unversehrt, sodass der Unglückliche bis zu seinem letzten Atemzug das Bewusstsein behielt. Einige zogen diesem langsamen Dahinsiechen vor, ihrem Leben selbst ein Ende zu bereiten. Besaßen sie nicht mehr die Kraft, zur Waffe zu greifen, erwiesen ihnen Familienmitglieder diesen letzten Dienst.
Gegen das Gift war kein Mittel bekannt. Doch ein Abgesandter von Nimana, dem großen Königreich auf dem benachbarten Festland, hatte meiner Mutter einst mitgeteilt, dass die Ärzte bei Hofe ein Gegengift entwickelt hatten. Meine Mutter wollte mehr darüber wissen, doch man gab ihr zu verstehen, dass die Ärzte ihr Geheimnis für sich behalten wollten.
Jetzt aber war die Gefahr groß, denn nie zuvor hatten die Sperbermenschen einen Angriff gegen uns gewagt. Zweifellos hatte man die Häuptlinge zum Kampf aufgehetzt, die Krieger aufgestachelt und ihnen reiche Beute versprochen.
»Ich werde die Schlacht anführen«, hatte die Königin gesagt. Sie, die Unberührbare, würde ihr heiliges Gemach verlassen, sich die Haare nach Männerart binden und ein Schwert umgürten, um die Stadt gegen primitive Waldbewohner zu verteidigen. Bei diesem Gedanken lächelte ich wissend und bitter. Nein, es waren nicht die Sperbermenschen, die zu schlagen sie sich rüstete. Sie waren nur Werkzeuge in der Hand ihres Anführers. Rache ist das Recht jeden Mannes, der gedemütigt wurde. Auf seine Ehre konnten wir nicht mehr bauen; er hatte sie längst aufgegeben, zugunsten seines Zorns.
Ich trat in den Innenhof hinaus, wo die Leibgarde der Königin aufzog. Es waren großgewachsene, schweigsame Männer mit harten Gesichtern. Sie trugen eiserne Rüstungen und ihre Haare waren unter dem runden Helm auf besondere Art geflochten. Im Licht der Pechfackeln ging ich durch das Tor und stieg auf die Befestigungswälle. Die Schildwachen grüßten mich ehrerbietig und ich erwiderte ihren Gruß. Ich beugte mich über die Zinnen. Eisiger Wind schlug mir ins Gesicht; die Nacht war klar und kalt. Unzählige Fackeln erleuchteten die Straßen Amôdas. Ein rötlicher Lichtschein schwebte über der Stadt, wo sich die Einwohner in aller Eile zum Kampf bereit machten, Tore versperrten und Straßen absicherten. Frauen und Kinder sammelten Vorräte für den Fall einer Belagerung, Männer bildeten Ketten, um Wasserschläuche weiterzureichen, die zum Löschen der Brände bestimmt waren.
Da wurde am Ausfalltor Stimmengewirr laut: Ein aufgeregtes Menschenknäuel drängte in den Hof. Schnell lief ich die Treppe hinunter. Die Leute wichen vor mir zurück. Im Licht der Fackeln sah ich einen alten Mann, einen Fischer, dessen Kleider in Fetzen an seinem mageren, mit Wunden bedeckten Körper hingen. Er kniete vor mir nieder, brachte schluchzend seinen Bericht vor: Als er bei Sonnenuntergang seine Netze in der Nähe der Inseln einholte, wurde sein Boot von unzähligen Pfeilen durchlöchert. Einer davon hatte seinen Sohn in die Kehle getroffen und ihn auf der Stelle getötet. Es war der älteste Sohn der Familie gewesen, ein starker, schöner Jüngling. Er selbst hatte sich retten können, indem er in die Fluten tauchte und sich von den Brandungswellen an die Küste tragen ließ.
In dem beklemmenden Schweigen, das folgte, richteten sich aller Augen auf mich. Ich spürte die lauten Schläge meines Herzens. Mit den Worten des Fischers bestätigte sich die drohende Gefahr, die sich bisher nur mir allein offenbart hatte.
Ich sprach zu ihm, mit trockenem Mund:
»Dein Sohn war das erste Opfer eines Angriffs, der nur wenige von uns verschonen wird. Halten wir sein Andenken in Ehren!«
Ich ordnete an, dass dem Mann der Verlust seines Bootes ersetzt wurde, und suchte mein Gemach auf, wo Miwa auf mich wartete. Sie hatte das Jammern des Fischers gehört. Ich sagte: »Leg meine Waffen bereit!«, und vor Erregung klang meine Stimme hart, sodass Tränen in Miwas Augen schimmerten.
»Kleine Herrin! Du solltest nicht dein Leben aufs Spiel setzen!«
Doch ich erwiderte ruhig: »Mein Platz ist an der Seite der Königin!«
Da verbarg Miwa ihre Tränen. Ihr Gesicht wurde ernst und feierlich. Sie schob eine Truhe aus poliertem Tannenholz in die Mitte des Zimmers. Mit zitternden Fingern öffnete sie das Vorhängeschloss. Die Fackel qualmte in der Zugluft, als sie schweigend meinen Helm aus gestepptem Leder und die ebenfalls lederne Rüstung sowie Köcher und Bogen aus Birkenholz auf die Matte niederlegte. Die Pfeile waren bereit: Es waren zwölf, von mir selbst sorgfältig geschnitzt und befiedert. Ich ließ die kleinen Eisenspitzen über die Hand gleiten; ja, die Pfeile waren tauglich und würden ihr Ziel nicht verfehlen.