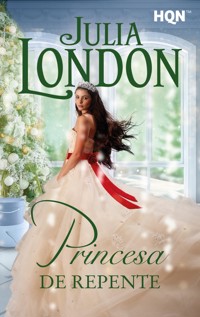Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Kisses
- Sprache: Deutsch
Gefangen im Sturm der Gefühle: Der historische Liebesroman »In den Händen des Earls« von Bestsellerautorin Julia London jetzt als eBook bei dotbooks. London 1822. Nach dem Tod ihrer Eltern bleibt Phoebe Fairchild als letzte Rettung vor der Armut nur ihr Talent für das Schneidern exquisiter Kleider. Doch Arbeit ist für eine junge Lady verpönt, ihre wahre Identität muss Phoebe stets geheim halten. So führt sie ein bescheidenes, aber glückliches Leben – bis William Darby, der Earl von Summerfield, bei einem Auftrag hinter Phoebes Geheimnis kommt. Kurzerhand macht er ihr ein verwegenes Angebot, das sie empört zurückweist – das hält William jedoch nicht davon ab, ihr einen Kuss zu rauben. Ein Kuss, aus dem der Stoff von Träumen gemacht scheint … Wird Phoebe gegen alle Widerstände ihrem Herzen folgen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die historische Romanze »In den Händen des Earls« von New-York-Times-Bestsellerautorin Julia London – Band 3 der »Regency Kisses«-Trilogie um die Fairchild-Schwestern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
London 1822. Nach dem Tod ihrer Eltern bleibt Phoebe Fairchild als letzte Rettung vor der Armut nur ihr Talent für das Schneidern exquisiter Kleider. Doch Arbeit ist für eine junge Lady verpönt, ihre wahre Identität muss Phoebe stets geheim halten. So führt sie ein bescheidenes, aber glückliches Leben – bis William Darby, der Earl von Summerfield, bei einem Auftrag hinter Phoebes Geheimnis kommt. Kurzerhand macht er ihr ein verwegenes Angebot, das sie empört zurückweist – das hält William jedoch nicht davon ab, ihr einen Kuss zu rauben. Ein Kuss, aus dem der Stoff von Träumen gemacht scheint … Wird Phoebe gegen alle Widerstände ihrem Herzen folgen?
Über die Autorin:
Julia London ist eine »New York Times«- und »USA Today«-Bestsellerautorin, bisher hat sie mehr als 30 Romane veröffentlicht. Aufgewachsen in Texas, hat die passionierte Hundebesitzerin viele Jahre in Washington für die amerikanische Regierung gearbeitet. Als sie ihre Liebe zum Schreiben entdeckte, machte sie diese zum Hauptberuf und schreibt seitdem erfolgreich historische Liebesromane sowie Contemporary Romance. Julia London erhielt bereits den »Romantic Times Book Club Award« für den besten historischen Liebesroman und war sechs Mal unter den Finalisten für den begehrten »RITA Award«. Heute lebt sie wieder in Texas.
Mehr Informationen zu Julia London finden Sie unter julialondon.com.
Julia London veröffentlichte bei dotbooks in der »Regency Kisses«-Trilogie auch:
»In den Fesseln des Dukes«
»Gefangen von einem Lord«
Außerdem erschien bei dotbooks ihre »Lockhart Clan«-Trilogie:
»Highland Passion – Fieber der Leidenschaft«
»Highland Passion – Sturm der Sehnsucht«
»Highland Passion – Fesseln des Verlangens«
***
eBook-Neuausgabe Juni 2020
Dieses Buch erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »The Dangers of Deceiving a Viscount« bei Pocket Books/Simon & Schuster, Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Fürst meines Herzens« bei Weltbild
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2007 by Dinah Dinwiddie
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 by Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © Period Images © shutterstock / Radek Sturgolewski / Willy Barton / alex-popov / Anastasiia Veretennikova
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-273-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »In den Händen des Earls« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julia London
In den Händen des Earls
Regency Kisses – Band 3
Aus dem Amerikanischen von Margarethe van Pée
dotbooks.
Für meine Mutter; die mich lehrte zu träumen. Für meinen Vater, der mich lehrte, meine Träume wahr werden zu lassen.
Für meine Stieffamilie, die mich unterstützt hat, als ob ich schon immer dazugehört hätte.
Prolog
Bedfordshire, England 1822
Die letzte Meile nach Wentworth Hall ritt William Darby, Viscount Summerfield, Baron Ivers, so schnell er konnte. Der Brief, den der Sekretär seines Vaters an ihn geschrieben hatte, steckte in seiner Brusttasche, rot vom Sand der ägyptischen Wüste, salzverkrustet von der Überfahrt des Mittelmeers und abgegriffen an den Kanten, weil Will ihn so häufig gelesen hatte.
Der Earl hat einen schweren Schlaganfall erlitten, der ihn gelähmt hat. Ihr werdet zu Hause gebraucht, Sir.
In den sechs Jahren, seit Will Wentworth Hall verlassen hatte, um zu reisen – eine Reise, zu der sein Vater ihn mit zweiundzwanzig Jahren gedrängt hatte, bevor er Pflichten und Verantwortung übernehmen musste –, hatte er zahlreiche Briefe von seinem Vater erhalten. In den ersten Briefen hatte der Earl sich über Wills Abenteuer und Besichtigungen gefreut, über die er jede Woche nach Hause berichtete. Die Rundreise sollte zwei Jahre dauern und eigentlich nur durch Europa gehen, aber statt anschließend nach Hause zu kommen, wie es von ihm erwartet wurde, war Will nach Indien gereist. Danach hatte sich der Ton in den Briefen seines Vaters geändert. Der Earl genoss zwar immer noch die Reiseschilderungen in Wills Briefen, erinnerte seinen Sohn aber häufig an seine Verantwortung seiner Familie gegenüber als der zukünftige Earl of Bedford und bat ihn, nach Hause zu kommen.
Will antwortete, ja, er würde nach Hause kommen, und er meinte das auch aufrichtig, aber dann begegnete er unweigerlich irgendeinem Mitreisenden, der ihm etwas vom Himalaya oder den Schätzen in einer afrikanischen Oase erzählte, und Will konnte nicht widerstehen.
In den letzten beiden Jahren waren die Bitten des Vaters inständiger geworden, Will sollte nach Hause kommen und heiraten, um einen Erben hervorzubringen, bevor es zu spät war. Es war der sehnlichste Wunsch seines Vaters, einen Enkel im Arm zu halten. Will war zuversichtlich, ihm diesen Wunsch erfüllen zu können, aber er glaubte, noch reichlich Zeit zu haben.
Und dann war der Brief von Mr Carsdale, dem Sekretär seines Vaters, gekommen. Er war Will in einem Beduinenzelt überreicht worden, von Addison, seinem treuen Kammerdiener, der jetzt im achtzehnten Jahr bei ihm war und mit ihm die ganze Welt bereist hatte, ob es ihm nun gefiel oder nicht. Addison war mit einer Beduinenkarawane aus Kairo gekommen, eine kaffiyeh um den Kopf gewickelt, und Augen und Kleidung gerötet vom Sand. Als Will den Brief las, kam es ihm so vor, als ob sich die Worte unter dem Gewicht ihrer Aussage tief in das Pergamentpapier eindrückten.
Natürlich war er sofort aus Ägypten abgereist. Er hatte eine Passage auf einem Schiff gebucht, das bei stürmischer See durch die Straße von Gibraltar segelte, was ihn beinahe das Leben kostete, als der Frachter Schiffbruch erlitt. Drei Monate hatte es gedauert, bis er endlich die Küste von England erreicht hatte. Eine weitere Woche verging damit, dass er sich ein Pferd kaufte und dafür sorgte, dass Addison mit seinem Gepäck nach Wentworth Hall transportiert wurde. Und schließlich ritt er noch eine Woche lang durch die regennasse englische Landschaft.
Schließlich gelangten Will und Fergus – das Welsh Pony, das er sich zugelegt hatte – auf den Weg zu dem majestätischen Schloss, in dem schon seit Jahrhunderten seine Vorfahren gelebt hatten. Der Anblick des Schlosses wärmte sein Herz. Es war in H-Form gebaut und vier Stockwerke hoch. Efeu wuchs an den Ecken, und Reihe um Reihe hoher Fenster mit Fensterläden blickte hinaus auf den Wald, den Wildpark und die Weiden, auf denen Schafe und Rinder grasten.
Es überraschte ihn, dass ihm kein Lakai oder Pferdeknecht entgegengelaufen kam, als er sein Pferd vor dem Schloss zügelte. Er schwang sich von Fergus, schob den Umhang über die Schulter zurück und nahm den Brief aus der Tasche. Dann eilte er die Stufen zur Eingangstür hinauf und trat ein.
Die Halle war leer. Völlig leer – es standen auch keine Möbel darin. Das Einzige, was noch geblieben war, waren die großen Gemälde mythischer Szenen, die eine ganze Wand einnahmen. Rasch eilte Will die Treppe zu den Familienräumen im ersten Stock empor. Aber auf der letzten Stufe blieb er stehen. Ein zerbrochener Stuhl lag auf dem Gang. Papiere waren über den Teppich verstreut, als hätte der Wind sie dorthin geblasen. Einer der Teppiche wies einen großen, schwarzen Brandfleck auf, und die Kerzen in den Wandhaltern waren nicht früh genug gelöscht worden, sodass das Wachs an den Seidentapeten hinunter auf die Teppiche getropft war.
Erstaunt ging Will weiter. Er schaute in jeden Raum und fand alle im gleichen Zustand. Es roch muffig, als sei lange nicht mehr gelüftet worden. Das Wohnzimmer war übersät mit Müll und Büchern und unerklärlicherweise sogar einem Paar Damenschuhen. Im Empfangssalon waren die Möbel an die Wand gerückt worden, und es sah so aus, als habe gerade ein Kegelspiel stattgefunden. Überall auf dem Fußboden lagen Bälle, und eine große Porzellanvase war in tausend Scherben zersprungen.
Zum Schluss kam er in die Bibliothek. Überall waren Bücher aus den Regalen gerissen und auf dem Boden aufgestapelt.
Will blickte sich langsam um und versuchte, sich einen Reim darauf zu machen. Als er sich dem Kamin näherte, vor dem ein Berg von Decken lag, erhob sich eine Frau von der Chaiselongue. Es war eine junge Frau, die er anscheinend aufgeweckt hatte. Blinzelnd schaute sie ihn an. Ihr Kleid war ihr zu klein und sah sehr schäbig aus. Ihre Haare hatte sie ungeschickt hochgesteckt, und in ihrem blassen Gesicht waren die blauen Augen der einzige Farbfleck. Aber sie kam ihm bekannt vor, und er fragte ungläubig: »Alice?«
Die Frau antwortete nicht, aber er war sicher, dass es seine Schwester war, die vor ihm stand. Als er weggegangen war, war sie elf gewesen, ein dünnes, kleines Ding, das ihm auf Schritt und Tritt folgte und ihn mit endlosen Fragen behelligte oder bettelte, dass er mit ihr ausritt oder im Garten mit ihr spielte.
»Wer ist da?«, verlangte eine raue männliche Stimme zu wissen.
Will dämmerte es, dass der Haufen Decken vor dem Kamin anscheinend eine weitere Person war, die sich jetzt auf die Ellbogen stemmte, dabei ein leeres Glas umwarf und in Wills Richtung blickte.
»Ich glaube, es ist unser Bruder«, sagte Alice unsicher und starrte Will neugierig an.
»Wer?«, fragte der junge Mann und erhob sich, was offensichtlich kein leichtes Unterfangen war. Seine Hemdzipfel hingen ihm bis zu den Knien, seine Hose war staubbedeckt und der Rest seiner Kleidung war wohl unter dem Stapel Decken verborgen. Seine Haare waren zerzaust, und er war unrasiert.
»Joshua«, sagte Will. Sein Bruder war ihm im Alter am nächsten. Er war vierzehn gewesen, als er gegangen war. »Erkennst du mich nicht mehr?«
»Will! Was machst du hier?« Joshua musterte ihn. »Wer hat dich denn hierher geholt?«
»Habt ihr meine Briefe nicht bekommen?«, fragte Will und trat vorsichtig näher. »Wo sind denn alle? Wo sind die Dienstboten?«
Joshua schnaubte. »Weg. Sie sind seit einer Ewigkeit nicht mehr bezahlt worden. Nur Farley und die Köchin sind noch da.«
»Und Jacobs, der Lakai, der Vater pflegt«, warf Alice ein. Sie hatte verlegen die Arme vor der Brust verschränkt. »Willst du hierbleiben?«
»Das willst du ganz bestimmt nicht«, erklärte Joshua. Er machte einen unsicheren Schritt vorwärts und stieß dabei eine Flasche mit bernsteinfarbener Flüssigkeit um, die rasch in den Bodendielen und den Decken versickerte. Weder er noch Alice schienen davon Notiz zu nehmen.
Irgendetwas stimmte hier nicht. »Wo ist Vater?«, fragte Will. Plötzlich stieg Panik in ihm auf.
»Vater? Wo soll er schon sein?«, erwiderte Joshua. »In seinen Gemächern natürlich.«
Will wagte nicht, nach seinen beiden jüngsten Geschwistern, Roger und Jane, zu fragen. Er drehte sich einfach um und eilte zu den Räumen seines Vaters. Mit jedem hastigen Schritt wurde ihm sein Verbrechen immer deutlicher bewusst. Er war zu lange weggewesen.
Er klopfte an die Tür zu den Räumen seines Vaters und wollte sie gerade aufmachen, als sie von der anderen Seite einen Spalt geöffnet wurde. Ein Bär von einem Mann in Hemdsärmeln und Weste musterte Will argwöhnisch. »Wer seid Ihr denn?«
»Ich bin Summerfield, der Sohn des Earls. Wo ist mein Vater?«
Die Augen des Mannes weiteten sich, aber er machte die Tür ganz auf. Zugleich verneigte er sich. »Dort, Mylord«, sagte er.
Will rauschte an ihm vorbei. Im Raum roch es nach Salben und Rauch; die Vorhänge waren zugezogen, bis auf ein Fenster, durch das ein wenig Licht fiel. Es war jedoch hell genug, dass er seinen Vater sehen konnte. »Du lieber Himmel«, murmelte er entsetzt.
Sein Vater saß in einem Rollstuhl. Jemand hatte eine Decke über seine Beine gebreitet, und seine Hände, offensichtlich nutzlos, lagen gefaltet in seinem Schoß. Sein Kopf war unnatürlich auf eine Seite gesunken.
Aber als Will näher trat, hob der Earl of Bedford den Blick, und in seinen trüben grauen Augen sah Will Erkennen schimmern.
»Papa«, sagte Will. Der Earl bewegte die Lippen, aber es kam kein Ton heraus, und Will merkte, dass er nicht sprechen konnte. Der Kummer ließ ihn fast zusammenbrechen. Er sank auf die Knie und drückte seinen Kopf an die knochigen Beine seines Vaters. Er war zu lange weggeblieben, und dafür gab es keine Entschuldigung.
Keine einzige Entschuldigung.
Kapitel 1
London, drei Monate später
Im Hinterzimmer des eleganten Geschäfts auf der Bond Street, in Mrs Ramseys Haute Couture Dress Shoppe, stand Lady Phoebe Fairchild zwischen Dutzenden von Kleidern aus chinesischer Seide, Samt, Satin und Musselin und starrte ungläubig Mrs Ramsey an, die ihr in aller Ruhe erklärte, dass ihre Reputation, die Zukunft ihres Kleidergeschäfts und ihr Lebensunterhalt davon abhingen, dass Phoebe für sie Kleider nähte.
Als die große, klapperdürre Frau ihre Ausführungen beendet hatte, war Phoebe wie vom Donner gerührt. Ihr fiel nichts mehr ein.
»Wenn Ihr meinen Wünschen nicht Folge leisten könnt, Lady Phoebe«, fügte Mrs Ramsey hinzu, »habe ich keine andere Wahl, als Euch vor der gesamten ton bloßzustellen.«
Phoebe keuchte auf. »Madam, was Ihr da vorhabt, ist Erpressung!«
Mrs Ramsey verzog die dünnen Lippen zu einem Lächeln. »Erpressung ist ein hartes Wort. Scharlatan, Betrüger … das sind allerdings Wörter, die nicht hart genug sind … Madame Dupree.« Sie zog die Augenbrauen hoch.
Phoebe konnte keinen klaren Gedanken fassen. Das Geschäft mit dem Nähen von Kleidern – das Mrs Ramsey jetzt drohte, auffliegen zu lassen –, war ein Plan, den Phoebe mit ihrer Schwester Ava und ihrer Cousine Greer vor zwei Jahren ausgeheckt hatte. Er war aus der Verzweiflung entstanden, da Phoebes und Avas Mutter, Lady Downey, plötzlich und viel zu früh verstorben war. Ihr Stiefvater, Lord Downey, hatte ihnen ihr Erbe vorenthalten und ihnen zu verstehen gegeben, dass er sie so schnell wie möglich an die erstbesten Männer verheiraten würde, die um ihre Hand anhielten. Daraufhin hatten die drei eilig einen Plan entworfen, wie sie diesem Schicksal entgehen konnten. Ava hatte beschlossen, reich zu heiraten, Greer hatte sich auf die Suche nach einer Erbschaft gemacht und Phoebe … nun, Phoebe konnte gut mit Nadel und Faden umgehen. Es war das Einzige, was sie zu bieten hatte.
Kleider zu schneidern oder zu verschönern war immer schon ihr Hobby gewesen, als sie es sich noch leisten konnten, in den exklusiven Läden in der Bond Street einzukaufen. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte Phoebe die Kleider ihrer Mutter in hübsche Ballkleider umgeändert und versucht, sie zu verkaufen.
Es gab nur ein kleines Problem: Wenn sie ein Geschäft eröffnet hätte, hätte die gesamte ton mitbekommen, dass sie Geldsorgen hatte, und dann hätte niemand mehr etwas mit ihr zu tun haben wollen, geschweige denn um ihre Hand angehalten.
Also hatten sie eine zurückgezogen lebende Modistin erfunden – Madame Dupree – und hatten ihre Kleider Mrs Ramsey präsentiert. Sie hatten behauptet, besagte Modistin sei in Frankreich sehr gefragt, aber seit einem Kutschenunfall leider lahm und entstellt, und könne und wolle sich deshalb nicht unter Menschen begeben. Phoebe hatte sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, als Vermittlerin zwischen Mrs Ramsey und Madame Dupree zu agieren. Mrs Ramsey brauche nur die konkreten Wünsche ihrer Kundinnen weiterzugeben, und dann könne Madame Dupree ihnen unvergleichlich schöne Kleider schneidern.
Es schien die perfekte List zu sein, und es hatte ja auch zwei Jahre lang sehr gut funktioniert.
Bis heute.
Bis heute hatte Phoebe keine Ahnung gehabt, dass Mrs Ramsey sie überhaupt im Verdacht hatte, Madame Dupree zu sein. Anscheinend jedoch hatte sie es schon seit einiger Zeit vermutet, denn als Phoebe heute Nachmittag zwei Kleider abgeliefert hatte, hatte Mrs Ramsey die Tür des Ladens abgeschlossen und Phoebe gebeten, ein Treffen mit Madame Dupree zu arrangieren.
Eine dunkle Vorahnung hatte Phoebe beschlichen. »Oh, das tut mir sehr leid, Mrs Ramsey, aber ich fürchte, das wird nicht möglich sein«, sagte sie so liebenswürdig wie möglich.
»Nach all dieser Zeit?«, entgegnete Mrs Ramsey von oben herab. »Sie vertraut mir doch mittlerweile sicher, Lady Phoebe. Ich habe ihr einen sehr lukrativen Vorschlag zu machen – und Euch akzeptiert sie doch auch. Warum eigentlich?«
Phoebe war so verblüfft gewesen, dass ihr keine Antwort einfiel. Mrs Ramsey war immer äußerst höflich gewesen – aber jetzt verschränkte die Frau ihre dürren Arme vor ihrem jämmerlich flachen Busen, kniff die Augen zusammen und sagte: »Ich weiß sehr wohl, was Ihr da tut, und ich bin durchaus darauf vorbereitet, der Welt von Eurem Skandal zu erzählen.«
»Was ich tue?«, erwiderte Phoebe mit verzweifeltem Lachen. »Ich versichere Euch, ich tue gar nichts, als Euch die zwei Kleider zu überbringen, die Ihr bei Madame Dupree in Auftrag gegeben habt.«
»Und wo kauft Madame Dupree den Stoff, den sie für diese Kleider braucht? Oder tut Ihr das ebenfalls für die arme, entstellte Person?«
Phoebe konnte jämmerlich schlecht lügen, und es war immer schlimmer geworden, bis Mrs Ramsey ihr schließlich ein Ultimatum gestellt hatte: Entweder würde Phoebe den Auftrag annehmen, den sie gerade von einem Lord Summerfield of Bedfordshire für eine unglaubliche Vielzahl von Kleidern und anderen Bekleidungsstücken entgegengenommen hatte, oder sie, Mrs Ramsey, würde Phoebes Betrug vor aller Welt aufdecken.
Anscheinend war dieser Lord Summerfield – ein Name, den Phoebe noch nie gehört hatte – der Sohn des kranken Earl of Bedford. Er war erst kürzlich aus dem Ausland zurückgekehrt und hatte feststellen müssen, dass seine Schwestern nicht ordnungsgemäß in die Gesellschaft eingeführt worden waren. Zu diesem Zweck hatte er für beide neue Garderoben geordert. Wenn sie bis zum Spätherbst fertig waren, war er bereit, eine Prämie von zweitausend Pfund zu zahlen.
Zweitausend Pfund.
Mrs Ramsey sabberte beinahe vor Gier, als sie von dieser Summe berichtete, und sie machte nur zu deutlich, dass sie nicht daran dachte, darauf zu verzichten, nur weil Phoebe Madame Dupree erfunden hatte, obwohl doch in Wirklichkeit sie hinter all den Kleidern steckte, ohne die die Damen der ton auf einmal nicht mehr leben konnten. Mrs Ramsey hatte Lord Summerfield bereits versprochen, dass sie Madame Dupree in vierzehn Tagen nach Wentworth Hall schicken würde, damit sie dort die Kleidungsstücke fertigte, die im Laden nicht vorrätig waren. Dabei war ihr einziges Problem natürlich, dass es Madame Dupree gar nicht gab.
Phoebe weigerte sich jedoch, als Schneiderin nach Bedfordshire zu reisen.
»Ach ja?«, knurrte Mrs Ramsey. »Ich glaube nicht, dass Eure werte Familie gerade jetzt einen solchen Skandal besonders schätzen würde – was meint Ihr, Lady Phoebe?«
Phoebe keuchte auf. Mrs Ramsey bezog sich natürlich auf genau die Sache, die Ava und Greer am meisten gefürchtet hatten, als sie versucht hatten, Phoebe zu überreden, die Kleiderproduktion einzustellen. Da sie jetzt beide mit überaus wohlhabenden Männern verheiratet waren, brauchten sie das Geld nicht mehr, das Phoebes geheime Tätigkeit ihnen eingebracht hatte. Vor allem jetzt nicht, da ihre adeligen Ehemänner, Middleton und Radnor, dafür sorgen wollten, dass über die wohltätige Stiftung ihrer Frauen, die Ladies’ Beneficent Society, Frauen, die gezwungen waren, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen, in den Genuss von Reformen und Rechten kamen. Es gab allerdings auch erbitterte Gegner dieser Politik, die befürchteten, dass durch solche Maßnahmen anderen unhaltbaren Freiheiten, wie zum Beispiel dem Stimmrecht für Frauen, Tür und Tor geöffnet würde.
Wenn Phoebes Betrug herauskäme, würde das ihren Schwägern und ihrem Versuch, die Reformen im Parlament durchzusetzen, schaden.
»Das wagt Ihr nicht!«, rief Phoebe. »Ihr seid doch eine Kauffrau, Mrs Ramsey! Gerade Euch nützen doch solche Reformen!«
»Aber ich kann zweitausend Pfund an Provision verdienen«, erwiderte die Frau. »So viel verdiene ich in einem ganzen Jahr!«
Phoebe erkannte Mrs Ramsey nicht mehr wieder. Sie war der Teufel, und es fehlte nur noch, dass ihr Hörner vorne aus der Stirn gewachsen wären.
Phoebe hatte kürzlich das Haus ihres Stiefvaters verlassen und war zu ihrer Schwester Ava nach Middleton House gezogen. Nach einer schlaflos verbrachten Nacht schleppte sie sich in Avas Ankleidezimmer. Ava, jetzt Marchioness of Middleton, war dort mit ihrem neun Monate alten Sohn Jonathan. Phoebes Cousine Greer, seit Kurzem Lady Radnor und Princess of Powys, bewunderte ihr Patenkind.
Als die beiden Frauen die dunklen Ringe unter Phoebes Augen sahen und bemerkten, dass sie ihr Kleid schief zugeknöpft hatte, war ihnen sofort klar, dass etwas nicht stimmte.
Sie setzten sich alle drei auf den Fußboden, und während Jonathan fröhlich krähend von einer zur anderen krabbelte, erzählte Phoebe ihnen die traurige Wahrheit.
»Du armer Liebling!«, rief Greer, als Phoebe geendet hatte. »Das wird dieser bösen Frau schlecht bekommen! Mach dir keine Sorgen, Phoebe, wir helfen dir da schon heraus!«
Die letzte unverheiratete Tochter der verstorbenen Lady Downey – Phoebe war sich absolut sicher, dass man sie in der ton genau so nannte – bezweifelte das.
»Ich wusste, dass du ein gefährliches Spiel spielst!«, stöhnte Ava. »Wirklich, Phoebe, du lebst in einer Fantasiewelt und kannst dir nie vorstellen, dass aus der Fantasie auch mal Realität werden kann. Und was sollen wir jetzt tun?« Ava küsste das Füßchen ihres Sohnes. »Es wird einen schrecklichen Skandal geben. Manche in der ton warten doch nur auf so etwas! Und dann wird nicht mal mehr Lord Stanhope dich haben wollen.«
»Was?«, schrie Phoebe. »Ist das deine einzige Sorge?« Sie nahm Jonathan auf den Arm und vergrub ihr Gesicht an seinem Hals. »Ich habe dir mindestens schon ein Dutzend Mal gesagt, dass ich Stanhope nicht heiraten will.«
»Ja, aber es ist meine Pflicht als deine Schwester und Freundin, dir dabei zu helfen, die passende Partie zu finden, und ich nehme diese Pflicht sehr ernst.«
»Es ist wohl kaum deine Pflicht, und wirklich, Ava, auch dir sollte klar sein, dass eine Frau, die in vier Saisons noch keinen Antrag bekommen hat, ein hoffnungsloser Fall ist.«
»Vier!«, rief Greer aus. »Waren es wirklich schon so viele Saisons?«
»Ach was, vier«, sagte Ava. »In ihrer ersten Saison war sie die Jüngste von uns dreien und kam deshalb erst an dritter Stelle«, zählte sie auf. »In ihrer zweiten Saison starb Mama, und wir waren in Trauer. In der dritten Saison hatten wir kein Geld, um sie in die Gesellschaft einzuführen …«
»Ganz zu schweigen von dem Skandal, den du verursacht hast, weil du dir den Marquis in den Kopf gesetzt hattest«, erinnerte Phoebe sie.
»Ja, der Skandal«, sagte Ava fröhlich. »Und in der vierten Saison folgte Greer meinem skandalösen Weg und kam zur Überraschung aller als Ehefrau des menschenscheuen Prinzen von Powys nach London zurück, und ich brachte meinen süßen, kleinen Jungen zur Welt.« Sie lächelte ihr Kind liebevoll an.
»Ja, das macht vier Saisons.« Greer nickte nachdenklich. »Erstaunlich. Gott sei Dank wird Stanhope ihr einen Antrag machen.«
»Warum? Weil ich sonst ein Ladenhüter werde?«, schnaubte Phoebe. »Ich wiederhole, ich werde seinen Antrag nicht annehmen, und ihr braucht gar nicht erst zu versuchen, mich zu überreden, nur weil er der beste Freund von Middleton ist. Er ist arm wie eine Kirchenmaus und auf der Suche nach einem Vermögen, nicht nach einer Ehefrau.« Sie gab Jonathan einen Kuss auf die Wange.
»Was erwartest du denn?«, fragte Ava. »Wie sollen wir denn eine Ehe für dich arrangieren, wenn du so selten ausgehst?«
»Das stimmt doch gar nicht!« Aber Phoebe wusste genau, dass ihre Schwester recht hatte. Die Londoner Gesellschaft bedeutete ihr nichts. Schon als Kind in Bingley Hall war Phoebe damit zufrieden gewesen, wenn sie zeichnen und ihre ersten Nähversuche machen konnte. Sie hatte Dutzende schlecht genähter und gesäumter Retiküls für ihre Mutter produziert, die diese aber voller Stolz getragen hatte, wenn sie die gesellschaftlichen Pflichten erfüllte, bei denen Ava und Greer sie schon damals so gerne begleiteten.
Natürlich war ihre erste Saison aufregend gewesen, aber im Großen und Ganzen fand Phoebe die Routine langweilig und ermüdend. Viele ledige Gentlemen schienen zu glauben, allein schon deshalb begehrte Partien zu sein, weil sie Junggesellen waren, und sie brauchte einen nur freundlich anzulächeln, und schon verbreitete sich wie ein Lauffeuer das Gerücht, Lady Phoebe Fairchild wolle diesen oder jenen Herrn heiraten.
Und je älter sie wurde – mittlerweile war sie schon zweiundzwanzig –, desto mehr langweilte es sie, mit Dutzenden von unverheirateten Debütantinnen in überladenen Salons herumzusitzen, die kein anderes Thema kannten als den Antrag, der ihnen unweigerlich gemacht werden musste.
»Du bist so schwierig!«, sagte Ava. »Du bist ungewöhnlich schön, viel schöner als ich – sieh nur deine hellblonden Haare. Und deine Augen sind von einem so strahlenden Blau. Und du siehst viel besser aus als Greer mit ihrem walisischen Blut …«
»Wie bitte?«, fiel Greer ihr ins Wort und strich sich über die tiefschwarzen Haare.
»Du siehst gut aus, Greer«, sagte Ava ungeduldig, »aber Phoebe galt doch immer schon als die attraktivste von uns. Also, ich glaube, wenn sie nur ein wenig fröhlicher auf die anderen zugehen würde, bekäme sie sofort mindestens ein halbes Dutzend Anträge!«
»Danke, Ava. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich so einen trübsinnigen Eindruck mache.«
»Du weißt ganz genau, was ich meine.«
»Nein, das weiß ich nicht. Und außerdem hat die Tatsache, ob ich mich in der Gesellschaft bewege oder nicht, wenig mit Mrs Ramseys Drohungen zu tun.«
»Da hat sie recht«, warf Greer ein. Sie reichte den plappernden Jonathan an seine strahlende Mutter weiter. »Aber was kann Mrs Ramsey schon anrichten? Wenn du mich fragst, nicht allzu viel.«
»Oh, doch, ich glaube, sie könnte ziemlichen Schaden anrichten«, erwiderte Phoebe trübsinnig. »Sie hat Aussicht auf eine Prämie von zweitausend Pfund, und sie ist absolut entschlossen, Summerfields Bestellung auszuführen, ganz gleich, was das für mich bedeutet.«
»Wer ist denn eigentlich Lord Summerfield?«, fragte Greer. »Ich habe noch nie von ihm gehört.«
Phoebe zuckte mit den Schultern. »Ich weiß auch nur, dass er in Bedfordshire auf Wentworth Hall wohnt. Die Familie hält sich wohl die meiste Zeit auf dem Land auf, und seine Schwestern sind noch nicht in die Gesellschaft eingeführt worden.«
»Erwartet Mrs Ramsey wirklich, dass Lady Phoebe Fairchild in dieses … in dieses Nest fährt und dort als Madame Dupree wie eine gewöhnliche Schneiderin Kleider näht?«, rief Ava.
»Ja, in der Tat«, erwiderte Phoebe ernst.
»Was für eine böse, gemeine Frau!«, erklärte Greer wütend.
Je länger sie über die Angelegenheit redeten, desto klarer wurde ihnen, dass es keinen Weg gab, Mrs Ramseys Forderung abzulehnen, wenn sie Phoebes Ruf und der politischen Arbeit ihrer Ehemänner keinen Schaden zufügen wollten.
Aber wie sollte sie Mrs Ramsey zufriedenstellen, ohne ihr Geheimnis preiszugeben?, fragte sich Phoebe.
Zumindest musste sie ihre wahre Identität für sich behalten.
Die drei Frauen diskutierten hin und her und kamen schließlich zu dem Schluss, dass es ungefährlich sei, Phoebe unter falschem Namen nach Bedfordshire reisen zu lassen. Da das Parlament in der Sommerpause war, flohen alle vor der Hitze in London aufs Land und kamen erst im Spätherbst zurück, wenn das Parlament für eine kurze Saison wieder tagte.
In Bedfordshire würde sich bestimmt niemand aufhalten, den sie kannten. Im ganzen Bezirk gab es höchstens drei Personen, die Phoebe möglicherweise kennen konnten, aber auch ihnen war sie noch nie formell vorgestellt worden.
Der Erste war der alte Earl of Huntingdon, der jedoch den Berichten zufolge zu krank war, um Besuche zu empfangen. Die Familie Russell lebte in Wobburn Abbey, aber sie war den Sommer über in Frankreich. Und schließlich gab es noch die berüchtigte Lady Holland, deren Partys in London legendär waren. Sie hatte ein Haus in Bedfordshire, aber Ava hatte von Lady Purnam gehört – einer Freundin ihrer verstorbenen Mutter, die sich in alles einmischte –, dass Lady Holland sich bis zum Beginn der kleinen Saison in Eastbourne aufhalten würde.
Es bestand also kaum Gefahr, dass Phoebe in dieser verschlafenen Ecke Englands jemandem begegnen würde, den sie kannte. Damit blieb nur noch eine Hürde übrig – Phoebes Identität.
»Auf jeden Fall Witwe«, beharrte Ava.
»Wie ist ihr Mann gestorben?«, fragte Greer.
»Das weiß ich nicht«, erwiderte Ava achselzuckend. »Wie sterben Männer denn normalerweise? Vielleicht ist er vom Pferd gefallen oder so.«
»Ich glaube kaum, dass allzu viele Männer bei einem Sturz vom Pferd sterben«, entgegnete Greer trocken. »Eine auszehrende Krankheit vielleicht. Das dürfte die Fragen auf ein Minimum beschränken.« Die drei rümpften die Nase.
»Gut, und wo komme ich her?«, fragte Phoebe.
»Aus dem Hochmoor, nördlich von Newcastle«, sagte Greer sofort. »Da kommt sonst bestimmt niemand her. Die Gegend ist praktisch unbewohnbar.«
»Und du darfst nicht zu verträumt sein, Phoebe«, warnte Ava sie streng. »Wenn du in deinem Wolkenkuckucksheim bist, neigst du dazu, ein Spatzenhirn zu haben.«
»Entschuldige bitte, aber ich habe kein Spatzenhirn«, protestierte Phoebe.
»Nein, das vielleicht nicht, aber deine Tagträume trüben oft deinen gesunden Menschenverstand.«
»Das ist doch lächerlich! Das stimmt nicht!«
»Du hast auf jeden Fall eine lebhafte Fantasie«, warf Greer freundlich ein. »Und du musst Sorge tragen, dass sie nicht überhand nimmt. Konzentrier dich auf deine Arbeit und deine Verkleidung.«
Phoebe schnalzte mit der Zunge. »Bei den vielen Kleidern, die Mrs Ramsey von mir in dieser kurzen Zeit erwartet, werde ich kaum Zeit zum Schlafen haben, geschweige denn zum Träumen oder zum Reden. Was soll also schon schiefgehen?«
Kapitel 2
Die Stoffe, die Phoebe benötigte, wurden an einem sehr warmen Freitag, als der Geruch nach Kanalisation wie eine schmutzige Decke über ganz London lag, mit Maultierkarren vorausgeschickt. Am Montag darauf verließ Phoebe im Morgengrauen die Stadt, eingezwängt in einer öffentlichen Kutsche zwischen einem dicken Mann, der sich ständig die Schweißperlen von der Stirn tupfte, und einer Frau, deren Kopf immer wieder auf Phoebes Schulter fiel, wenn sie einnickte. Phoebe allerdings bekam unter diesen Umständen natürlich kein Auge zu.
So hatte sie sich das Ganze nicht vorgestellt. Sie hatte geglaubt, in einer Kutsche, umgeben von ihren Utensilien, alleine reisen zu können, eine mysteriöse, exotische Retterin, die zwei arme, junge Frauen mit ihren Kleidern verwandelte. Sie würden sie mit Ehrfurcht und Staunen ansehen, weil sie ihnen den Eintritt in die Gesellschaft ermöglichte. Und weil sie in den Kleidern, die sie ihnen nähte, so gut aussahen, hätte Madame Dupree auch noch ein wohltätiges Werk vollbracht.
Aber dass sie zusammengepfercht mit anderen Reisenden in einer überfüllten Kutsche reisen musste, hatte sie nicht vorausgesehen.
Nach zwölf mühsamen Stunden erreichte Phoebe Greenhill, ein pittoreskes Örtchen mit strohgedeckten, weiß getünchten Cottages, einem Dorfanger und einer Hauptstraße, die vom Duft der Sommerblumen erfüllt war, die in den Blumenkästen vor den Fenstern blühten. Es roch betörend nach Jasmin – ein hübscher, idyllischer Ort, wie ihn sich Phoebe oft erträumt hatte. Sofort regten sich ihre Lebensgeister – jetzt konnte sie sich vorstellen, wie sie jeden Morgen die Blumen pflegte, die vor ihrem Häuschen wuchsen. Danach würde sie lesen oder nähen – was ihr Herz begehrte. Ava und Greer würden von London zu Besuch kommen, und sie würden … Nein. Kein Cottage, sie würde etwas Größeres brauchen. Und zumindest einen Bediensteten.
Nichtsdestotrotz freute sie sich darüber, in diesem hübschen kleinen Ort angekommen zu sein. Sie war angewiesen worden, auf eine Kutsche aus Wentworth Hall zu warten.
Steif von der langen Fahrt, drückte Phoebe sich die Hand auf den Rücken und reckte sich.
»Madame Dupree?«
Sie wirbelte herum und sah einen kleinen Mann vor sich stehen, der ihr gerade bis zur Schulter reichte. Er war untadelig gekleidet, und als er seinen Hut zog, enthüllte er ein Paar ungewöhnlich spitze Ohren. »Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen, Madam. Ich bin Mr Addison. Man hat mich aus Wentworth Hall geschickt, um sie abzuholen.« Er verbeugte sich so tief, dass Phoebe eine runde, kahle Stelle auf seinem Hinterkopf sehen konnte. »Verzeiht, dass mein Französisch mangelhaft ist, aber wenn ich so sagen darf, Enchante, Madame.«
»Oh, danke«, antwortete Phoebe auf Englisch. Sie hatte nicht erwartet, dass jemand Französisch mit ihr sprechen würde. »Aber ich bin Engländerin, Sir.« Mr Addison blickte sie überrascht an. »Mein Gatte war Franzose.«
»Ah. Sehr gut, Madam.« Mr Addison verbeugte sich erneut. »Wenn Ihr mir folgen wollt, der Wagen steht gleich hier.«
Wagen?
Er wies auf ihre Truhe; ein junger Mann hob sie auf die Schultern und zwinkerte Phoebe dabei zu.
»Hier entlang«, sagte Mr Addison und ging rasch um die Ecke.
Phoebe folgte ihm.
Die beiden Männer nahmen sie auf dem Bock des Wagens zwischen sich, und während sie nach Wentworth Hall fuhren, zeigte Mr Addison ihr die Sehenswürdigkeiten. Phoebe fand die Landschaft wunderschön, vor allem im weichen Licht der einbrechenden Dämmerung. Gelber Raps bedeckte die Felder. Auf den Hügeln dahinter weideten Schafe und Rinder, und als sie sich dem Wald näherten, wies Mr Addison sie auf sieben oder acht Pferde hin, die neben einem verfallenen Cottage grasten. Als die Kutsche näher kam, galoppierten sie davon.
»Das sind Wildpferde«, erklärte Mr Addison. »Ab und zu kann man sie vom Schloss aus sehen, aber wenn man ihnen zu nahe kommt, laufen sie davon. Es ist noch niemandem gelungen, sie einzufangen.«
Wildpferde! Etwas Aufregenderes konnte sie sich kaum vorstellen! Und sie waren so schön – rötlichbraun, schlank und groß, mit weißen Fesseln. Ihre Mission hier wurde immer reizvoller. Madame Phoebe Dupree, Schneiderin eleganter Kleider und Wildpferd-Dompteuse!
Der Wagen fuhr an hohen schottischen Tannen vorbei, rumpelte über eine alte Steinbrücke, an einer Ruine vorbei und dann einen Hügel hinauf. Oben auf dem Hügel kam Wentworth Hall in Sicht, und Phoebe setzte sich aufrecht hin, damit ihr nichts entging.
Oh, es war ein prächtiges Schloss. Vier Stockwerke hoch mit mindestens einem Dutzend Schornsteinen, in einem üppigen, grünen Tal gelegen. Sie bogen um eine Ecke, fuhren durch ein Steintor mit einem Torhaus und gelangten zu der kreisförmigen Auffahrt, die um einen großen Brunnen und eine Rasenfläche, auf der zwei Pfauen pickten, angelegt war. In der Ferne sah sie einen Pavillon an einem kleinen See, auf dem Schwäne schwammen.
Es war ein idyllisches Bild, wie auf einem Landschaftsgemälde, und es erinnerte Phoebe an Bingley Hall, wo sie die glücklichste Zeit ihrer Kindheit verbracht hatte. Schon lange hatte sie die Hoffnung gehegt, eines Tages wieder auf dem Land wohnen zu können, mit Kindern, Haustieren und genügend Zeit, um zu zeichnen und zu malen.
»Die Darbys leben seit mehr als zweihundert Jahren auf Wentworth Hall. Es wurde Ende des sechzehnten Jahrhunderts für den ersten Earl of Bedford erbaut«, sagte Addison. »Er war ein Favorit von Königin Elizabeth.«
»Es ist sehr beeindruckend.«
»Seine Lordschaft ist gerade dabei, einige große Umbaumaßnahmen vorzunehmen«, erwiderte Mr Addison stolz. »Wenn er mit der Renovierung des Hauses fertig ist, wird es hier in dieser Gegend nichts Vergleichbares geben.«
Phoebes Fantasie ging mit ihr durch – sie sah sich als Herrin dieses prächtigen Schlosses, wie sie in einem Kleid mit Kristallen besetzt an der Tür stand und ihre Gäste begrüßte. Sie würde Bälle geben und zum Abendessen auf der Terrasse einladen. Vermutlich gab es doch eine Terrasse. Alle Schlösser hatten eine Terrasse.
Der Wagen hielt vor dem Haus. Mr Addison stieg aus und half Phoebe herunter. Kaum stand sie auf festem Boden, rumpelte der Wagen weiter, wobei er eine Staubwolke aufwirbelte. Hustend wedelte Phoebe den Staub von ihrem Gesicht.
»Bitte folgen Sie mir hier entlang, Madame Dupree«, sagte Mr Addison.
Phoebe blickte zum Schloss empor. Im Inneren würde es sicher voller schöner Gemälde, französischer Möbel und belgischer Teppiche sein. Ja, sie würde ihren Aufenthalt hier bestimmt genießen. In einer solchen Umgebung konnte sie wundervolle Kleider entwerfen.
Sie folgte Mr Addison, blieb aber erschrocken auf der breiten Steintreppe stehen, als ein schrecklicher Schrei ertönte, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Einen Moment später kam eine junge Frau aus dem Haus gerannt, die goldenen Haare hingen ihr offen über den Rücken, und ihr Kleid war an Knien und Schoß beschmutzt. »Das kostet dich deinen Kopf, Roger!«, schrie sie. »Ich spieße ihn am Tor auf! Will! Will!«, kreischte sie, als sie an Phoebe vorbeirannte.
Erschrocken beobachtete Phoebe, wie sich das Mädchen einem Reiter in den Weg warf, der in schnellem Tempo auf das Schloss zugaloppiert kam. Der Mann zügelte sein Pferd und fluchte, als er im letzten Moment ausweichen musste.
»Will! Du musst kommen!«, flehte das Mädchen, das anscheinend gar nicht merkte, was es für einen Aufruhr verursachte.
Der Reiter blickte kurz zu Phoebe und wandte seine Aufmerksamkeit dann wieder dem Mädchen zu. Geschmeidig glitt er vom Pferd, legte dem Mädchen seine große, behandschuhte Hand auf die Schulter und sagte etwas zu ihm.
Das Mädchen drehte sich zu Phoebe um. »Entschuldigung, Maam.«
Phoebe, die nicht wusste, wie sie reagieren sollte, knickste.
Der Mann legte seinen Arm um das Mädchen und trat zu Phoebe. Er war groß, fast einsneunzig, und seine Figur war muskulös und athletisch. Er schickte das Mädchen ins Haus und wandte sich dann an Addison. »Lasst die Post auf mein Zimmer bringen.«
»Jawohl, Sir. Erlaubt mir, Mylord, Euch die Schneiderin vorzustellen, Madame Dupree.«
Sein Blick glitt über Phoebe, und sie stellte fest, dass seine Augen eher grün als braun waren, mit goldenen Sprenkeln – Farben, die sie an den Herbst erinnerten. Er war elegant gekleidet – in eine perfekt sitzende Reitjacke, mit Halstuch und bestickter Weste und auf Hochglanz polierten Reitstiefeln. Er trug keinen Hut. Seine blonden Haare waren von der Sonne ausgebleicht, und sein glatt rasiertes Gesicht war gebräunt. Er war gekleidet wie die meisten Männer, aber er hatte doch etwas, was ihn von den anderen Männern, die Phoebe in London oder sonst wo kennengelernt hatte, unterschied.
Ihr stockte der Atem – er strahlte eine ungeheure Energie aus, und er wirkte männlich und völlig ungezähmt.
Sie bemühte sich, ihn nicht zu offensichtlich anzustarren, konnte aber den Blick kaum von ihm wenden.
Er nickte. »Wie geht es Euch?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, wandte er sich wieder seinem Pferd zu.
»Eigentlich, Mylord«, sagte Phoebe, »bin ich Modistin.« Addison riss die Augen auf, und seine spitzen Ohren färbten sich rot.
Summerfield drehte sich langsam zu ihr um und sagte: »Wie bitte?«
Phoebe lächelte strahlend. »Ich bin Modistin. Eine Schneiderin näht. Eine Modistin entwirft die Kleidungsstücke.« Er zog eine Augenbraue hoch, und Phoebe spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. »Das Wort hat französischen Ursprung.«
Jetzt wirkte Summerfield doch ein wenig überrascht. »Danke, dass Ihr mich daraufhinweist«, sagte er mit seiner tiefen Stimme, die einen leichten Akzent aufwies. »Das war mir nicht bewusst.«
»Das hätte ich auch nicht erwartet«, erwiderte Phoebe leichthin. »Das Wort wird nur in Bezug auf Frauen verwendet.«
»Ah«, sagte er und musterte sie erneut. »Willkommen in Wentworth Hall, Madame Dupree. Addison wird Euch zu Euren Räumen führen.« Er warf Addison einen Blick zu, dann trat er zu seinem Pferd und schwang sich hinauf.
Phoebe blickte ihm nach. Er hatte breite Schultern, und seine Schenkel schlossen sich eng um den Bauch des Tieres, das sofort in Galopp verfiel. Viel zu schnell war er verschwunden.
Addison räusperte sich, und Phoebe wurde rot, als sie merkte, dass sie Summerfield hinterhergestarrt hatte. »Hier entlang, bitte«, sagte der kleine Mann und führte sie ins Haus.
Mitten ins Chaos hinein.
Die Renovierungsarbeiten, von denen Addison gesprochen hatte, waren in vollem Gang. In der Halle waren Gerüste aufgebaut, weil die Decke gestrichen wurde. Der Marmorboden war abgedeckt. Addison stellte Phoebe dem Butler vor, Mr Farley, der Phoebe in ihre Unterkunft führte. Sie stiegen drei Stockwerke hinauf, und überall wurde gehämmert und gesägt und feiner Staub lag in der Luft.
Irgendwo in all diesem Lärm hörte Phoebe eine Tür knallen, und laute Stimmen ertönten.
Anscheinend hörte Mr Farley es auch, denn er beschleunigte seine Schritte und erhob seine Stimme.
»Im Ostflügel, wo die Familie residiert, sind die Umbauarbeiten abgeschlossen«, erklärte Farley, als sie vorsichtig an einer Leiter vorbeigingen. »Und Anfang nächsten Jahres wird wohl auch die Renovierung des Westflügels fertig sein.«
Sie waren an der letzten Treppe angelangt, die wesentlich schmaler war als die anderen. Phoebe vermutete, dass die Zimmer im letzten Stockwerk für die Dienstboten vorgesehen waren, zu denen sie in den nächsten sechs bis acht Wochen ebenfalls gehören würde.
Oben an der Treppe erstreckte sich eine Reihe geschlossener Türen nach rechts in den Gang hinein. Nach links waren nur zwei Türen. Farley zog einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete die erste Tür und hielt sie für sie auf.
Enttäuscht blickte Phoebe sich in dem Zimmer um. Es war nicht die Art von Unterkunft, die sie sich für eine französische Modistin vorgestellt hatte. Es war ein kleiner Schlafraum mit einem schmalen Bett in einer Ecke. Über dem Bett lag eine verblichene Tagesdecke. Es gab einen Ofen, eine Kommode und einen kleinen Schminktisch. Die Farbe blätterte von den Wänden, und die Holzdielen waren durchgebogen.
»Und das Atelier«, sagte Farley und öffnete eine Tapetentür, die in einen angrenzenden Raum führte.
Ihr Atelier war anscheinend seit längerer Zeit nicht benutzt worden, denn es war mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Im Zimmer lagen ein paar kaputte Möbel. Die Stoffe und Nähwerkzeuge, die Mrs Ramsey vorausgeschickt hatte, waren achtlos in eine Ecke geworfen worden. Allerdings hatte zumindest jemand so viel Geistesgegenwart besessen, ein Stück Segeltuch darunter zu legen, damit sie nicht mit dem schmutzigen Boden in Berührung kamen. Wie in dem anderen Zimmer blätterte auch hier die Farbe von den Wänden, und an der Decke war ein großer Wasserfleck.
Aber das Zimmer befand sich am Ende des Flügels vorne am Haus und verfügte über hohe Fenster an drei Wänden. Phoebe trat an eines der Fenster, um hinauszublicken. Sie sah den grünen Park und die vordere Auffahrt.
»Mrs Turner, die Haushälterin, bringt Euch morgen einen Eimer mit Wasser und Schmierseife sowie Aufnehmer und Schrubber«, teilte Farley ihr mit.
»Oh?«, erwiderte Phoebe verwirrt. »Meint Ihr …«
»In Kürze kommt ein Lakai und macht Feuer im Ofen«, fuhr Farley fort. Ganz offensichtlich meinte er, was Phoebe befürchtete – man erwartete von ihr, dass sie die Zimmer selbst reinigte. Er nickte höflich. »Wenn Ihr keine Fragen mehr habt?«
»Nein, danke«, sagte sie ein wenig aus der Fassung gebracht.
Er verbeugte sich und ging. Phoebe blieb einen Moment lang wie erstarrt stehen. Sie schloss die Augen und stellte sich eine berühmte Modistin in einem wundervoll eingerichteten Atelier vor. Seufzend öffnete sie die Augen wieder, zog ihre Handschuhe aus und warf sie auf einen kaputten Stuhl. Sie blickte sich um. Es würde viel Arbeit sein, dieses Zimmer in einen einigermaßen funktionalen Zustand zu bringen, dachte sie, und offensichtlich musste sie es alleine machen. Anscheinend würde sie ihre Fantasie ein wenig anpassen müssen.
Müßig trat sie an die Fenster, die nach Westen gingen, und blickte über die Landschaft. Es dämmerte bereits. Grüne Rasenflächen, ein riesiger Park und dahinter ein Wildgehege. Lächelnd blickte sie auf den Rasen vor dem Haus und stellte sich vor, wie sich das kühle Gras unter ihren bloßen Füßen anfühlen würde.
Aus dem Haus traten zwei Gestalten. Ein alter Mann mit dünnen weißen Haaren saß in einem Rollstuhl. Er war mit einer Decke zugedeckt, und seine Hände hatte er im Schoß gefaltet. Die Person, die den Rollstuhl auf den Rasen schob, war Summerfield – sie erkannte ihn an seiner Reitjacke.
Am Brunnen blieben sie stehen und beobachteten, wie die Sonne hinter dem Wald versank, bis es so dunkel war, dass Phoebe sie nicht mehr sehen konnte.
Kapitel 3
Niemand dachte daran, Phoebe etwas zu essen zu bringen, und da sie nicht daran gewöhnt war, selbst für sich zu sorgen, ging sie hungrig zu Bett.
Irgendwann in der Nacht wurde sie durch laute Stimmen geweckt, die durch den Kamin drangen. Erschrocken setzte sie sich auf und starrte in die Dunkelheit. An dem Streit waren mindestens zwei Männer beteiligt, und eine Frau weinte.
Der laute Streit machte ihr Angst. Sie zog sich die Decke bis zum Kinn und stopfte sich das Kissen um den Kopf, um nichts hören zu müssen, und versuchte zu schlafen.
Aber es war unmöglich – der Streit dauerte bis in die Morgenstunden, und als sie vom Hämmern der Handwerker geweckt wurde, hatte sie das Gefühl, kein Auge zugemacht zu haben.
Gereizt wusch sie sich und zog sich an. Es war noch so früh, dass die Morgennebel sich noch nicht gelichtet hatten. Wer arbeitete denn schon um eine so gottlose Uhrzeit? Und wie lange mochte es noch dauern, bis ihr jemand Wasser und Schmierseife brachte? Und etwas zu essen?
Vielleicht sollte sie ja ein wenig durch den Park spazieren. Sie ging gerne zu Fuß – es machte den Kopf klar. Wenn sie erst einmal mit ihrer Arbeit begonnen hatte, hatte sie wahrscheinlich keine Gelegenheit mehr dazu.
Phoebe ergriff ihren Schal und verließ ihr Zimmer.
Außer einem Lakaien, der Kohle nach oben brachte, schien noch niemand unterwegs zu sein. Draußen zog sie ihren Schal fester um sich und ging in die Richtung, in die der Viscount gestern geritten war. An einer Stelle gabelte sich der Weg – links führte er anscheinend zu den Stallungen, aber rechts durch ein großes Eisentor in einen weitläufigen französischen Garten.
Sie ging langsam, und die Schleppe ihres hellgelben Morgenkleids wurde feucht vom Tau. Der Weg führte durch ein weiteres Tor, hinter dem eine Rasenfläche lag. Um sie herum war es still. Es ging kein Lüftchen, und kein Geräusch war zu hören. Phoebe roch Wasser und Fische und bewegte sich in diese Richtung.
Das abrupte Schnauben eines Pferdes erschreckte sie, weil sie nicht sehen konnte, woher es kam. Sofort blieb sie stehen und versuchte, mit den Augen den Nebel zu durchdringen, aus dem plötzlich wie Geister Pferde auftauchten.
Erleichtert stieß Phoebe die Luft aus, blieb aber still stehen. Anscheinend waren es die wilden Pferde, die sie gestern gesehen hatte. Es waren prachtvolle Geschöpfe, groß und anmutig. Ruhig grasten sie direkt vor ihr.
Als Kind war Phoebe eine ausgezeichnete Reiterin gewesen. Jetzt hatte sie nur noch selten Gelegenheit dazu, aber sie fühlte sich zu Tieren hingezogen und hätte diese Pferde am liebsten gestreichelt. Sie stellte sich vor, wie sie auf dem Rücken des größten Wildpferdes über eine Sommerwiese ritt. Als könnte es Phoebes Gedanken lesen, stellte das Tier die Ohren auf und hob witternd den Kopf in ihre Richtung. Es wusste, dass sie da war, aber anscheinend stellte sie keine Bedrohung dar, weil der Hengst gleich wieder den Kopf senkte und weiter graste.
Phoebe machte einen Schritt vorwärts, zwei der Pferde galoppierten davon, aber der große, rötlichbraune Hengst blieb stehen. Sie hätte gerne seine seidige Mähne berührt, und impulsiv streckte sie die Hand aus.
Das Pferd ignorierte sie und wandte sogar den Kopf ab, als ob es sie gar nicht sähe.
Erneut wollte sie einen Schritt machen, aber als sie den Kopf wandte, sah sie, dass Summerfield nur ein paar Meter von ihr entfernt stand. Er hob einen Finger an die Lippen und bedeutete ihr, leise zu sein.
Phoebe nickte. Mit einer geschmeidigen Bewegung trat er auf sie zu und stellte sich hinter sie.
Wie es Phoebe gelang, keinen Laut von sich zu geben, grenzte schon an ein Wunder, denn sie konnte den Mann, der unschicklich dicht hinter ihr stand, deutlich spüren. Die Aufschläge seines Jacketts drückten sich an ihre Schulterblätter, und sein Bein an ihren Rock.
Ein Schauer durchrann sie, und sie begann zu zittern. Summerfield umfasste ihren Ellbogen und fuhr mit der Hand zu ihrem Handgelenk. Er schloss seine Finger darum und zog ihren Arm ein wenig hoch, mit der Handfläche nach oben.
Phoebe hätte beinahe vor Entzücken gekeucht. Die Haut auf ihrem Arm prickelte. Er legte ihr etwas in die Hand und schloss ihre Finger darum. Als seine Hand über ihr Handgelenk und ihren Puls glitt, schien er ihre Aufregung zu spüren, denn er legte ihr seinen anderen Arm um die Taille und hielt sie fest.
O Gott, sie spürte seinen harten Körper an ihrem, sein warmer Atem glitt über ihr Ohr, und ihr Blut rauschte. Sie blickte auf den Arm, den er ihr um die Taille geschlungen hatte – er hatte große Hände, und am Handgelenk hatte er ein seltsames Mal, eine dicke schwarze Linie, die sich aus dem Ärmel bog.
Summerfield hielt immer noch ihre Hand und machte mit ihr zusammen einen Schritt nach vorne.
Der Hengst hob den Kopf und blickte Phoebe an. Sie hielt ihm ihre Handfläche hin, zu fasziniert, um nachzuschauen, was überhaupt darin lag, und ihr Atem ging schneller, als das Tier den Kopf warf und einen Schritt auf sie zu machte. Summerfield zog sie fester an sich, und Phoebe wusste nicht mehr, was sie mehr erregte – dass dieser Mann, der nach Seife, Leder und Mann roch, sie festhielt, oder dass das riesige Wildpferd auf sie zukam.
Unwillkürlich schrak sie ein wenig zurück, als das Pferd vor ihr stand, aber Summerfield lockerte seinen Griff nicht, und das Tier nahm die Datteln, die auf Phoebes Handfläche lagen, auf. Ein Lachen stieg in Phoebe auf, und sie musste sich zusammenreißen, um nicht laut herauszuplatzen, so begeistert war sie.
Aber Summerfield dachte, sie würde vor Angst statt vor unterdrücktem Lachen beben. Beruhigend strich er ihr über den Arm und streckte die andere Hand nach dem Tier aus. Leider jedoch war der Hengst anscheinend nicht in der Stimmung, sich streicheln zu lassen. Er warf den Kopf zurück und trottete davon, vorbei an den zwei Tieren aus seiner Herde, die noch friedlich grasten. Sie folgten dem Hengst, und bald darauf waren sie im Nebel verschwunden.
Summerfield ließ sie jedoch immer noch nicht los. »Verzeiht mir meine Vertraulichkeit«, sagte er ihr leise ins Ohr. »Ich wollte nur verhindern, dass Euch etwas geschieht.« Dann ließ er seinen Arm sinken und trat einen Schritt zurück. In Phoebes Rücken wurde es auf einmal ganz kühl.
Als er ihr strahlendes Lächeln sah und hörte, wie sie vor Freude leise lachte, lächelte er plötzlich auch – ein warmes, überraschtes Lächeln, das zwei Grübchen in seinen Wangen und Lachfältchen um seine Augen zeigte. »Verzeiht – ich hielt irrtümlich Euer Zittern für Angst.«
»Ich bin nicht so ängstlich«, erwiderte Phoebe fröhlich. »Eigentlich macht mir nur wenig Angst«, fügte sie hinzu. »Nur Zigeuner manchmal. Bei ihnen bin ich mir nie sicher, ob sie nur tanzen oder stehlen wollen. Aber ein Pferd jagt mir ganz gewiss keine Angst ein.«
»Ach ja?«, erwiderte er amüsiert. »So furchtlos seid Ihr?«
»Mmm.« Sie blickte zu der Stelle, wo der Hengst gestanden hatte. »Er ist wunderschön«, sagte sie andächtig.
»Ja«, erwiderte Summerfield und ließ seinen Blick neugierig über sie gleiten. »Verzeiht mir, Madame Dupree, aber wenn wilde Hengste und tanzende Zigeuner Euch keine Angst machen, was dann, wenn ich fragen darf?«
Wilde, ungezähmte Männer die Männlichkeit und Kraft ausstrahlen.
Als sie nicht direkt antwortete, blickte er sie an. »Jage ich Euch Angst ein?«
Phoebe hatte das Gefühl, in diesen braungrünen Augen zu ertrinken. Sie konnte sich gut vorstellen, dass überall Frauen dahinschmolzen, wenn er sie nur anschaute. »Oh nein! Nicht im Geringsten …« Sie schwieg und warf ihm einen verschmitzten Blick zu. »Es sei denn … sollte ich Angst vor Euch haben?«
Lächelnd verzog er die Mundwinkel. »Das hängt vermutlich davon ab, was eine schöne junge Frau wie Ihr an einem Mann beängstigend findet.«
Um Gottes willen, er flirtete mit ihr. Ein albernes Flattern breitete sich in ihrem Bauch aus, und ihre Handflächen wurden feucht.
Er schien zu spüren, was sein Lächeln anrichtete, denn es wurde noch tiefer. »Ihr erinnert mich an meine Schwestern«, sagte er. »Ich glaube, sie haben auch vor nichts Angst – außer natürlich vor diebischen Zigeunern.« Sein Blick glitt über ihren Körper. »Vielleicht solltet Ihr Euch um ihre Kleider kümmern. Findet Ihr den Weg zurück zum Haus?«
»Ich … Ja«, erwiderte sie und nickte. »Ja, natürlich.«
»Sehr gut.« Er lächelte, fuhr sich mit der Hand an die Stirn, und wieder sah sie die seltsame schwarze Linie auf seinem Handgelenk. Dann ging er weiter, den Weg entlang, den die Pferde genommen hatten.
Phoebe blickte ihm nach, zog ihren Schal enger um sich und prägte sich seinen selbstbewussten Gang ein. Als er verschwunden war, seufzte sie.
»Ach, du lieber Himmel, Madame Dupree«, murmelte sie und wandte sich zögernd zum Haus zurück.
Ein paar Stunden später traf Will in Greenhill seinen Kindheitsfreund Henry Ellison. Als Will aus dem Ausland zurückgekehrt war, hatte er sich beinahe wie ein Gast in einem fremden Land gefühlt – nichts war so, wie er es in Erinnerung hatte. Aber dann hatte Henry ihn aufgesucht und sich aufrichtig gefreut, ihn nach all den Jahren wiederzusehen. Henry war ein wenig dicker geworden, und seine einst vollen braunen Haare lichteten sich bereits. Aber seine blauen Augen und sein strahlendes Lächeln hatten sich nicht verändert, und er hatte darauf bestanden, Will wieder an den englischen Landadel zu gewöhnen. Er war ein wahrer Freund.
Henry war bestens gelaunt, als sie sich im Pub auf ein Pint Ale trafen. Er war erst vor Kurzem aus London zurückgekehrt, wo er sich in der letzten Zeit häufig aufgehalten hatte. Es gab eine Frau dort, die ihm den Kopf verdreht hatte, und dass sie verheiratet war, schien ihn nur wenig zu stören. Aber Henry war auch in Bezug auf Frauen noch nie besonders wählerisch gewesen, wie auch Will nicht.
Als Will dem Serviermädchen zwei Schillinge reichte, betrachtete Henry die Tätowierung, die aus dem Hemdsärmel hervorlugte. »Du hast das ziemlich freimütig herumgezeigt, oder?«, fragte er und trank einen Schluck Ale.
»Was?« Will blickte auf seine Hand. »Das?« Er zeigte auf die Tätowierung.
»Ja, das. Meine liebe Mutter war völlig schockiert.«
»Wieso das denn?«, fragte Will, der Henrys Mutter seit seinem letzten Kirchgang vor mindestens einem Monat nicht mehr gesehen hatte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: