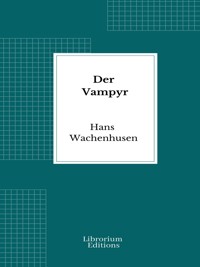0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Aus dem untern Egypten erzählt unsere Geschichte, von dem die Reisenden nur den einen kurzen, schnurgeraden Weg von Alexandrien nach Kairo durchfliegen, um dann hinaufzuziehen, aufwärts in's Saïd, in das „Glückliche“, um droben krokodilensüchtig in den gelben Nil zu starren und, der vieltausendjährigen Sage und Geschichte lauschend, unter dem Säuseln der Palmen zu träumen.
Hier unten, wo unsere Geschichte spielt, gibt's kaum einen Glücklichen von der Stätte ab, wo der Nil seine beiden Arme ausbreitet bis dahin, wo bei Rosette und Damiette seine Wellen in's Meer rollen. Es ist das Land der stillen, stummen, schweißtriefenden Plage, das Land der Seufzer, der Bedrückten, vom Bambus oder Kurbatsch des Machmur entpreßt, und hat auch Gott selbst es mit wunderbarer, unerreichbarer Fruchtbarkeit gesegnet, es wird Keiner dieses Segens theilhaftig, wenn es nicht der Pascha oder sein Vekil, sein Statthalter ist, d. h. der Träger derselben Würde, welche einst Joseph beim Pharao bekleidete, als dieser zu ihm sagte: „Ohne Deinen Willen soll Niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in Egypterland.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
In der Nilbarke
Hans Wachenhusen
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385749682
Table of Contents
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
I.
Aus dem untern Egypten erzählt unsere Geschichte, von dem die Reisenden nur den einen kurzen, schnurgeraden Weg von Alexandrien nach Kairo durchfliegen, um dann hinaufzuziehen, aufwärts in's Saïd, in das „Glückliche“, um droben krokodilensüchtig in den gelben Nil zu starren und, der vieltausendjährigen Sage und Geschichte lauschend, unter dem Säuseln der Palmen zu träumen.
Hier unten, wo unsere Geschichte spielt, gibt's kaum einen Glücklichen von der Stätte ab, wo der Nil seine beiden Arme ausbreitet bis dahin, wo bei Rosette und Damiette seine Wellen in's Meer rollen. Es ist das Land der stillen, stummen, schweißtriefenden Plage, das Land der Seufzer, der Bedrückten, vom Bambus oder Kurbatsch des Machmur entpreßt, und hat auch Gott selbst es mit wunderbarer, unerreichbarer Fruchtbarkeit gesegnet, es wird Keiner dieses Segens theilhaftig, wenn es nicht der Pascha oder sein Vekil, sein Statthalter ist, d. h. der Träger derselben Würde, welche einst Joseph beim Pharao bekleidete, als dieser zu ihm sagte: „Ohne Deinen Willen soll Niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in Egypterland.“
Ich müßte mich wiederholen, wollt ich den Schauplatz meiner Geschichte mit anderen Worten schildern, als ich sie bei meiner letzten Anwesenheit gebraucht; ich setze sie also hieher.
Denke Dir, Leser, eine einzige Ebene, durchschnitten von Kanälen, Rigolen und Dämmen, zwischen denen sich hier und dort die Hügel der Ruine eines Baschmurendorfes, die Lehmhütten der Fellachen und dann und wann, aus dem Grün hervorleuchtend, vereinzelte größere Asyle verabschiedeter Frauen oder Favoritinnen über den unabsehbaren Baumwollenfeldern erheben.
Tausende von künstlich gegrabenen Bächen entsendend, umgabeln die beiden Arme des mächtigen Nil die von Gott so gesegnete Niederung. Geschäftig, unermüdlich stehen die braunen Gestalten der jungen Fellachen bis an die Kniee in den Gräben am „Schaduf“ und gießen in taktmäßig geschwungenen korbähnlichen Gefäßen das Wasser über das Feld. Mit stoischem Gleichmuth geht das Eselein seinen Kreislauf vom Morgen bis zum Abend an der plumpen Deichsel der „Sakieh“, des Brunnenrades, dessen kleine Thongefäße das Wasser herausschöpfen, um die Ebene zu überrieseln.
Hoch geschürzt, die meist schön geformten Beine bis zur Lende im Wasser, das dunkle Antlitz mit dem funkelnden Auge unter dem indigofarbenen weiten Hemd versteckt, die nackten Arme am Handgelenk mit Messing- und Silberspangen, die Finger mit werthlosen Ringen geschmückt, stehen die Fellahweiber am Ufer des Nil oder des Kanals, ihre Krüge und Schüsseln waschend, denn nach tausendjähriger Gewohnheit wird die ganze Wirthschaft am Ufer besorgt.
Neben ihnen spielen die nackten Kinder, Knaben und Mädchen, fast das mannbare Alter schon erreichend, mit den Gänsen im Wasser, oder sie hocken, am Zuckerrohr nagend, auf dem schlammigen Uferrand. Kerzengerade, mit jener unnachahmlich graziösen Haltung der Egypterin, steigen die Fellachinnen vom Dorf herab zum Nilstrand, den hohen schweren Krug auf dem Scheitel, den Körper nur von dem langen blauen Hemd bedeckt, das die Brise, vom Strom herüberwehend, um ihre tadellosen Formen schmiegt.
Ein Kind an der Brust, ein anderes rittlings auf der Schulter, den Krug auf dem Kopf, einen andern auf dem linken Arm, während der rechte das Kind hält, so steigt die junge Mutter aus ihrer Lehmhütte zum Ufer, hinter ihr das Töchterchen, eine Gans im Arm, die es in's Wasser trägt, oder ein Zicklein, das es im Strom badet. Mit einer Kraftanstrengung, welche die Muskelkraft eines Mannes voraussetzen läßt, hebt die Fellachin den schweren Krug gefüllt wieder auf den Kopf, nimmt sie den zweiten auf die Hand und mit der Geschicklichkeit des Jongleurs balancirend, steigt sie in's armselige Dorf zurück.
Eine nach der Andern kommen sie Morgens, Mittags und Abends, ihren Wirthschaftssachen obliegend, die Schüsseln, die Gemüse zu spülen, vielleicht auch, um das blaue Hemd zu waschen, das einzige Kleidungsstück, das ihnen der Schech auf dem Leibe vergönnt, wenn sie nicht noch den Luxus eines bunten, gewöhnlich rothen Beinkleids sich gestatten dürfen.
Dort zieht auf dem hohen Deichpfade, unter welchem eben noch die Baumwolle im fußhohen Wasser heranwächst, eine Gesellschaft von Fellachen einher. Einer nach dem Andern, der Mann auf dem Esel, sein Kind hinter sich, die Frau, die Märtyrerin des Orients, zu Fuß ihm folgend, ein anderes Kind auf der Schulter; der vermögendere Nachbar auf dem Kameel, das gravitätisch den langen Hals wiegt und mit Bersime, dem fetten Klee, beladen ist, aus dem ein paar dunkelgelbe Kindergesichter hervorlugen.
Lustig trabt das Eselein, schwerfällig, gemessen jetzt das Kameel seine hohen Beine mit den dicken Knieballen im Paßgang vorwärts. Ein Rudel nackter oder halb bekleideter Kinder läuft daneben und so zieht die Gesellschaft dahin, schweigend, in der Durchsichtigkeit der Luft hoch und plastisch. Unter ihren Füßen biegt sich dem Gummi gleich der getrocknete Nilschlamm, festgetreten, eine elastische Tenne, polirt von den nackten Füßen der Fellachen.
Keine schönere Tenne als der Nilschlamm. Aber sie dreschen und sie tanzen nicht darauf; es ist ja das Land der Stillen, und was würde der Schech sagen, wenn er die Unglücklichen ernten oder tanzen sähe!
Dort unten in den Feldern ist eine Anzahl Fellachinnen beschäftigt, das Durrahkraut aus der Erde zu reißen oder mit der Sichel zu schneiden. Sie stehen bis über die Knöchel im Wasser, tiefer noch vielleicht in den vom Salzwasser des Meeres infiltrirten Reisfeldern, unermüdlich vom Morgen bis zum Abend, den Kopf in der Sonnenglut, und kein Rheuma, kein Fieber, kein Sonnenstich ficht sie an!
Da drüben wieder blicken die braunen Gesichter der Fellahdirnen aus dem Baumwollenfelde heraus. Ihr Kopf ist bedeckt mit dem indigoblauen Hemd, das ängstlich über die Stirn und die großen schwarzen, mit Kohol umrahmten Augen gezogen wird, wenn Männer daher kommen. Die offene Brust, die Arme und Beine geben sie preis, wenn nur die Sitte gerettet ist.
Zu Zehn und Zwanzig stehen die braunen Dirnen, mit werthlosen Schaupfennigen und Spangen behängt, zwischen den hohen Baumwollenbüschen, deren große gelbe Blüten eine eigenthümliche Nüance ihrer olivenfarbigen Gesichter bilden. So schauen sie aus der beweglichen Schneedecke der faustgroßen weißen Ballen heraus und brechen die Ernte aus den erschlossenen, weit geöffneten Kapseln. Sie füllen sie in große Körbe; sie schnattern lustig wie die Gänse, und wenn der Vekil des Pascha, der Schech oder der Machmur sehen, wie lässig ihre Ernte gepflückt ist, werden sie mit dem Kurbatsch noch einmal an die Arbeit gejagt.
Zwischen den Dirnen waiden friedfertig die schwarzen Büffel oder die braunen Kühe in der fußhohen Bersime, die zwischen der Baumwolle wächst. Alles verträgt sich hier bei einander, Keiner fürchtet den Andern; auch die weißen Kuhreiher spazieren dicht daneben in der Flachs- oder Waizensaat; das kleine rehfarbige Hähnchen mit dem Ramm auf dem Kopf, das goldgefärbte Rebhuhn rascheln zwischen den Büschen und Halmen; der schwarzweiße Dominikaner, elsterartig gescheckt, steigt auf seinen langen Beinen einher, Beccassine und Bachstelze wippen auf den Aderklößen und ein Völkchen junger Taucherenten zieht lustig seinen Zickzack in dem mit Schilf umwachsenen Pfuhl.
Keiner thut hier dem Andern was zu leide. Man hört keinen Schuß jenseits des Barrage, der großen Nilschleuse, bis wohin der Europäer aus Kairo wohl seine Jagd ausdehnt. Die Bachstelze pickt also dem Fellah das Korn aus der Hand, der Kuhreiher geht kaum dem Pflügenden aus dem Wege, und der Flamingo, der Pelikan, wenn sie Abends in großen Bataillonen am Nil sich versammeln, stellen keine Schildwachen aus, weil Niemand sie beunruhigt. Die Köpfe auf den langen Hälsen wiegend und philosophisch drein schauend, lassen sie die Nilbarke dicht an sich vorüber gleiten und lauschen dem melancholischen Gesang der Schiffer, wenn diese unter der Aufsicht des Reïs ihre Ruder mit dem wuchtigen Doppeldruck in das leichte Wasser tauchen.
Dort wieder ist der Fellah mit der Axt beschäftigt, die Baumwollenbüsche zu fällen, die ihm die Feuerung geben in dem baumarmen Lande; neben ihm führt ein Anderer, da auch die Bersime schon geerntet, den ungeschickten Pflug, wie er schon zur Römerzeit üblich.
Die Spitze desselben ritzt kaum drei Zoll tief den Boden, und vorn das ungleiche Gespann, der Büffel und das Kameel neben einander, es hebt den Pflug in großen Sprüngen über den Boden, und hinter ihm zerschlägt ein Anderer mit der Hacke die Erdklumpen, denn der Fellah kennt die Egge nicht. Er bebaut seinen Boden wie seit Tausenden von Jahren, und nie sah dieser einen andern Dünger, als den Schlamm des allversorgenden Nil. Sie haben dem Boden nie gegeben, und er, er gibt ihnen drei Ernten des Jahres!
Drüben am Grabenrand arbeitet eine wunderliche Gesellschaft. Dutzende halb oder ganz nackter Gestalten in allen Farben, vom Sudan-Ebenholz über den dunkelbraunen Berberiner hinweg bis zum gelben Egypter. Sie arbeiten wie die Hamster, die Füchse, die Dachse und Maulwürfe. Es sind hohe, schlanke, schöne Gestalten, Modelle zum Antinous trotz der dunklen Haut, denn hier im Egypterland gedeiht der Herkules noch. Sie sind schlank wie ihr Vorbild, Sie Palme, geschmeidig wie die Natter; sie haben alle geistigen Anlagen, aber der Kurbatsch ist ihr einziger Lehrmeister.
Sie graben mit den Händen eine Sakieh oder sie durch wühlen den hohen Damm, den Deich, durch den sie sich vor der Ueberschwemmung geschützt, um das Wasser wieder abfließen zu lassen. Der Nil ist längst zurückgetreten, es gilt, den Schaduf zu hantiren. Sie behandeln den Nilboden wie einen Teig; sie haben keine Werkzeuge, nur ihre Hände. Sie haben auch keine Handwerker, die man auf zwanzig Meilen in der Runde suchen müßte, keinen Schuster, denn sie gehen barfuß. Ja, geräth dem reichen Pascha einmal die Lokomobile in Unordnung, die seine bevorzugten Felder aus dem Nil überrieselt, ist in derselben eine Niete locker, ein unbedeutendes Ventil gebogen, ein Schade, den ein Schlosser in wenigen Minuten reparirt, man läßt die ganze Maschine liegen und sie verrostet im Wasser. „Afrid“, der Teufel selbst, der ja in der Dampfmaschine sitzt, mag sie auch wieder in Ordnung bringen!
Und wiederum dort drüben, wo sich wie mathematische Linien die hohen Dämme über den blanken Spiegelflächen der Infiltrationen auf den Reisfeldern erheben, arbeitet eine andere Gruppe, über den Boden gebeugt, die nackten Beine, die Arme in dem salzigen Sumpf.
Es sind jugendliche Gestalten, fast Kinder noch, Mädchen und Knaben. Frohndienst leisten die Armen auf den Feldern des Ministers. Das Wasser droht die Dämme zu zerbrechen, das ganze Dorf muß herbei, um dem reichen Mann seine Ernte zu schützen! Kein Kleidungsstück bedeckt die jugendlichen Sklaven, höchstens ein zerrissener „Tob“, das Hemd, die armen Mädchen. Die Kraft der Armen gehört ja dem „Effendine“, dem Khedive, seinen Ministern, seinen Mudiren, und ein bis zwei egyptische Pfund Steuer zahlt der Fellah an den Schech-el-Beled für den Feddan elendesten Bodens, von dem ihm noch der Pascha das Wasser abfängt; ein Pfund bezahlt er für seinen Palmbaum. Die Hälfte dieser Steuer nur liefert der Schech an den Mudir, den Gouverneur; der zieht sich noch einmal eine Hälfte davon ab und den Rest erhält der Khedive, der ihn mit vollen Händen zum Fenster hinaus wirft.
So arbeiten und schaffen sie rastlos von Sonnenaufgang bis Untergang. Für sie selbst bleibt nichts nach all' dem Frohnden und Steuern, nichts als eine Handvoll Hirse! Denn was von dem ganzen gesegneten Delta nicht dem Khedive gehört — und das ist kaum noch ein Drittel des Landes, — das gehört seinen Paschas. Sie sterben und verderben im Elend, die armen Fellachen, und keiner von ihnen hat mehr den Muth, wie einst zu Joseph's Zeiten, zum Vekil des Pharao zu gehen und zu sagen: „Du hast uns unser Brod genommen, jetzt nimm auch unser Leben!“
Er nimmt ja auch das! Jenen Pharaonen mußte der arme Bauer vor Jahrtausenden Ziegel streichen, Steine auf Steine wälzen und den Marmor aus Nubien herabschleppen zum Bau der Paläste, der Tempel, der Obelisken und Pyramiden, und Mehemet Ali, der Gründer der neuen Pharaonendynastie, trieb aus dem Delta und fern aus dem Saïd, den oberen Nilprovinzen, ganze Schaaren zusammen; er ließ sie mit ihren Händen den Mahmudieh-Kanal graben und die Ufer desselben mit zwanzigtausend in Krankheit, durch Hunger, Entbehrung und Erschöpfung verendeter Fellachen bedecken!
Keine Löhnung, kein Obdach, keine Nahrung wird den Aermsten gereicht, wenn sie, aus ihren Dörfern durch den Schech zusammengetrieben, von ihren Weibern und Kindern gerissen werden, um weit fort von ihnen eines der neuen, die Welt erstaunenden Pharaonenwerke zu schaffen oder Kanäle zu graben! Wie ein todter Hund liegt ihre Leiche am Wege, umkreist von dem gellenden Geschrei der Geier, und weinend ziehen daheim sein Weib und seine Kinder zur Hütte hinaus, verjagt vom Schech, dem sie nicht mehr die Steuer für die einzige Dattelpalme zahlen können, die über ihrem armseligen Lehmbach wächst.
Verödet steht oft ein ganzes Dorf. Der Tod und der Schech haben es verwüstet. Und seht euch das Fellachendorf hoch oben auf dem Ufer des Nil an! Eine wunderbare Poesie umgibt das elende Heim der unglücklichsten Dulder! Ein Haufe getrockneten Lehms, nichts weiter ist's, in der Nähe gesehen. Kegelförmig errichtet steht eine Höhle neben der andern, mit Löchern durchbrochen an Stelle der Fenster. Maisstroh deckt ihre Dächer. Ueber sie hinweg ragen die aus gleichem Material errichteten Taubenthürme, stets umschwärmt von der weißen gefiederten Schaar.
Höher als diese erhebt sich vielleicht die Kuppel eines Marabu, des Grabes eines Heiligen, der bei Lebzeiten vielleicht ein unflätiges Thier, auch eine Geißel namentlich der Weiber gewesen; noch höher ragt das baufällige Minaret, in dem der Schech und seine Leute beten können. Mit ihm wetteifernd streckt die Palme, umkränzt von saftiger Dattelfrucht, ihre langen Blätter in den blauen Aether, während die Nil-Akazie, die Sykomore, die Trauerweide lauschig das Marabu umgrünen!
Und die glänzendste Sonne, ein blauer, nie getrübter Himmel lacht über diesem Heim des armen Fellah, Gottes leuchtende Allmacht und Barmherzigkeit, zu der er so gläubig zu beten gewohnt!
Ja, sie beten, sie rufen so fromm zu Gott hinauf. Aber wer da kommt, das ist immer der Schech, der sie zum Frohnden, zum Zahlen, zum Leiden ruft!
II.
Das ist ein anderes Land, Leser, als das, von dem dir alle die Bücher schreiben. Von Obelisken, von Pyramiden, von majestätischen Tempel- und Palast-Ruinen wimmelt's in diesen Büchern, und zwischendurch begegnet dir ein Krokodil, das neugierig den gepanzerten Kopf aus den schlammigen Fluten des Nil streckt.
Und doch ist's dasselbe Land, nur eben eine andere Provinz, der egyptische Garten der Fruchtbarkeit. Jenes obere Nilland ist das Saïd, das glückliche, in welchem das Fayum liegt, das einst den Pharaonen den Köstlichen Wein lieferte und heute kaum noch eine Rebe kennt. Die Seele, die Ernährerin des unersättlichen Beherrschers aber ist das Fruchtland zwischen beiden Gabelarmen des Nil, das trotz seiner hohen Kultur noch weite unbebaute, unermeßliche Strecken, die sogenannte Berieh oder Barari, einschließt, deren Kultivirung der Khedive allmälig durch den Kism, die Halbpacht, zu erzielen sucht, bei der, wenn es an's Theilen geht, die armen Pächter natürlich den Kürzern ziehen, weil das Lamm mit dem Löwen theilt.
Der Erzähler hat monatelang diese Ländereien durchstreift, der Nächte genug unter den armen Fellachen und in den Nilbarken verbracht, um Land und Leute hier kennen zu lernen, und ist die Romantik dieser Strecken auch nur durch wenige Tempelreste vertreten, das Delta birgt des Schönen, Eigenthümlichen unendlich viel von dem großartigen Bauwerk des Barrage, der Doppelschleuse, die als riesiges Festungswerk erdacht wurde, bis zu den beiden Ausflüssen bei Rosette und namentlich Damiette.
Sie schließt in sich die Stätte Mansurah, wo der heilige Ludwig in den Kreuzzügen gefangen saß, den Isistempel, die Ufer des Menzaleh-See mit den Nachkommensresten der alten Hyksos, und die Stadt Tanta, von deren Eigenthümlichkeiten die Rede sein wird.
Nirgendwo ist das Mirage, die Fata Morgana so wunderbar, wie gerade hier, wenn die Felder bis weithin zu dem weißen „Ramleh“, den bleichen Gebirgen gegen das Mittelmeerufer hin, mit den großen Wasserspiegeln der Ueberschwemmung bedeckt sind; selbst die Luftspiegelungen in der Sahara, die der Erzähler an anderem Ort geschildert, reichen nicht an sie heran.
Nirgendwo hat sich wie hier das alte egyptische Leben der Ureingeborenen dieses Landes, das sonst im Araberthum untergegangen, so eigenthümlich und unverfälscht in seinem nach Jahrtausenden zählenden Typus erhalten, und hier endlich ist der Ursprung all' der Millionen, welche die Großen des Landes, an ihrer Spitze der größte Verschwender, der Khedive selbst, im In- und Ausland vergeuden: der Nil und die blutenden Hände der armen Fellachen!
An dem schmutzigen, zerfallenden Hafenkai von Alt-Kairo, von Bulak, lag am frühen Morgen eines Oktobertages die Nilbarke „Timsah“, eine der schönsten, zierlichsten Dahabien des ganzen Nil.
Timsah, das Krokodil, hatte ihr Besitzer sie getauft, in Erinnerung an seine Jugend, die der Jagd auf das Timsah und das Fars el Bachr, auf das Krokodil und das Nilpferd, gewidmet gewesen das erstere freilich nur zur Uebung des Auges und des Armes, denn es ist werthloß als Beute, das andere aber um des Handels mit der festen Haut willen, die guten Gewinn trägt.
Reïs Tabut, der Besitzer und Führer der Barke, hatte wohl über fünf Jahre am obern Nil gelebt, und seine Jagd sogar bis zu den Aequatorialgegenden ausgedehnt. [Reïs, Barkenführer, auch Kapitän kleiner Fahrzeuge.] Er hatte die Transporte der Elephantenzähne vom Gazellenfluß nach Khartum begleitet und mit den Agenten des großen Handelsherrn, des Khedive, in Khartum leidliche Geschäfte gemacht, hatte auch im Auftrage derselben zuweilen seine Hand in den Sklavenhandel gesteckt, und namentlich junge schwarze Waare nach dem Koptenkloster von Siut geliefert, von wo die armen Neger als Eunuchen für hohe Preise nach Kairo und Konstantinopel geliefert wurden.
Reïs Tabut war jetzt ein Mann von fünfunddreißig Jahren, kräftig und hoch gebaut, mit breiten Schultern und übermäßig markigen Gliedern. Sein Haupt verhüllte nur eine braungelbe Koffieh, das mit lang herabhängenden seidenen, netzartigen Fransen garnirte egyptische Kopftuch. Sein Antlitz war tiefbraun gefärbt von der Sonne, denn er war Fellah, und seine natürliche Hautfarbe hatte unter dem Aequator einen weit dunklern Ton angenommen. Niemand durfte ihm aber sagen, daß er zu den Fellachen gehöre, denn der Reïs besaß Ehrgeiz.
Seine schwarzen, listig funkelnden Augen lagen unter dichten Brauen versteckt, die über der adlerförmigen Nase zusammengewachsen, sein Bart war geschoren nach dem Moslemgesetz, das nur dem Alter über vierzig Jahren den vollen Bartwuchs erlaubt; ein schwarzer Schnurrbart, langzipflig und gelockt, sprang über den wulstigen, sinnlichen Lippen und dem eckigen Kinn hervor.
Den Hals trug er entblößt; der war stark, muskulös und breit wie der Nacken eines Stieres. Eine kurze, wespenartig gestreifte, braungelbe Jacke mit Hängeärmeln harmonirte mit dem Kopftuch. Sein Hemd war stets untadelhaft weiß und auf der Brust in dichte kleine Falten gelegt. In dem breiten Shawl, der seine kräftigen Hüften umgürtete, trug er alle kleinen Bedürfnisse, ein breites Messer und den kurzen Tschibuk. Seine vom Knie ab nackten Beine steckten in weiten Mokassins, weßhalb man ihn den Reïs-Gesme nannte, und wenn die sehnige braune Hand nach etwas reichte, war's, als strecke der Löwe seine Tatze aus.
Schon sehr jung war Reïs Tabut nach den oberen Nilgegenden gekommen. Als Schiffsjunge war er dort einer kairinischen Barke entlaufen, in der es mehr Schläge als Nahrung gab, hatte bei einer der landeinwärts gehenden Karawanen Schutz gesucht, sich darnach mit nach Koffeir nehmen lassen, und von dort aus sein Glück versucht. Anfangs als Schiffsjunge auf einem Fahrzeug im arabischen Meerbusen, das die Mekkapilger nach Dschedda überführte und nebenbei kleinen Seeraub und Schmuggel trieb; dann als Kameeltreiber, und endlich, als er sich kräftig genug fühlte, schloß er sich den Nilpferdjägern an. Unter diesen fand er reichliche Beschäftigung, ein waghalsig, abenteuerlich Leben und Gelegenheit zu mancherlei Unternehmungen, die Niemand da straft, wohin das Gesetz seinen Arm nicht ausstrecken kann.
Die Schiffer vom untern Nil, die bei Assuan von seinem Treiben gehört, wußten ihm Vielerlei nachzuerzählen. Er sollte nicht reine Hand haben hinsichts so mancher auch wohl blutiger Exzesse, die da oben vorgefallen; indeß gab's hiefür keinen Anhaltspunkt.
Daß er am obern Nil ein Weib, man sagte sein Weib, erschlagen, war nicht der Rede werth. Daß er mit seinen Kosorten einmal einen kostbaren Transport überfallen, die Führer desselben niedergemacht und den theuren Raub nach Kosseir verhandelt, konnte ihm Niemand beweisen. Reïs Tabut war also durchaus unbescholten nach landläufigen Anschauungen.
Als er nach Kairo zurückkehrte, hatte er sich bald großen Anhang verschafft. Er war ein schöner Mann; sein Schnurrbart war magnifik, seine muskulösen Arme, an denen die weiten Aermel schon vom Ellenbogen herabfielen, waren bunt tättowirt nach egyptischer Sitte, der auch die Frauen sich nicht entziehen, und diese zeigte er gern, wenn er sprach. Denn er war ein guter Erzähler, und das ist bei dem Volk eine große Empfehlung. Er hatte auch, wie er immer wiederholte, keine Reichthümer gesammelt, hatte durch seine Jagden, durch seinen Handel mit Häuten und Nilpeitschen nur gerade so viel erworben, um sich in Bulak eine Hütte miethen und eine Dahabieh kaufen zu können, und das, bewies er, sei spottwenig für ein so hartes Leben, wie er es jahrelang geführt; „die Väter des Bauchs“, die Philister, die inzwischen ruhig daheim gesessen, hätten viel mehr erworben als er. Seine Neider aber behaupteten, er habe sein Geld vergraben.
So war er seit vier Jahren in Bulak, an dessen Ufer seine Barke als eine der schönsten und saubersten bekannt. Die „Timsah“ hatte zwei stolze weiße Segel, die sie vor dem Wind ausbreitete wie die Flügel eines Schwanes. Sie hatte ein sauberes Hochdeck, darunter einen großen Salon mit Spiegelwänden, Goldleisten und mit blauseidenen Ueberzügen auf den weichen Divans; sie hatte ein halbes Dutzend zierliche und saubere Schlafkabinen, und endlich am Vordertheil noch einen zweiten Familiensalon mit schönen weichen Teppichen, die zum Theil so kostbar, daß wohl anzunehmen, sie gehörten zur Beute einer seiner früheren Unternehmungen.
Acht Ruderer standen in seinem Dienst, kräftige braune Gestalten, unter ihnen zwei riesige Sudan-Neger. Sein „Volet“, sein Bursche, ein flinker, hellbrauner Berberiner mit keckem Gesicht, blitzenden Augen, halblang geschnittenem schwarzem Haar und von mädchenhaftem Wuchs, gelenkig wie eine Eidechse, mußte ihn und seine Gäste bedienen, die beiden Neger mußten zugleich die Küche besorgen, deren Vorrathskammer im untern Raum stets gut versorgt war.
So war denn die „Timsah“ von den Nilreisenden vorzugsweise gesucht, und Tabut hielt auf gute Preise. Er fuhr sie Nil auf- und abwärts und hatte in allen Uferplätzen, in Minieh, Siut, Girgeh, Keuneh, Luxor, Esne und Assuan und darüber hinaus seine guten Freunde. Man glaubte sogar, er habe in mehreren dieser Orte eine Frau, worüber indeß Niemand Genaues zu sagen wußte.
Reïs Tabut war unterwegs der galanteste, bereitwilligste Mann, namentlich wenn Damen sich in der Reisegesellschaft befanden. Er hatte sich aus verschiedenen europäischen Sprachen einzelne Phrasen angelernt, die er sehr komisch und mit einer gewissen Naivität anzubringen wußte; er sorgte reichlich für die Pflege Derer, die er den Nil hinauf und wieder zurückzuschaffen übernommen, und kehrte er heim, so sammelten sich um ihn seine Freunde im Kaffeehause, denen sein beredter Mund die schönsten Dinge zu erzählen wußte.
III.
Die „Timsah“ also lag am frühen Morgen klar, der Reisenden gewärtig, die sie gedungen, an dem schmutzigen Hafenkai von Bulak, seitwärts der Ufermauern des vizeköniglichen Schlosses Kasr-el-Nil.
Dichter Nebel lagerte noch über dem Strom. Die leichte Morgenbrise fegte ihn über die gelbe Wasserfläche, ihn bald zu dichten Ballen zusammenwirbelnd, bald wie dünne Gaze zerreißend, in langen grauen Schichten zum Ufer hinaufdrängend und in weißen Fetzen über die Giebel der hohen, baufälligen Baracken jagend.
Langsam erwachte allmälig das Leben am Ufer. Einige Wasserträger stiegen von demselben herab mit ihren bocksledernen Schläuchen; einige Schwarze kamen, um sich im Nil die Füße zu waschen; einige Weiber füllten ihre Krüge, und sie alle verschwanden wieder im Dunst. Die Falken und Geier ließen in der Luft ihr hungriges Geschrei ertönen, die Fischerbarken in langen Schwingungen umkreisend; einzelne weiße Segel, zum Trocknen ausgebreitet, leuchteten durch den beweglichen Flor und fingen die ersten goldenen Blitze der Sonne auf.
Es entstand ein Gewirr und Geschiebe in dem immer blasser, immer durchsichtiger werdenden Nebelwust. Wie goldene Fäden durchwirkte es die wallende Gaze. Eine neue Brise fuhr dazwischen, drückte die Dünste auf der Nilfläche gegen die Ufer, ließ sie wie große Seifenblasen in die blaue Luft aufsteigen, und wie durch Zauberschlag erschien drüben, den taubenhausähnlichen Baraden des Kai gegenüber, das paradiesische Gestade der Insel Roda, in, dessen Schilf die Sage den Moses gefunden werden ließ.
Ueppig und saftig hoben sich die Rosen- und Jasmingebüsche, die Granaten, die Myrten, die dunklen Kaktusblüten, das flüsternde Zuckerrohr am Ufer, ein Blumen- und Blütenhain, überragt von der stolzen Palme, der gelben Nil-Akazie, mit ihren Düften den Morgenthau durchathmend, und über den Feengarten hinweg ragte das Zauberschloß Gesireh mit seinen graziösen maurischen Filigranbogen, umgeben von lieblichen Blumenanlagen, ein Prachtwerk deutscher Kunst, in das der große Handelsherr Egyptens, der Vizekönig, vor wenigen Jahren „esprits éclairés“ der ganzen Welt zu Gaste lud, bei Gelegenheit der Eröffnung des Suezkanals.