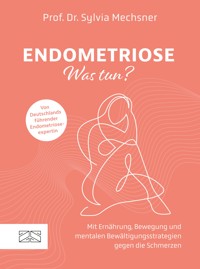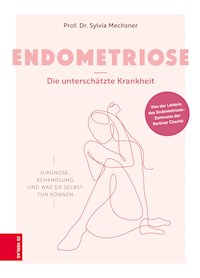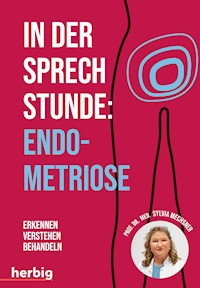
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Endometriose gehört zu den häufigsten Erkrankungen bei Frauen und ist eine der Hauptursachen für unerfüllten Kinderwunsch. Die Endometriose-Expertin Prof. Sylvia Mechsner informiert über die Unterleibserkrankung anhand konkreter Fragen von Patientinnen. Sie beschreibt Ursachen,Symptomatik und Diagnose, stellt ganzheitliche und schulmedizinische Therapien vor und behandelt auch die Auswirkungen auf Psyche und Sexualität. Im Selbsthilfeteil finden Frauen viele Tipps, um die Beschwerden zu lindern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
PROF. DR. MED. SYLVIA MECHSNER
In der Sprechstunde:
endometriose
ERKENNEN
VERSTEHEN
BEHANDELN
Bildnachweis
Mit 5 Illustrationen von Markus Weber/Guter Punkt GmbH & Co KG, München,
guter-punkt.de (Bild01, Bild02, Bild04, Bild05, Bild06)
Mit 1 Illustration der Stiftung Endometriose-Forschung © Keckstein/SEF: Bild03.
Alle übrigen Abbildungen sind aus dem Archiv der Autorin.
Die Autorin dankt MSc Johanna Netzl für ihre Mitarbeit.
Impressum
Umschlaggestaltung von Vanessa Frömmig
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sorgfalt bei der Umsetzung ist indes dennoch geboten. Der Verlag und der Autor übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien, Methoden oder Informationen entstehen könnten.
Alle Angaben, Empfehlungen und Informationen sind ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Autors. Für die Angaben zu den aufgeführten Produkten kann weder seitens des Autors noch seitens des Verlages eine Gewähr übernommen werden. Bitte fragen Sie in jedem Fall Ihre Therapeutin oder Ihren Therapeuten um Rat, setzen Sie verordnete Medikamente nicht eigenmächtig ab und lassen Sie die Anwendung der hier genannten Präparate auf Ihren speziellen Bedarfsfall von der betreuenden Therapeutin oder dem betreuenden Therapeuten prüfen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernimmt der Verlag für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de/herbig.
© 2023, Herbig in der Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG,
Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96859–543-6
Projektleitung: Nicole Janke
Redaktion: Dr. Doris Kliem, Urbach
Produktion: Vanessa Frömmig
E-Book-Produktion: Satzwerk Huber, Germering
INHALT
Vorwort
1 Grundlagen
2 Diagnose
3 Nicht operative Therapien / Hormontherapien
4 Nebenwirkungen von Hormonen
5 Operative Therapie
6 Schwangerschaft
7 Spezielle Formen der Erkrankung
8 Chronische Schmerzen
schlusswort
Anhang
VORWORT
Liebe Leserin – und lieber Leser!
Dieses Buch hat eine Erkrankung zum Thema, die lange Zeit nicht als solche wahrgenommen wurde und teilweise noch immer stark tabuisiert wird. Vielleicht leiden Sie selbst darunter oder kennen Menschen in Ihrem näheren Umfeld, die davon betroffen sind. Denn Endometriose und Adenomyose, die starke Schmerzen verursachen können, haben viele Facetten und sind nicht einfach zu verstehen. Umso wichtiger ist aber, dass wir darüber sprechen und diese Erkrankungen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit bringen, sodass die Menschen, die von Menstruationsbeschwerden betroffen sind, endlich auch Hilfe erhalten. Dieses Thema darf nicht länger ein Tabuthema bleiben. Weltweit, in Europa und hier in Deutschland, gibt es viel zu viele Menschen, denen eingeredet wird, dass Menstruationsschmerz normal sei. »Da musst du durch – stell dich nicht so an – das haben alle!« Das Problem ist weitschichtig und kulturell geprägt. Die lange Diagnoseverzögerung und damit der späte Beginn einer Therapie sind nicht länger akzeptabel. Die Gesellschaft muss lernen, dieses Thema anzunehmen und zu integrieren. Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch viele Fragen, die es rund um die Endometriose und die Adenomyose gibt, beantworten kann und somit einen Beitrag zur Aufklärung und zur besseren Versorgung leisten kann.
Ihre Prof. Dr. med. Sylvia Mechsner
ENDOMETRIOSE:GRUNDLAGEN
1
1
Was ist Endometriose?
Gebärmutterschleimhaut ist ein Drüsengewebe, bestehend aus Epithel- und Stromazellen. Kommt ein der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe aber außerhalb der Gebärmutterhöhle vor und finden sich Immunzellen wie Makrophagen in diesem Gewebe, wird das als Endometriose bezeichnet. Dieses Endometriosegewebe wird Endometrioseherd oder -läsion genannt. Es kann nur anhand einer Gewebeprobe untersucht werden, die operativ entnommen werden muss. Diese Gewebeprobe wird dann fixiert und pathologisch als sogenannter Gewebeschnitt unter dem Mikroskop untersucht. Dazu wird der Gewebeschnitt gefärbt (H&E-Färbung), damit das Gewebe pathologisch untersucht und eingeordnet werden kann. Kommt die Gewebeprobe beispielsweise vom Bauchfell, gehören dort solche kleinen Drüsen (Epithel- und Stromazellen) ähnlich denen der Gebärmutterschleimhaut nicht hin und die Diagnose Endometriose ist bestätigt. Das Endometriosegewebe ist insgesamt sehr gut differenziert, hat also nichts mit bösartigem Wachstum zu tun. Es wächst aber auch nicht rein verdrängend, sondern kann in die tieferen Schichten angrenzender Organe einwachsen (tief infiltrierend). In über 80% der Fälle sind die Herde aber einfach im Peritoneum lokalisiert (oberflächliche Herde). Das Peritoneum ist das Bauchfell, sozusagen die innere Hautschicht, die den Bauchraum und die darin liegenden Organe auskleidet.
Aufbau von Endometriosegewebe
Da in der einfachen H&E-Färbung nur die Zellkerne gefärbt werden, ist lange Zeit nicht aufgefallen, dass in Endometrioseherden im Bindegewebe um die Drüsen herum auch noch Muskelzellen liegen, denn in der H&E-Färbung sehen Muskelzellen und Bindegewebe gleich aus. Die Muskelzellen können nur mit speziellen Färbungen (sogenannten immunhistochemischen Färbungen) dargestellt werden. Dank dieser speziellen Färbungen wissen wir nun, dass bei Endometriose eigentlich nicht nur der Gebärmutterschleimhaut ähnliche Drüsen an anderer Stelle liegen, sondern dass diese zusätzlich auch von der Gebärmuttermuskulatur ähnlichen Zellen umgeben sind. Daher muss man korrekterweise sagen, dass es sich bei Endometriosegewebe um gebärmutterähnliches Gewebe handelt, quasi um Miniatur-Uteri. Leider gehört aber der Muskelnachweis bisher nicht zur histologischen Definition der Erkrankung und findet kaum Berücksichtigung.
Histologischer Gewebeschnitt einer Endometrioseläsion mit Muskelzellen
2
Welche Theorien zur Entstehung der Endometriose gibt es?
Lange Zeit war die gängige Theorie zur Entstehung der Endometriose die »Theorie der retrograden Menstruation«, also der rückwärtsgerichteten Menstruation. Sie beschreibt, dass Blut während der Menstruation vom Uterus durch die Eileiter in den Bauchraum gelangt und dabei sozusagen Schleimhaut aus dem Uterus »mitnimmt«, die sich dann in der Bauchhöhle festsetzt. Die Tatsache, dass es sich bei Endometriose aber um alle Gewebe der Gebärmutter handelt, zeigt, dass die Annahme der rückwärtsgerichteten Menstruation nicht stimmen kann. Es ist zwar denkbar, dass solch abgeschilferte Gebärmutterschleimhaut anwächst, aber eigentlich auch wieder nicht, denn sie ist ja abgestoßen und damit auch nicht mehr vital. Trotzdem hat sich diese Annahme lange gehalten (Sampson-Theorie von 1921), weil die Endometrioseherde sich tatsächlich im Flussgebiet der retrograden Menstruation ansiedeln, also auf dem Bauchfell und im kleinen Becken. Zudem kann eine retrograde Menstruation bei über 90% aller Menstruierenden beobachtet werden. Aber: Solch abgeschilferte Schleimhautzellen können keine Muskelzellen bilden. Daher ist dies ein wichtiger Hinweis, dass die Ursprungszelle, aus der das neue Gewebe hervorgeht, nicht abgestoßene Schleimhaut als Grundlage haben kann.
Die Metaplasietheorie (die der Pathologe Robert Meyer 1921 postulierte) kommt dem an sich schon näher: Er nahm an, dass es bei Endometriose zu einer Reaktivierung von Resten der Strukturen kommt, die während der embryonalen Entwicklung für die Ausbildung von Uterus und Eileitern verantwortlich sind, den sogenannten Müllerschen Gängen. Er nahm also an, dass das ektope (außerhalb der Gebärmutter liegende) Endometriosegewebe grundsätzlich aus solchen Zellen entsteht, die das Potenzial haben, alle Gewebe der Gebärmutter zu bilden, also Gebärmutterschleimhaut und -muskulatur. Er hatte im Übrigen auch schon damals die Muskelzellen beschrieben, was dann aber in Vergessenheit geraten ist. Für einige Formen der Endometriose passt diese Erklärung recht gut, beispielsweise für Endometriose, die sich außerhalb des Bauchraums im sogenannten retroperitonealen (= hinter dem Bauchfell gelegenen) Raum oder im Nabel entwickelt. Denn Reste (Residuen) der Müllerschen Gänge sind im Retroperitoneum zurückgeblieben und können sich theoretisch reaktivieren. Aber die im Bauchraum verteilte Endometriose lässt sich mit dieser Theorie nicht erklären.
3
Wie stellt man sich heute die Entstehung der Endometriose vor?
Es gibt noch relativ neu die Überlegung, dass die Gebärmutter selbst dabei eine Rolle spielt. Die Gebärmutter ist ein Muskel und hat daher verschiedene Aufgaben, die mit Bewegungsabläufen der Uterusmuskulatur, dem Myometrium, zu tun haben. Ähnlich wie Magen und Darm macht die Gebärmutter peristaltische Bewegungen (rhythmisches Zusammenziehen, um Inhalt weiterzutransportieren), die man nicht bewusst bemerkt. Zum Zeitpunkt der Regelblutung gehen die Bewegungen eher zum Ausgang hin, damit das Blut abfließen kann. Menschen mit sehr starken Regelschmerzen haben oft auch sehr starke Muskelkrämpfe in der Gebärmutter. Es wird angenommen, dass diese Krämpfe manchmal zu stark sind, sodass es zur Mikrotraumatisierung zwischen den Schichten der Gebärmuttermuskulatur und der Gebärmutterschleimhaut kommt. Das sind keine sichtbaren Verletzungen, sie sind eher vergleichbar mit Mikrohaarrissen bei Minierdbeben. Trotzdem führen sie mit der Zeit zu einer Aktivierung von Wundheilungsprozessen. Zwischen den Drüsenzellen sitzen Stammzellen; diese gehören dort hin und sitzen in ihrer Nische. Im Rahmen solcher Wundheilungsprozesse werden diese Stammzellen aktiviert und können dann, wenn sie ihre Nische verlassen, meist zunächst in die Tiefe der Muskelschicht abwandern und dort neue Gebärmutterinselchen, die sogenannte Adenomyose, bilden. Oder aber sie können durch die Eileiter in den Bauchraum gelangen und dann die äußeren Gebärmutterinselchen, die Endometriose, bilden. Diese Theorie entspricht dem Tissue-Injury-and-Repair-Konzept von Prof. Leyendecker, ergänzt durch das Stammzellkonzept.
Trotz aller Forschungsbemühungen ist der Beginn der Endometriose weiter unklar. Im Jahr 2015 wurde erstmals eine fetale Endometriose (in der 35. Schwangerschaftswoche) mitgeteilt, also eine Endometriose bei einem ungeborenen Kind. Pathophysiologisch ist eine fetale retrograde Blutung dafür verantwortlich gemacht worden. Auch vor der Menarche ist eine Endometriose möglich, wie die Diagnose bei einem neunjährigen Mädchen ergab. Daher scheinen auch andere Entstehungswege der Endometriose nicht ausgeschlossen zu sein, aber mit Sicherheit nicht die breite Masse zu betreffen.
Stammzellentheorie zur Entstehung von Endometriose und Adenomyose
4
Sind Endometriose und Adenomyose dasselbe?
An sich schon, was die Gewebeart angeht. Aber als Adenomyose wird das Vorkommen der Läsionen in der Gebärmuttermuskelwand bezeichnet und als Endometriose das Vorkommen der Läsionen außerhalb der Gebärmutter.
5
Warum baut der Körper die fehlangesiedelten Zellen nicht einfach wieder ab?
Das ist eine gute Frage! Leider gehört das Gewebe ja grundsätzlich schon zum Körper und befindet sich eben »nur« an der falschen Stelle. Daher scheint der Körper eine gewisse Toleranz für die Endometriosezellen zu haben. Vollständig wird das Gewebe aber auch nicht akzeptiert, denn es verursacht dort, wo es sich angesiedelt hat, eine Entzündungsreaktion.
6
Welche Folgen hat diese Entzündungsreaktion der Endometrioseherde?
Da es sich bei Endometriose um der Gebärmutterschleimhaut ähnliches Gewebe handelt, unterliegt dieses Gewebe wie die Gebärmutter den hormonellen Einflüssen im Körper. Es kommt unter Östrogeneinfluss zu ähnlichen Veränderungen, wie sie auch die Gebärmutterschleimhaut mitmacht, und dann zum Zeitpunkt der Menstruation ebenfalls zur Freisetzung von Botenstoffen. Das erklärt, dass Endometrioseschmerzen vor allem im Zusammenhang mit der Regelblutung auftreten. Diese Botenstoffe locken auch Entzündungszellen an, die aber ihre Aufgabe nicht erfüllen, wie sie sollten. Ob aus Respekt vor dem körpereigenen Gewebe oder weil sie primär in ihrer Funktion gestört sind – das weiß man nicht. Makrophagen (Fresszellen) sind zwar vorhanden, aber sie verwandeln sich in Makrophagen, die tolerant sind und das Endometriosegewebe in Ruhe lassen. Auch natürliche Killerzellen werden nicht richtig aktiviert. Verschiedene Fehlleistungen des Immunsystems lassen es zwar reagieren, aber eben nicht richtig, sodass nun der große Faktor der chronisch-entzündlichen Reaktion dazukommt. Das kann zusätzlich Schmerzen verursachen. Demzufolge kann im Labor auch eine Reihe von Entzündungsfaktoren nachgewiesen werden, vor allem in der Bauchfellflüssigkeit, der Flüssigkeit, die im Bauchraum zwischen den Organen vorkommt.
7
Wäre die chronische Entzündung ein sinnvoller Ansatzpunkt für die Therapie?
Es gab schon diverse Versuche, diese Entzündungskaskade zu stoppen, aber der richtige Ansatzpunkt dafür konnte noch nicht gefunden werden. Denn es handelt sich bei der Endometriose nicht wirklich um eine Autoimmunerkrankung, also aggressives Verhalten von Immunzellen gegen körpereigene Zellen mit der Ausbildung von Autoantikörpern, wie beispielsweise bei Rheuma. Bei einer Autoimmunerkrankung kann die überschießende Immunreaktion z.B. mit Cortison oder Immunmodulatoren gedämpft werden. Dadurch kann dann die Reaktion gegen das eigene Gewebe unterdrückt werden. Dieses Vorgehen war bei Endometriose aber leider bisher nicht wirksam, sodass die Entzündungsprozesse hier also andere zu sein scheinen. Das Immunsystem ist sehr, sehr komplex und es gibt sehr viele verschiedene Ebenen der Aktivierung der zellulären Abwehr, die spezifisch (T-Zellen) oder auch allgemein (Makrophagen und natürliche Killerzellen) ist, und daneben die humorale Abwehr, die durch Antikörper vermittelt wird. Man kann bei den unterschiedlichen chronisch-entzündlichen Erkrankungen zwar viele Parallelen finden, auch zwischen Rheuma und Endometriose oder Colitis ulcerosa und Endometriose. Aber sie unterscheiden sich doch sehr in der Art der Entzündungsreaktion und daher auch in der geeigneten Therapie. Dennoch schadet mehr Forschung in diesem Bereich nicht, denn mit antientzündlicher Ernährung beispielsweise lässt sich viel bewirken (dazu aber später mehr). Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es leider keine Therapie in Bezug auf Endometriose und das Immunsystem, die es bis zur Prüfung und zum Nachweis des Nutzens gebracht hat. Grundsätzlich ist aber das Immunsystem bei Menschen mit Endometriose unauffällig, d.h., es gibt weder eine erhöhte Infektneigung noch eine auffällige Verbindung zu anderen Immunstörungen oder Autoimmunerkrankungen.
8
Wo im Körper kommt die Endometriose vor?
Es gibt unterschiedliche Einteilungen der verschiedenen Endometrioseformen nach dem Ort oder der Art ihres Auftretens. Es können Herde nach ihrem Wachstumsmuster unterschieden werden: Manche wachsen oberflächlich (oberflächliche Endometriose), andere wachsen tiefer in das Gewebe ein (mehr als 5 mm; tief infiltrierende Endometriose) oder es entstehen Zysten (mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume) in den Eierstöcken, den Ovarien (sogenannte Schokoladenzysten, besser aber Endometriome genannt). In Deutschland etabliert sind außerdem die lateinischen Begriffe Endometriosis genitalis externa (also Herde auf den äußeren Schichten der inneren Genitalorgane bzw. dem Bauchfell im kleinen Becken) oder Endometriosis genitalis interna (Herde in den inneren Schichten der Genitalorgane wie Adenomyose) oder Endometriosis extragenitalis (Ansiedlung von Herden, die gar nicht im kleinen Becken an den Genitalorganen lokalisiert sind, sondern weiter entfernt, beispielsweise am Zwerchfell, am Nabel, an der Leiste oder auch an Darm bzw. Blase).
Übersicht möglicher Endometrioseherde im Bauchraum
9
Gibt es eine Stadieneinteilung der Endometriose?
Zum besseren Verständnis der Endometriose wurde immer wieder versucht, die Erkrankung zusätzlich zur oben beschriebenen Klassifikation nach der Lokalisation der Herde auch in Stadien einzuteilen. Über viele Jahre wurde die überarbeitete Einteilung der American Society for reproductive Medicine benutzt: das rASRM-System. Das rASRM-Klassifikationssystem beschreibt das Vorkommen von Läsionen auf dem Bauchfell, Zysten und Verklebungen und vergibt Punkte je nach Ausprägung. Stadium I und II beschreiben Bauchfellherde und/oder kleine Zysten, bei Stadium III und IV liegen größere Zysten und ausgedehnte Verklebungen vor. Das System hat die große Schwäche, dass es Läsionen in den Muskelschichten der Gebärmutter (Adenomyose) gar nicht berücksichtigt, auch keine tief infiltrierenden Herde erfasst und somit überhaupt nicht die klinische Situation widerspiegelt beziehungsweise nur einen Teil davon. Meiner Meinung nach ist das auch Mitursache dafür, dass das Wissen um die Endometriose/Adenomyose so beschränkt ist. Denn diese Einteilung ist viele Jahre weltweit angewandt worden, viele operative Studien haben sich darauf gestützt und somit zu einer Fehleinschätzung der Situation geführt. Vor allem die Häufigkeit der Adenomyose wurde deshalb sehr stark unterschätzt. Aber gerade auch die schweren Formen der Endometriose, die tief infiltrierenden Herde, sind damit nicht erfasst worden.
Daher war die Entwicklung des ENZIAN-Scores sehr wichtig. Bei diesem Score werden wie bei einer Tumorklassifikation nun vor allem die tief infiltrierenden Herde der Scheide (A-Kompartiment), der Sakrouterinligamente (B-Kompartiment) und des Darmes (C-Kompartiment) berücksichtigt. Aber auch Blase (FB), Adenomyose (FA) und andere Darmlokalisationen (FI) beziehungsweise ganz woanders liegende Herde wie am Zwerchfell (FO) können kodiert werden. Daraus ergibt sich dann schon ein ganz anderes klinisches Bild. So wurden über mehrere Jahre beide Systeme zur genaueren Klassifikation angewandt, rASRM und ENZIAN. Die Anwendung beider Systeme ist aber aufwendig und wird auch nicht einheitlich durchgeführt. Daher wurde aktuell der #ENZIAN-Score erarbeitet.
Der #ENZIAN-Score
#ENZIAN-Score