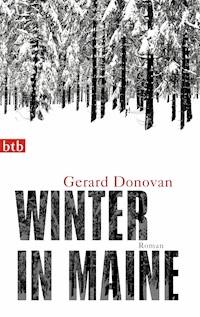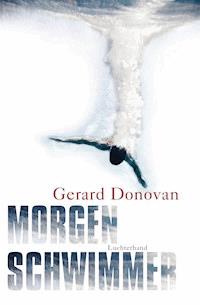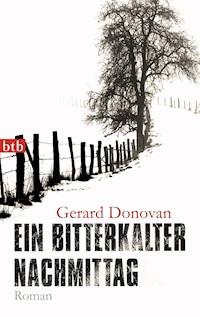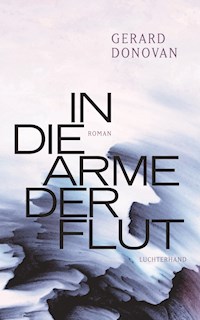
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nebel steigt auf über dem Fluss bei Ross Point in Maine, und auch um die hohe Brücke vor der Mündung ins Meer wallen Nebelschwaden. Dort steht Luke Roy und wartet. Er will springen - schon öfter hat er an Selbstmord gedacht. Als der Himmel endlich klar wird, hört er vom Fluss her Schreie. Ein Ausflugsboot ist gekentert, und ein Junge wird von der Strömung Richtung Klippen und Meer getrieben. Luke zögert nicht: Der Außenseiter wird zum Helden wider Willen, und sein Leben ändert sich auf eine Weise, die er sich nie hätte träumen lassen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Nebel steigt auf über dem Fluss bei Ross Point in Maine, und auch um die hohe Brücke vor der Mündung ins Meer wallen Nebelschwaden. Dort steht Luke Roy und wartet. Er wollte springen – schon öfter hat er an Selbstmord gedacht –, doch nicht ins Ungewisse. Als der Himmel aufklart, hört er im Fluss Tumult und Schreie. Ein Ausflugsboot ist gekentert, und ein Junge wird von der Strömung Richtung Klippen und Meer getrieben. Da springt Luke fünfunddreißig Meter tief ins Wasser und rettet den Jungen, ohne die Folgen zu ahnen: Der Außenseiter wird zum Helden wider Willen, und sein Leben ändert sich auf eine Weise, die er sich nie hätte träumen lassen … Ein packender Roman, der die raue Schönheit der Küstenlandschaft von Maine beschwört und von einem intensiven, verzweifelten Lebenswillen getragen wird. So erbarmungslos wie gewaltig erzählt er von den Kräften der Natur und des Schicksals, die stärker sind, als der Mensch glaubt.
Zum Autor
GERARDDONOVAN wurde 1959 in Wexford, Irland, geboren und lebt heute im Staat New York. Er studierte Philosophie, Germanistik und klassische Gitarre, veröffentlichte Gedichtbände, Shortstorys und Romane. Sein erster Roman »Ein bitterkalter Nachmittag« wurde mit dem Kerry Group Irish Fiction Award ausgezeichnet und stand auf der Longlist des Man Booker Prize. Sein Roman »Winter in Maine« war ein internationaler Bestseller.
Zum Übersetzer
THOMAS GUNKEL, geb. 1956 in Treysa, Erzieher, Studium der Germanistik und Geographie, ist der Übersetzer von u. a. Larry Brown, John Cheever, Stewart O’Nan, William Trevor und Richard Yates.
Gerard Donovan
In die Arme der Flut
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel
Luchterhand
»Es sind nun hundert Jahre, seit unser Kinder fort sind.«
Stadtchronik von Hameln, 1384
DIE BRÜCKE
1.
Es ist der dritte Freitag im Oktober. Luke Roy lehnt am Eisengeländer einer hohen Brücke. Nächsten Monat wird er siebenunddreißig. Er blickt in einen fünfunddreißig Meter tiefen Abgrund hinab.
Als er vor zehn Minuten ankam, blinzelte Luke in die gleißende Sonne, während er die Rampe hinaufging, und blieb in der Mitte der Brücke stehen. Doch inzwischen hat sich das Licht ringsum getrübt.
Die Sonne ist in eine Dunstschicht gehüllt, wirkt so schwach, dass sie sich vom Himmel lösen und herabstürzen könnte.
Wahrscheinlich bloß niedrige Wolken im Osten, denkt er. Die Sonne wird höher steigen, in den blauen Himmel hinauf, wird die Landschaft in ihr Licht tauchen.
Schon seit Wochen werden die Nachmittage kühler und die Abende länger. Doch in den Nachrichten am Morgen wurde ein brennend heißer Tag ohne hohe Luftfeuchtigkeit vorhergesagt. Über Central Maine soll sich am Wochenende eine trockene Hitze breiten. Von der Küste werden dann leichte Windstöße kommen, flattern wie Bettlaken an einer Wäscheleine. Die Wiesen werden sich erwärmen und den Duft von Süßgras verströmen.
An solche Tage können sich die Leute besser erinnern als an den gesamten Sommer. Die kalten Monate sind in einem Traum verstrichen, und die Frühlingsblumen warten direkt unter der Erde. Es ist ein Geschenk, abgelegt auf der Schwelle eines Morgens.
Luke wird nicht da sein, um den Beginn dieses verheißenen Tages zu erleben.
Das Städtchen Ross Point liegt zwei Kilometer flussaufwärts. Auf dieser Seite der Brücke haben die Erbauer die Felsen aus dem Fluss gebaggert. Wer dort hinunterspringt, hat gute Chancen zu überleben.
Aber das ist nicht die Seite, für die er sich entschieden hat. Er hat das Gesicht dem Meer zugekehrt. Unter ihm strömt der Fluss in eine enge Schlucht, in der die Ingenieure die Natur unberührt ließen.
Wenn er nicht beim Aufklatschen auf dem Fluss den Tod findet, dürfte er auf einen der großen Felsen prallen, die tückisch im Wasser verstreut sind. Manche ragen hervor, andere liegen einen halben Meter unter der Oberfläche, getarnt als schimmerndes Lichtspiel – nicht zu erkennen als Steinmassen, die sich jahrhundertelang nicht mehr vom Fleck gerührt haben. Wenn er mit Tempo achtzig dort aufschlägt, dürften die Knochen in der weichen Hülle seines Körpers zersplittern.
Sollte er zwischen die Felsen stürzen und überleben, werden ihn die zahllosen Steine im Flussbett wie Messer zerschlitzen.
Und sollte er irgendwie auch dieses Geröllfeld überleben, wird ihn der reißende Fluss ungestüm ins Meer hinaustreiben. In dem Drang, sein Leben zu retten, könnte er versuchen, ans Ufer zu schwimmen. Doch mit jedem Zentimeter, den er vorankäme, würde er fünf Meter näher ans Meer gespült werden und in der tückischen Strömung unweigerlich ertrinken.
2.
Von da, wo Luke am Geländer lehnt, kann er meilenweit sehen.
Der Fluss ergießt sich in den Meeresarm, der sich zur Chandler Bay weitet. Zehn Kilometer weit draußen trennt eine Inselgruppe die Bucht von der Schwelle, an der der Meeresboden zu den ersten Atlantikwogen abfällt – den ersten bedrohlichen Regungen eines Ozeans.
Vor den Inseln ankern zwei Containerschiffe – beides Stahlkolosse, vermutlich um die dreihundert Meter lang. Er beobachtet, wie die gelben Tupfen ihrer Deckleuchten zu Grau verblassen. Die riesigen Schiffe verlieren ihre Silhouette an denselben Dunst, der die Sonne ereilte.
Plötzlich sieht er sie nicht mehr.
Das ist das Land der tausend Nebel.
Vor der Küste von Maine mündet ein Teil des Golfstroms in kältere Breiten. Wenn das Wasser verdunstet, bilden die Tröpfchen kalte Wolken, die zu schwer sind, um aufzusteigen. Manche dieser Wolkenfetzen lösen sich, kaum sind sie entstanden, gleich wieder auf. Sie hängen an Gartenbäumen oder schweben als Schemen über kleinen Teichen.
Näher an der Küste kräuselt ein frischer Wind die Wellen in der Bucht, und die Trawler brechen zu den Fischgründen auf. Die Möwen folgen ihnen in Erwartung der Fische, die irgendwann zum Vorschein kommen müssen, in Knäueln und Schwärmen über den hüpfenden Bootsrümpfen, die aufs Wasser klatschen und Gischt aufspritzen lassen.
Doch als sie die Mitte der Bucht erreichen, flaut der Wind ab. Etwas nähert sich.
Auf dem spiegelglatten Wasser wird das Tuckern der Motoren viel leiser, und die Boote gleiten in den zunehmenden Dunst. Die Kapitäne in ihren Ruderhäusern lösen sich in Gespenster auf. Die Möwen schlagen mit den Flügeln und folgen ihnen ins Nichts.
Luke bleibt, wo er ist, und beobachtet alles. Von der Brücke bis zur Küste sind es nicht mal zwei Kilometer. Er hat noch nie einen so schnell aufziehenden Nebel gesehen.
Vielleicht ist es ja gar kein Nebel.
Dieses Ding, das über das offene Wasser treibt, hat keine Ränder, keine Oberkante, die es vom Himmel trennt. Vom Wasser scheint eine Feuchtigkeit aufzusteigen, die auf die Entstehung der großen Nebelwand wartet.
Die Chandler Bay ist inzwischen unsichtbar.
Kurz blitzt eine Erinnerung auf.
Er sieht ein Land, das stets voller Sonnenlicht ist. Dieses wunderbare Land hat Luke erstmals als Kind erblickt, beim einzigen Mal, als er in einem Flugzeug saß. Nach dem Start flogen sie eine Minute durch tristes, feuchtes Wetter hinauf, bevor sie die Membran aus Regen und Kälte durchstießen. Von seinem Fensterplatz aus sah er, wie sich auf allen Seiten eine unbegrenzte neue Landschaft erstreckte, schattiert von schwerelosen Bergen und Tälern, alles unter reiner Sonne in reines Blau gehüllt. In seinen Kinderträumen war das der Ort, an dem die Engel wohnten.
Diese Gedanken dienen bloß der Zerstreuung. Sein Körper kämpft sich durch Erinnerungen, die ihn aufhalten sollen, bis er es sich anders überlegen kann.
Zeit zu gehen.
Er legt die Hände aufs Geländer und schließt die Augen.
3.
Der Fluss unter ihm ist still.
Es heißt, Wasser sei überall gleich. In den über vorstädtische Wodkanachmittage verteilten Swimmingpools, in den riesigen, vom Kap heranrollenden Wellenwänden oder dem innigen Frieden des Saltonsees.
Wer das gesagt hat, war noch nie auf dieser Brücke.
Die zerklüftete Küstenlinie von Maine erstreckt sich über 5597 Kilometer – eine größere Strecke als die über den Atlantik. Und trotz dieser Strecke gibt es dort keinen Fluss, der gefährlicher wäre als der, der unter ihm strömt.
Von der Quelle in den West Hills fließt der Moss River in sanftem Gefälle meerwärts, vorbei an bewaldeter Landschaft und dem hohen Gras üppiger Weiden. Auf diesen herrlichen zwanzig Kilometern ist er ein Jane-Austen-Fluss, ein romantisches Gedicht, an einem traumverlorenen Tag von einem Schüler vorgetragen, der sich danach sehnt, dem klebrigen Tisch des Klassenzimmers zu entfliehen. Das ruhige Wasser ist ein Ort für sommerliche Hausboote und lange Tage trägen Angelns, die man auf Felsvorsprüngen und Sandbänken verbringt. Man lässt sich mit einem Stuhl an einem der Rastplätze nieder, die das Ufer säumen.
Das Laub ausladender Eichen sprenkelt die Seiten eines gemächlichen Buches, das man in Händen hält. Schläft man ein, fließt beim Erwachen derselbe Fluss.
Doch sobald er Ross Point erreicht hat und an der alten Papierfabrik, einem finsteren Gebäude aus Stein und Glas, vorbeiströmt, nimmt der Fluss auf starkem Gefälle zum Meer an Fahrt auf.
Vor dreihunderttausend Jahren wurde die Küstenlinie durch ein Erdbeben um etwa drei Meter abgesenkt. Dabei wurden uralte Bäume überflutet, die einen Sandstrand säumten. Der Strand versank und ließ stattdessen eine Felsküste und einen Sumpf zurück.
Als das Erdbeben den Sandstrand zerstörte, kaperte das Meer den Fluss und vergrößerte sein Gefälle. Die Flut strömt nun fünf Kilometer landeinwärts, bevor sie sich wieder zurückzieht.
Den Einwohnern ist diese Abfolge wohlbekannt. Deshalb halten sie sich vom Flussufer fern.
Zuerst setzt die Flut ein. An der Mündung sammelt sich das Treibgut von seetüchtigen Booten. Unter der Brücke steigt das Wasser, bis nur noch die Spitzen der darunterliegenden Felsen herausschauen wie die Augen lauernder Krokodile.
An der Oberfläche entsteht wie beiläufig eine Falte, die flussaufwärts rollt. Eine zehn Zentimeter hohe Welle. Für einen Fremden mag sie etwas Gefälliges haben.
Auswärtige Vogelbeobachter hat man schon »Seht euch das doch mal an!« rufen hören.
Kurz bevor die Welle sie erreicht, werden ihre Stiefel vom Wasserdruck zusammengequetscht, und der Fluss steigt ihnen rasch bis über die Hüften. Arm in Arm taumeln sie ans Ufer und husten das Wasser aus, das sie geschluckt haben.
Später fragen sie sich, warum sie nicht rechtzeitig geflüchtet sind.
Die Flut zieht an der Stadt vorbei. Dann schwächt sich der Drang des Meeres allmählich ab, bis der Fluss von beiden der Stärkere ist.
Die gegnerischen Wassermassen schließen einen Waffenstillstand. Vierzig Minuten lang ist Ross Point eine Ansichtskartenidylle.
In dieser Kampfpause ist die Stille das lauteste Geräusch. Die Leute berichten, dass selbst der Gesang der kleinsten Vögel nicht länger hinter dem Schleier des rauschenden Wassers verborgen ist. Die Fische patschen den Lärm aus dem Fluss heraus; im Wald tritt jemand auf einen Zweig. An kalten Wintertagen dröhnen aus den Holzfällerlagern westlich der Stadt die Kettensägen. Boote tuckern mit Kleinmaterialien als Fracht von Ufer zu Ufer.
Wenn die Flut sich zurückzieht, sinkt sie anfangs nur alle paar Sekunden um wenige Zentimeter. Die Wasservögel harren nicht aus. Sie paddeln unverzüglich in höher gelegenes Terrain.
Sobald die Strömung Schritttempo erreicht hat, drängen sich Stöcke in Strudeln zusammen, und eine gekräuselte Welle gleitet flussabwärts.
Am Ende dieses Schauspiels hat der Fluss die Oberhand gewonnen. Während die Strömung stärker wird, reißen sich in den Lagern flussaufwärts Baumstämme los. Sie werden zu langen, langsam dahintreibenden Geschossen, die sich nicht aufhalten lassen. Sie haben schon die Rümpfe von zehn Meter langen Booten durchbohrt. Einer trieb in einen Pier und verwandelte die Trümmer in ein driftendes Floß.
Wenn das aufgewühlte Wasser die Biegung in der Nähe der alten Fabrik erreicht, hat die tosende Strömung ein Tempo von fünfundzwanzig Stundenkilometern. Alles auf dem Fluss ist dann Teil des Flusses.
Jedes Jahr reißen sich Boote los, die nicht richtig vertäut sind, und rauschen immer schneller auf ein vor ihnen liegendes schreckliches Brodeln zu.
Die Gesichter der Leute an Bord werden blass, wenn sie unter der Brücke hindurch über die Grenze zwischen Trost und Vernichtung strömen, zwischen Lyrik und Blut.
Vor ihnen türmen sich die Felsen auf. Die Kaskade eines sich zurückziehenden Meeres schwemmt sie in den schäumenden Rachen eines neugeborenen Wasserfalls.
Das ist die Todeszone.
4.
Seit Lukes Ankunft an der Brücke sind zwanzig Minuten verstrichen. Er ist noch immer hier oben, der Fluss noch immer dort unten. Er hätte sich über Ebbe und Flut informieren sollen. Der Fluss ist in Bewegung, doch die Felsen sind nicht zu sehen.
Vielleicht sollte er noch warten.
Er ist überzeugt, dass er beim Abschied keine grandiosen Einsichten haben wird. Er kann nur auf ein Ende mit stillem, reinem Geist hoffen. In der Zeitung hat er mal einen kurzen Artikel über so einen Tod gelesen. Eine Frau, die in New York mit ihren Hunden spazieren ging, trat mitten auf einer belebten Straße auf einen unter Strom stehenden Kanaldeckel. Der Person zufolge, die hinter ihr ging, bekam sie einen starren Blick, sagte: »Also darum geht es hier«, und kippte tot um. Der Artikel war nur zwei Absätze lang.
Über das, was nach dem Ende des Lebens geschieht, wurden schon zahllose Filme gedreht. Er fand, dass ihre Geschichte die gesamte Titelseite verdient hätte.
Luke hofft, genau wie diese Frau zu sein, aber da ist er sich nicht so sicher. Vielleicht wird er im Fallen schreien, von Entsetzen überwältigt und den Himmel verfluchend, während die Keule des Flusses heraufschwingt und ihm in einer purpurroten Implosion den Schädel zertrümmert. Und die ganze Zeit wird sein Herz an die Wände seiner Brust hämmern, um hinauszugelangen und einen anderen Körper zu finden.
Er konzentriert sich auf die Küste.
Der Nebel hat seinen grauen Schatten zehn Kilometer über die Bucht geschleppt und an der Küstenlinie innegehalten, eine gigantische träge Woge, die sich nicht bricht. Der sanfte Gletscher hat seinen Vorwärtsdrang eingebüßt.
Luke ist sicher, dass der Nebel dort hängenbleibt und in der Sonne verdorrt.
Doch der Wind, der von den landeinwärts gelegenen Hügeln weht, ist nicht so stark, dass er ihn über dem Wasser festhalten kann. Dieses gespenstische Wesen ist nicht zu bremsen. Nebelstreifen ringeln sich aus der Schlucht unterhalb von Luke herauf und kriechen die Böschung entlang. Der Nebel streckt seine Fühler nach Nahrung aus.
Über der Wolke befindet sich kein azurblaues Paradies. Die Sonne ist nur ein im Nebel verborgener, blutloser Fleck. Vielleicht hat sich Luke längst hinabgestürzt, und lediglich sein innerster Kern ist hiergeblieben, während sein Leben allmählich erlischt. Auch er ist ein Nebel.
Er sieht die Hülse seines Körpers zusammengekrümmt inmitten der Felsen, zwischen die er gestürzt ist.
Nichts wird an dem, was geschieht, etwas ändern, und auch das, was geschieht, wird nichts ändern. Lukes Leben hat in dem Städtchen Ross Point seine Spuren hinterlassen wie eine flüchtig gekritzelte, an eine Wolke geheftete Nachricht. Er ist nur ein Schemen, kein Mensch.
Er ist keiner, an den sich die Leute erinnern werden.
Im Augenblick seines Todes wird sich im Chambliss Diner an der Main Street jemand bei der Kellnerin für ein Omelett bedanken. Ein Bus verlässt eine Haltestelle. In einem Motel wird eine Zimmertür aufgestoßen, und eine Hand überprüft das Wetter, bevor sie einen Koffer nach draußen rollt.
Wenn er im seichten Fluss zerschmettert wird, wird der Tag weitergehen. Mittagessen. Abendessen. Sonnenuntergang. Die Mechanik des Mondes wird den Fluss gemäß den im Kalender verzeichneten Zeiten durch sein Bett spülen – ohne Rücksicht darauf, wer am Leben oder wer tot ist. Luke wird in die Arme einer Flut stürzen, die seinen Namen nicht kennt.
Wenn er Pech hat und flussaufwärts in die Stadt treibt, wird er auf dem Präsentierteller liegen. Man wird ihn aus dem Wasser ziehen und ihm einen Namen geben.
Anfangs werden sie von einer Leiche sprechen.
Eine Leiche wurde entdeckt. Er wird das Thema einer Kurzmeldung in der Lokalzeitung sein.
Irgendwer wird die Bemerkung machen: »Sieh mal an, Luke Roy wurde vor zwei Tagen aus dem Fluss gefischt. Das überrascht mich nicht.«
»Hast du ihn gekannt?«
»Nein – darum geht es ja. Keiner kennt ihn.«
Im Radio: »Die Nachrichten von heute Morgen. Ein Einbruch. Ein Autounfall. Im Fluss wurde eine Leiche entdeckt. Der Name des Toten ist unbekannt. Das Wetter ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Morgen im Laufe des Nachmittags Gewitter.«
Nein. Er muss aufs Meer hinausgetragen werden, durch die Dynamik des Wasserfalls so weit vom Strand weggetrieben, dass die Flut ihn nicht zurückspülen kann. Die Schmach, flussaufwärts zu dümpeln, wird ihm nach seinem Tod egal sein, aber jetzt ist sie es nicht.
Das beste Grab ist das Meer.
Leichen sind normalerweise schnell unterwegs. Ein Krankenwagen braust von einem Autounfall davon. Eine fahrbare Trage wird aus einem Krankenhauszimmer gerollt, während sich die Verwandten eines frisch Eingelieferten mit besorgten Fragen an der Aufnahme versammeln. Ein Fuchs, der vom Betonmittelstreifen auf einer verkehrsreichen Straße gestoppt wurde, liegt da, von einem vorbeifahrenden Wagen überrollt. Die Geier kreisen in Spiralen vom Himmel herab.
Nur wenige Menschen verharren in einem Schnappschuss ihres letzten Atemzugs: verirrte Kletterer am Everest, Schiffbrüchige in der Arktis, Römer, die an einem Strand in Italien von einem Vulkan überrascht wurden, ihre Todesangst in Lava gemeißelt.
Er sieht, wie seine Leiche dort unten festhängt.
Die Stadt darf nicht das letzte Wort über ein Leben haben, für das sie sich nie interessierte. Es braucht nur einen einzigen Menschen, der nach ein, zwei Tagen über die Brücke geht und zufällig nach unten blickt – und schon wird man ihn fotografieren. Er wird auf zahllosen Bildschirmen zu sehen sein.
Bei der ersten Welle des aufziehenden Nebels neigt Luke den Kopf und lauscht. Er hört fließendes Wasser, das er nicht sehen kann. Er wartet noch eine Weile, weil er nicht weiß, ob Flut oder Ebbe ist. Wie schwer wäre es gewesen, das herauszufinden, bevor er das Haus verließ?
Manche, die nach einem Sprung von einer hohen Brücke den Aufprall auf dem Wasser überlebt haben, sagten, sie hätten ihre Entscheidung bereits zu Beginn des freien Falls bereut. Ein Mann, der von der Golden Gate Bridge sprang, sagte, sobald er losgelassen habe, habe er gewusst, dass er all seine Probleme lösen konnte, nur den Sprung konnte er nicht rückgängig machen.
Das war eine einseitige Betrachtungsweise.
Vielleicht empfanden es nur die Überlebenden so. Die Erfolgreichen kann keiner mehr fragen. Von den Toten ist kein Zeugnis erhalten.
Bei einem Sturz aus großer Höhe kann vieles schiefgehen. Luke riskiert einen Blick: Der Abgrund ist unbarmherzig, ihm dreht sich der Magen um. Am Fallen ist nichts gerecht – daran, wer überlebt und wer stirbt.
Im Zweiten Weltkrieg fiel ein Pilot in neuntausend Metern Höhe aus einem getroffenen Bomber. Er stürzte in schrägem Winkel auf einen verschneiten Berghang, rollte eine Ewigkeit abwärts, bis er irgendwann zum Stillstand kam und sich aufsetzte.
In Mississippi sprang in den neunziger Jahren ein anderer Mann von einer zwanzig Meter hohen Brücke.
Er landete neben dem Fluss im Schlamm und brach sich sechs Rippen und beide Beine. Außerstande aufzustehen, kämpfte er sich dort zwanzig Minuten lang ab, bis er schließlich erstickte. Er wurde tagelang nicht entdeckt, obwohl es an diesem belebten Samstag über ihm auf der Brücke nur so von Menschen wimmelte, die Einkäufe machten.
Er hatte den Fluss verfehlt.
Niemand blickte beim Überqueren der Brücke übers Geländer. Die Leute kannten den Anblick des Flusses.
Luke betrachtet den wabernden Dunst. Wenn die Nebelwand ihn erst erreicht hat, wird er nichts mehr sehen können.
Die Böschung fällt an beiden Ufern steil, aber schräg ab. Am Grund der Schlucht ist der Fluss schmaler, als er aussieht. Ohne sichtbare Anhaltspunkte könnte er durchaus gegen eine der Felswände krachen und halbtot in einen der Tümpel auf den Uferterrassen stürzen, die Regenwasser und alles mögliche Geröll auffangen. Diese natürlichen Balkone sind ein, zwei Meter breit. Gewöhnlich wimmelt es auf dem braunen, matschigen Boden von Insekten und lauerndem Kleingetier. Frösche verbringen den ganzen Nachmittag in der Tarnung der durchnässten Grassoden.
Nicht tief genug, um ihn zu töten, aber ausreichend, um ihn aufzufangen und am Leben zu halten, so schwer verletzt, dass er sich nicht bewegen kann. Das wäre der schlimmste Tod. Er könnte noch tagelang am Leben sein.
Es darf ihm nicht wie dem Mann aus Mississippi ergehen.
Der Tod ist das eine, das Sterben etwas anderes. Er wird nicht zulassen, dass er so stirbt, wie er gelebt hat – voller Angst und Qual. Die Länge des Sturzes ist nur ein Teil der Gleichung. Bei der Landung im Wasser beginnt der sichere Tod bei einer Höhe von fünfzig Metern, es sei denn, man kommt kerzengerade auf.
Ab siebzig Metern spielt es keine Rolle mehr, wie man aufs Wasser trifft. Er wird so schnell draufklatschen, dass es hart wie Beton ist. Dann werden seine Rippen zu Sensen. Sie durchbohren Milz, Lunge und Herz.
Überall auf der Welt betreten die Verlorenen hohe Brücken, um in einen goldenen Sonnenuntergang zu springen. Doch sie landen auf spitzen Messern.
Luke braucht nicht über Wasser oder Knochen nachzudenken. Wegen der Felsen dort unten hat er bei fünfunddreißig Metern keine Überlebenschance.
Das ist letztlich die Berechnung, die zählt.
In einem englischen Gedichtband hat Luke mal ein seltsames Bild gesehen. Es gibt Hunderte von Schultagen, die er längst vergessen hat, doch an diesen einen kann er sich noch erinnern. Das Bild zeigte eine in See stechende Galeone. Die Mannschaft war an Deck beschäftigt. An Land pflügte ein Bauer mit einem Ochsen seinen Acker. Ein paar Meter von dem Schiff entfernt stürzte ein Gewirr aus Fleisch und Flügeln kopfüber ins Wasser. Offenbar war ein geflügelter Junge vom Himmel gefallen. Die Galeone strebte dem Meer entgegen. Der Bauer wollte die Furche für die Aussaat zu Ende bringen.
Ein kurzer Augenblick, und der Junge ist verschwunden.
So wird’s gemacht.
Luke zögert, ruft sich jedoch ins Gedächtnis, dass die Überwindung dieser Barriere nichts anderes ist, als über einen Zaun zu klettern. Er hatte nie Angst, über den Zaun um einen Spielplatz zu steigen – also gibt es auch jetzt keinen Grund, sich zu fürchten, wenn er nicht nach unten blickt.
Die Eisenstangen sind in den Betonplatten unter den Planken verankert und fühlen sich wackelig an, wirken aber stabil genug, als er daran rüttelt. Oben sind sie so breit, dass er kurz darauf balancieren kann.
Er springt hinauf und richtet sich auf.
Das Geländer schwingt ein paar Zentimeter weit, und er neigt sich sofort zur Seite, schlingt die Stiefel um die Stangen und klammert sich fest. Er sieht sich schon in Purzelbäumen mit einem Teil des Geländers in die Tiefe stürzen. Wenn man ihn findet, wird er sich, das Gesicht dem Himmel oder dem Wasser zugekehrt, daran festklammern. Dann dürften die Leute es für einen tragischen Unfall halten. Sie werden sich über die Grausamkeit des Schicksals wundern.
5.
Jeder kann den Moment benennen, in dem seine guten Zeiten ein Ende fanden, den Tag, der das Vorher und Nachher im Leben voneinander trennt. Von da an kennt man eine Wahrheit, die man nicht erklären kann. Etwas ist zu Ende gegangen, und etwas anderes hat begonnen.
Dieser Tag kam für Luke mit vierzehn.
Das Schuljahr war vorbei. Er feierte mit vier Freunden den Sommeranfang. Die trägen Tage der plötzlich Befreiten sind am allerlängsten, und er brauchte keine Pläne zu machen. Der Tag würde sich vor ihnen ausbreiten und sie in sich aufnehmen.
An einem Steg gab es Anlegestellen für Freizeitboote und Flöße. Sie mieteten ein Ruderboot und fuhren auf den Serenity Pond hinaus. Es war ein geschützter Ort für Sommernachmittage und Sandwiches. An einem Baum schwang ein Reifenschlauch. Zwischen dem Farn auf dem angrenzenden Land blühten Wildblumen. Im Herbst flogen am endlosen Himmel Kanadagänse in Pfeilformation.
Der Teich lag einmal mitten auf einem Feld, bis er sich irgendwann zu einer natürlichen Bucht ausweitete. Jahrhundertelang schirmten ihn Schlammablagerungen vom Fluss ab, bis auf die schmale Mündung der Bucht, etwa fünfzehn Meter breit. Es gab keine Grenze, die das Ende des Teichs und den Anfang des Flusses gekennzeichnet hätte; das ruhige Wasser verschmolz mit Strudeln, die zweimal täglich zum Leben erwachten. Auf der anderen Seite rauschte ein erbarmungsloser Fluss vorbei.
Seine Großmutter hatte Luke oft vor dem Ort gewarnt. Eingeschlossenes Wasser, sagte sie immer – tiefe Steinbrüche, ruhige Teiche, träge Kanäle –, verheiße nichts Gutes.
Wie das riesige, klebrige Blatt einer tödlichen Blume habe der Teich Hunderte unbekannte Opfer in die Falle gelockt, die auf ihrem Weg dort vorbeigekommen seien. Er nähre sich von den Sorglosen, hatte sie ihm erzählt. Etwas, das älter als die Geschichte sei, beobachte, wie einsame Schwimmer das samtige kühle Wasser unter den Bäumen durchquerten. Der Serenity Pond wisse genau, wo auf seiner Oberfläche sie mit rhythmischen Arm- und Beinbewegungen eintauchten und ihren Geruch zu verströmen begännen. Im dumpfigen Zwielicht der Tiefe spürten die langen Wasserpflanzen die Musik eines Schwimmers.
In den zwanziger Jahren sprang ein gesunder junger Mann, dessen Familie in der Nähe ein Grundstück besaß, in den Teich. Eine Stunde später fühlte er sich plötzlich unwohl. Und einen Monat später war er ein Krüppel.
Im Gegensatz zu anderen Familien war seine einflussreich. Ärzte aus Boston kamen in die ländliche Gegend, um ihn zu untersuchen. Sein einst kräftiger Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen. Seine Augen waren Höhlen, aus denen er die Frustration der Ärzte beobachtete. Sie gingen paarweise im Garten des Familienwohnsitzes auf und ab. Es war eine Blutkrankheit. Nein, es war ein Virus aus einer fernen Vergangenheit, das in jenem Gewässer überlebt hatte.
In den vierziger Jahren erkrankten drei Frauen wenige Tage, nachdem sie im Serenity Pond geschwommen waren, an Neurasthenie. Sie waren mehrfach ausgelassen von den Ästen der Bäume ins Wasser gehüpft. Die Ärzte dachten, sie könnten sich durch zu ungestüme Sprünge eine Bakterieninfektion im Gehirn zugezogen haben. Monate später wurden knochige Gestalten in Autos verfrachtet; man sah sie nie wieder.
In den sechziger Jahren wurden acht Menschen nach einem Bad im Teich krank. In den Achtzigern erlitt ein Junge durch Meningitis einen Gehirnschaden. Die Unglücksfälle vergessener Schwimmer bleiben nicht im Gedächtnis haften. Jedes Mal war es neu.
Forscher kamen und nahmen Proben. Wissenschaftler blickten durch Mikroskope.
In einer Petrischale vergrößert, wurde das zitternde Etwas betrachtet, das in den unergründeten Tiefen gedieh. Für Biologen war es ein Bakterienstamm. Sie konnten den Weg seiner Reise in die heutige Zeit jedoch nicht zurückverfolgen.
Das waren die Geschichten, die seine Großmutter ihm erzählte.
Der Serenity Pond war schon lange vor der Stadt da. Er tötete ohne Mitleid, ohne Böswilligkeit.
Unter der glatten Oberfläche ist es noch wie vor hundert Millionen Jahren.
Luke schenkte der Warnung keine Beachtung, da sie von seiner Großmutter kam. Solche Geschichten gehörten zum Gedächtnis alter Leute, die sich genauso viel ausdachten, wie sie in Erinnerung hatten.
An jenem ersten freien Sommertag tranken Luke und seine Freunde Bier und ließen sich, die Ruder aus dem Wasser gehoben, im Kreis treiben. Sie redeten über Janice Macy, die ein Schuljahr unter ihnen war. Alle fanden, dass schöne Mädchen einsam seien, weil niemand bei ihnen sein Glück versuche, doch das war Unsinn, denn sie baten sie alle um eine Verabredung, erhielten einen Korb und ließen es dabei bewenden.
Jeder trank seine Flasche Bier, und zwischendurch warfen sie sich in dem kleinen Boot einen Football zu. Mit einem der Ruder übten sie Baseball. Irgendwer traf Luke im Nacken. Er ging über Bord und sank benommen hinab, bis seine Beine unwillkürlich zu strampeln begannen und er an Ort und Stelle blieb.
Zunächst fiel ihm auf, dass die Sonne das Wasser erwärmte. Er sah ihren heißen weißen Kranz in der Nähe des Bootes treiben.
Er war nur ein, zwei Meter unter Wasser. Die anderen konnten ihn bestimmt sehen. Der Bootsrumpf schien so nah zu sein, dass er ihn mit ein paar Beinstößen erreichen könnte.
Doch er versuchte es nicht.
Er hielt unwillkürlich die Luft an und schwebte im Wasser. Über ihm schwankte das Boot, und die Ruder schnarrten wie ein schwerfälliges Insekt, das im Kreis flog.
Wie durch eine Luftpolsterfolie hörte er Stimmen:
»Luke! Luke!«
Die Silhouetten seiner Freunde bewegten sich wie die Puppen in einem Kaspertheater. Er genoss den Anblick. Das Wasser in seinen Ohren dämpfte die Schreie. Sie murmelten ihren Text, doch er erkannte die Wörter nicht, denn sie waren nicht mehr in seinem Gedächtnis gespeichert. Es waren durch Zwischenräume getrennte Geräusche.
Dass er wie gelähmt war, machte ihm keine Angst, er verspürte nicht den Drang, sich zu retten. Die beiden Ruder durchstießen das Wasser und vermischten es mit dem milchigen Sonnenlicht, das seinen Blick fesselte. Eins streifte seinen Arm, und er beobachtete, wie es sich wieder entfernte. Es stellte keine Bedrohung dar, also schenkte er ihm keine Beachtung.
Gesichter erschienen an der Wasseroberfläche und machten hohle Geräusche.
»Luke!«
Der Teich war sieben, acht Meter tief, die Luft in seiner Lunge fast aufgebraucht. Von unten, da war er sich sicher, drang ein anderes Geräusch herauf. Er drehte sich zum Grund des Teiches um.
Es war ein sehr friedlicher Augenblick.
Die Sonne war hier unten von Wasserpflanzen und Steinen getönt. Immer weniger ging ihm durch den Kopf. Seine Sinne waren seine Gedanken, und er gab sich dem hin, was er spürte, was er sah.
Ihm war so wunderbar warm. Die Wärme auf seinem Rücken, während er mit dem Gesicht nach unten trieb, die kühle Fülle am Grund. Schlauchförmige Sonnenbogen durch ein grünes Unterwasserorchester.
Er beschloss, hier unten zu bleiben, weit weg von der Hektik dort oben.
Das Leben war so nah, dass er loslassen konnte. Urplötzlich ergab sich die Möglichkeit, aus dem Leben zu scheiden, solange er noch glücklich war. Gelegenheiten haben nie einen Namen. Sie kommen und sind schon im nächsten Moment vorbei.
Er gab sich keine Mühe, die Richtung zu wechseln, und driftete in einem warmen, betäubenden Lufthauch. Er war reiner Impuls, ohne Anfang und Ende. Er bewegte sich zu dem Lied, das er auf dem Grund des Teiches hörte. Jeder Herzschlag des Liedes war sein eigener Herzschlag.
Als Kind hatte er geglaubt, es gebe die Welt nicht, wenn er nicht hinsah. Sie bringe nur Dinge hervor, sofern sie benötigt wurden, je nachdem, wo im Haus oder draußen er sich aufhielt. Vertraute Dinge existierten nur so lange, wie er sie betrachtete. Sein Teddybär saß auf dem Kissen, bis Luke wegschaute, dann verschwand er. Der Fußboden eines Zimmers, das Luke verließ, verwandelte sich in schwarze Leere, sobald er die Tür schloss.
Friedlich ein paar Meter unter Wasser treibend, begriff er, dass er vielleicht doch recht gehabt hatte. Jetzt, mit vierzehn an einem Sommertag, war ihm nicht bange, das zu verlieren, was er gekannt hatte – er brauchte es nicht mehr, denn er würde sterben.
Er sah Spuren des Unheils, die er nicht gesehen hatte, als er am Morgen zur Schule aufgebrochen war. Die Gebäude in der Stadt nahmen Gestalt an, als er sich näherte, verschwanden aber, sobald er vorbeigegangen war. Dächer rutschten herab. Laternenpfähle bogen sich, um mitzukommen, und zerbrachen, wenn sie sich nicht weiter dehnen konnten. Ganze Straßen hinter ihm ihres Asphalts entkleidet und zusammengeklappt.
Während unter Wasser die Sekunden verstrichen, begann er, sich aufzulösen.
Sein Name. Er besaß keinen mehr.
Als Nächstes kamen ihm seine Freunde oben im Boot abhanden. Es machte ihm nichts aus, dass er sich nicht mehr erinnern konnte, wie sie aussahen und wie er sie kennengelernt hatte. Er wusste nicht mehr, wie er selbst aussah oder das Haus, in dem er wohnte. Und es machte ihm auch nichts aus, als seine Kindheit verschwand. Er konnte sich nicht erinnern, jemals jünger als jetzt gewesen zu sein.
Er begriff, was mit ihm vor sich ging. Er wurde in diesem wunderbaren Wasser in seine Einzelteile zerlegt, wie Sand, der Körnchen um Körnchen durch den Trichter einer Sanduhr rinnt. Eine Welt leerte sich von Luke Roy, und die nächste füllte sich mit ihm.
Die Zeit blieb stehen und verwandelte sich in einen Lichtstrahl auf den grünen und braunen Felsen am Grund. Er schwirrte in sanften Strömungen. Der gelbe Kreis oben warf Schatten auf den Boden des Teiches, wo Luke in Sicherheit war. Er atmete, indem er sich vorwärts und seitwärts schlängelte. Seine Augen wurden zu schmalen Schlitzen.
Ein Ruderblatt traf ihn an der linken Schläfe.
Er strampelte heftig; die langen Wasserpflanzen hatten sich halb um seine Beine geschlungen – hatten ihn schon fast umschlossen. Ein kräftiges Maul in dieser schwimmenden Masse suchte mit seinen kalten, klebrigen Lippen eine Stelle an Lukes Rücken, in die es hineinbeißen konnte.
Er versuchte, nach dem Ruder zu greifen, und wand sich in Krämpfen, als zwei Jungs ins Wasser sprangen und seine Beine befreiten. Die anderen packten ihn an den Haaren und holten ihn mit Hilfe eines Ruders aus dem Wasser. Es war eine ausgesprochen grässliche Rettung.
»Mann, Scheiße, Luke!«
Sie lösten die Ranken, die sich wie Fesseln um seine Arme und seinen Hals gelegt hatten.
Die Sonne verbrannte seine Haut. Er war nicht dazu geeignet, über Wasser zu leben. Er konnte nicht sprechen, er konnte nicht atmen. Noch vor wenigen Augenblicken hatte er weder das eine noch das andere tun müssen.
»Zwei Minuten!«, sagte einer seiner Freunde. »Wie hat er das geschafft?«
Sie sahen, dass Lukes Augen geschlossen waren und er nicht atmete. Die Jungs waren verzweifelt. Sie pressten mit den Händen auf seine Brust, zählten einen Rhythmus ab, und dann prügelten sie einfach nur in einem Gewirr von Fäusten auf ihn ein. Während sie zuschlugen, hüpfte er auf und ab, ein schlaffer Hautsack. Jemand zertrümmerte am Heck eine Flasche Apfelwein und stach ihm in die Seite, und Luke stieß einen Schmerzensschrei aus und spie Teichwasser hervor. Sie ließen ihn hustend auf den Boden des Bootes gleiten, drehten ihn auf die Seite und ruderten aufs Ufer zu, warfen alle Flaschen weg und prägten sich ein, was sie sagen wollten.
Während die Ruderschläge das Boot vorwärtstrieben, spürte Luke durch den Rumpf das Beben des Wassers. Er sah sich das Boot noch immer von unten an, beobachtete, wie die Wasserpflanzen in einem langsamen Tanz in die Tiefe zurückglitten, ein uralter Traum, der nach ihm gesucht hatte. Der Traum hörte seinen Namen. Er kannte ihn jetzt.
Luke hätte bleiben sollen, wo er war, hätte das Ruder herumstochern und die Jungs Hilfe holen lassen sollen. So mild und süß, der Geruch warmen Wassers. Der Betäubungsstoff strömte durch seine Adern.
Am ersten sonnigen Tag des Sommers 1991 war Luke Roy dem Tod genauso nah gewesen wie dem Leben. Etwas Altes hatte ihn mit einem Traum angesteckt, der schwerelos war.
Und dieser Traum würde ihm überallhin folgen.
6.
Wochenlang studierte ihn diese Ansteckung wie ein Lied, das sie vortragen musste.
Ihr Körper formte sich zu seinem Körper. Sie bereitete sich auf den Schlaf vor, sobald sein Kopf das Kissen berührte. Er hatte seine eigenen Träume, dieser Geist, der ihn zu einem Geist machen wollte.
Er traute sich selbst nicht mehr. Kein langer Lebensabend mit Strohhut vor einem verbrauchten Ausblick. Sein Ende würde an einem ansonsten unscheinbaren Tag kommen, das Aufflammen eines Zwangs.
Er würde seinen letzten Morgen nie beim wahren Namen kennen. Er würde seine Todeskleidung anziehen und das Haus verlassen. Die einzige Herausforderung, der er sich morgens beim Aufwachen gegenübersah, war, die Leere bis zum Abend zu überbrücken.
In der Schule leistete Luke nichts, was ihn ins Scheinwerferlicht gerückt hätte. Auf diese Weise würde er nicht groß bedauern, es zu verlieren.
Obwohl er ein guter Läufer war, wurde er beim staatlichen Tausendfünfhundert-Meter-Finale auf der Zielgeraden immer langsamer, weil er Seitenstechen bekam. Im nächsten Jahr hinkte er die letzten zwanzig Meter wegen einer Verletzung am Knöchel, der bis zu seiner Ankunft zu Hause wieder geheilt war. Bei jeder Gelegenheit, die ihm Glück oder Erfolg versprach, stand er lediglich da und ließ sie verstreichen.
Er mied Busspuren und Bahnsteige. Die Köpfe in den vorbeibrausenden Fenstern der auf schrillen Eisenrädern rollenden Schnellzüge betrachtete er nur aus der Ferne.
Es gab keine gefährlichen Orte – nur die Orte, an denen er zufällig gerade war. Ein Parkhaus, die Wendeltreppe in einem Einkaufszentrum. Nach ein paar Drinks auf einer Party springt er wort- und grußlos vom Balkon in die Tiefe. An einem sonnigen Morgen geht er spazieren und wirft sich vor einen vorbeifahrenden Wagen.
In einem beliebten Hotel in Midtown Manhattan nahm er den Aufzug und betrat einen offenen Cafébereich im zwanzigsten Stock, kaufte sich einen Kaffee und stellte sich an den Sims, vor dem ein niedriger Schutzzaun verlief. Er kämpfte dagegen an, springen zu wollen. Dann stieg er die im Zickzack verlaufende Treppe hinunter. Vor dem Gebäude sank er, schweißnass vor Erleichterung, auf den Gehsteig.
Immer, wenn er mit hohem Tempo Auto fuhr, sich hoch über dem Boden befand oder zu nah am Bordstein stand, lauerte der Todesdrang in seinem Blut, bereit zuzuschlagen.
Es brauchte keinen Sinn zu ergeben. Es musste einfach nur passieren.
In den letzten beiden Schuljahren hatte er im Sommer in der örtlichen Fabrik gearbeitet, einem braunen Gebäude mit hundertfünf Fenstern, die den Schatten gerahmter Kruzifixe auf den Steinboden warfen. Das war die Zuflucht, für die er sich nach dem Ende der Schulzeit entschied. In dieser anonymen Fabrik wollte er sein Leben an Mittagspausen und Wochenenden ausrichten. Er wollte seine Strafe in der Ruhe einer Routine verbüßen.
Und so kam es auch. Die Fabrik empfing ihn mit den offenen Armen ihrer Gleichförmigkeit.
Sein Tod verschmolz mit seinem Leben.
Doch an manchen heißen Sommertagen wünschte Luke sich ein langes Leben. Dann wollte er reisen, wollte neue Leute kennenlernen. Er war nicht unglücklich. Er war nicht deprimiert. Er hatte bloß genug von dem Schatten, den dieser Drang aus ihm machte, von den Türen, die er verschloss.
Er suchte die Bibliothek auf, durchstöberte die Buchhandlungen in der Gegend. Über Selbstmord gab es jede Menge Literatur, doch darin fand sich nichts Genaueres über den Tod. Er erhoffte sich Flinten, Revolver, Pillen, Stromschlag, Ersticken, Gas, Gift, Frostschutzmittel, Kohlenmonoxid, Verbluten im warmen Wasser einer Badewanne. Was er jedoch bekam, waren nur positives Denken, Philosophie, Reflexionen über das Glück, eine Beurteilung der neuesten Medikamente.
Nirgends fand er etwas, was seinen Zustand beschrieb. Vielleicht war jemand, der sich selbst nicht traute, ein zu schlichtes Thema für eine wissenschaftliche Abhandlung, oder es war nichts, was sich in Prozentzahlen ausdrücken ließ. Luke war kein Experte, aber eins wusste er: Wer diesem Angriff nicht standhalten konnte, war durch keinen Ratschlag der Welt zu retten.
Luke fragte an der Informationstheke, ob es Literatur über das plötzliche Auftauchen von Pforten oder Verlockungen gebe und wo die zu finden sei.
Der Buchhändler steckte sich seinen Bleistift hinters Ohr und stand vor dem Suchfeld des Computers: »Könnten Sie etwas konkreter sein? Was den Inhalt betrifft?«
Luke zuckte mit den Schultern: »Abends bin ich mal auf der Heimfahrt mit Vollgas in eine Mauer gerast.«
Die Finger des Mannes hielten über den Tasten inne.
»Ich stehe oben auf einem Leuchtturm«, fügte Luke hinzu. »Der Ausblick ist still und schön, und plötzlich merke ich, dass ich falle.«
Der Mann nahm seinen Bleistift und schrieb eine Nummer auf, die Luke anrufen könne.
Wenn er an einer Ampel stand, um die Straße zu überqueren, fuhr ihm oft der Windzug eines Kleinbusses unter den Mantel und ließ die schweren Einkaufstüten der anderen Wartenden schwingen.
Er blickte die Ewigkeit auf der anderen Seite an, süß und friedvoll.
Ein weiterer Bus näherte sich, dessen Motor dröhnend beschleunigte.
Er war nur einen Schritt davon entfernt, sich dem Marsch der Millionen Selbstmörder anzuschließen – so sah er die zahllosen Menschen, die sich vor ihm zum Freitod entschieden hatten. Sie marschierten schweigend in leuchtender Dunkelheit. Sie hatten ihre Angehörigen nicht vergessen – denn sie erinnerten sich nicht an sie. Sie hatten nirgends gelebt. Sie wussten nichts von einem toten Kind, einer zehrenden Krankheit, einer unerträglichen Schmach.
Sie waren die marschierenden Millionen.
Diese Schar erstreckte sich über Jahre, sie durchschritt Jahrhunderte.
7.
Eines Samstagmorgens probte Luke, sich aufzuhängen.
Er war siebzehn und wohnte in seinem letzten Schuljahr noch zu Hause. Seine Eltern waren unterwegs, um einen langen Spaziergang zu machen. Die Stimmung, die ihn überkam, war so vom Tod geprägt, dass er die Methode erproben wollte, die er den Büchern zufolge als junger Mann vermutlich benutzen würde. Luke hatte alles andere im Leben gelernt: wie man sprach, wie man ging, wie man aß.
Er sollte auch lernen, wie man starb.
Das Aufhängen konnte man nicht so leicht meiden wie Bahnhöfe: Im Haus gab es vieles, was er als Haken und Schlinge verwenden konnte. Einen Bahnhof musste man aufsuchen, und auf dem Weg dorthin konnte man es sich anders überlegen. Er wollte gemeinsam mit dem Unbekannten zum Kern eines Geheimnisses vordringen, zu dem Punkt, an dem das Leben noch nicht zu Ende, der Tod aber schon so nah war, dass man ihn umherschleichen hörte.
Zumindest würde er den schwer fassbaren Punkt erblicken, an dem es kein Zurück mehr gab.