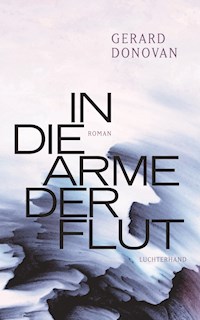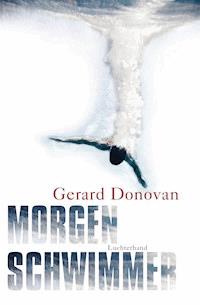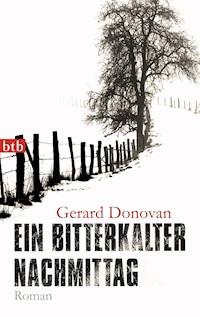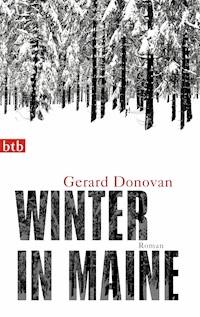
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann man sich für den Verlust der vollkommenen Liebe rächen?
Julius Winsome lebt zurückgezogen in einer Jagdhütte in den Wäldern von Maine. Der Winter steht vor der Tür, er ist allein, aber er hat die über dreitausend Bücher seines Vaters zur Gesellschaft und vor allem seinen Hund Hobbes, einen treuen und verspielten Pitbullterrier. Eines Nachmittags wird sein Hund aus nächster Nähe erschossen, offenbar mit Absicht. Der Verlust trifft Julius mit ungeahnter Wucht. Und er fasst einen erschreckenden Entschluss …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Julius Winsome lebt zurückgezogen in einer Jagdhütte in den Wäldern von Maine. Der Winter steht vor der Tür, er ist allein, aber er hat die über dreitausend Bücher seines Vaters zur Gesellschaft und vor allem seinen Hund Hobbes, einen treuen und verspielten Pitbullterrier. Eines Nachmittags, als er gerade vor dem Feuer sitzt und liest, hört er einen Schuss. Eigentlich nichts Besonderes, denn es ist gerade Jagdsaison. Als er vor die Tür geht, entdeckt er, dass Hobbes erschossen wurde – offenbar mit Absicht.
Der Verlust trifft Julius mit ungeahnter Wucht. Er denkt an all die anderen Verluste in seinem Leben: die Mutter, die er gar nicht kannte, weil sie bei seiner Geburt starb, den Vater, der nie wieder heiratete, der ihn allein großzog und ihm die Sprache Shakespeares beibrachte und jetzt auch schon zwanzig Jahre nicht mehr da ist, an Claire, die einzige Frau in seinem Leben, die ihn einen Sommer lang liebte und dann wieder verschwand. Und jetzt Hobbes, sein letzter wahrer Freund. Am nächsten Tag holt er das Gewehr seines Großvaters aus der Scheune und zieht los, um Rache zu üben. Er macht Jagd auf die Jäger ...
GERARD DONOVAN wurde 1959 in Wexford, Irland, geboren und lebt heute im Staat New York. Er studierte Philosophie und Germanistik sowie klassische Gitarre in Irland, veröffentlichte drei Gedichtbände, Shortstorys und drei Romane. »Ein bitterkalter Nachmittag« wurde mit dem Kerry Group Irish Fiction Award ausgezeichnet und stand auf der Longlist des Man Booker Prize 2003. »Winter in Maine« war »Buch des Jahres 2008« der englischen Tageszeitung »The Guardian«.
Inhaltsverzeichnis
Für Doug Swanson und Christina Nalty
Wer sehr lange lebt, verliert doch nur dasselbe wie jemand, der jung stirbt. Denn nur das Jetzt ist es, dessen man beraubt werden kann, weil man nur dieses besitzt.
Marc Aurel
ERSTER TEIL
30. Oktober – 2. November
1
Ich glaube, ich habe den Schuss gehört.
Es war ein kalter Nachmittag Ende Oktober, und ich saß in meiner Hütte auf dem Stuhl neben dem Holzofen und las. Durch diese Wälder streifen viele mit Gewehren bewaffnete Männer, meist in abgelegenen Gegenden, wo niemand wohnt, und besonders am ersten Tag der Jagdsaison, wenn die Leute aus Fort Kent oder noch kleineren Städten mit ihren langen Gewehren in Pick-ups heraufkommen, um Hirsche oder Bären zu jagen, durchsieben ihre Schüsse die Luft.
Doch der metallische Knall, der durch den Wald hallte, schien ganz aus der Nähe zu kommen, nicht mehr als einen Kilometer entfernt, falls das tatsächlich die Kugel war, die ihn tötete. Ehrlich gesagt, habe ich mir seither so oft vorgestellt, ihn zu hören, habe ich das Tonband dieses Augenblicks so oft zurückgespult, dass ich den realen Klang des Gewehrs nicht mehr vom eingebildeten unterscheiden kann.
Das war nah, sagte ich, legte ein weiteres Scheit aufs Feuer und schloss die Ofentür, bevor der Rauch hervorquellen und sich im Zimmer ausbreiten konnte.
Die meisten Jäger, auch die Anfänger, blieben im offenen Wald, weiter westlich in den North Maine Woods und bis zur kanadischen Grenze hinauf, aber ein gutes Gewehr ist weithin zu hören, und ohne Mauern und Straßen lässt sich die Entfernung nur schwer schätzen.
Dennoch kam es mir zu nah vor. Die erfahrenen Jäger wussten, wo ich wohnte, wo sich all die Hütten im Wald befanden, manche deutlich zu sehen, manche versteckt. Sie wussten, wo man keine Waffe abfeuern durfte und dass Kugeln so lange fliegen, bis sie irgendwo einschlagen.
Im Ofen brannte ein schönes Feuer, das meine Beine wärmte, und ich las die Kurzgeschichte von Tschechow zu Ende, in der ein Mädchen nicht schlafen kann und das Baby die ganze Zeit schreit, und weil ich mich völlig darin vertieft hatte, fiel mir gar nicht auf, dass mein Hund weg war. Vor ein paar Minuten hatte ich ihn hinausgelassen, und es war nicht ungewöhnlich, dass er sich von der Hütte entfernte, obwohl er meistens in einem Umkreis von hundert Metern blieb, seinem Territorium, seinem Besitz.
Ich ging zur Tür, rief nach ihm und dachte wieder, dass der Knall ein bisschen zu nah am Haus gewesen war, sah dann zehn Minuten später noch einmal nach, konnte meinen Hund aber nirgends entdecken, er kam nicht, als ich – jedes Mal lauter – nach ihm rief, und auch als ich zum Waldrand ging und pfiff, die Hände um den Mund legte und brüllte, war nichts von der braunen Gestalt zu sehen, die sonst immer aus dem Unterholz hervorbrach.
Der Wind war kalt, und ich schloss die Tür und schob das Handtuch davor, damit es nicht zog. Dann blickte ich auf die Uhr, was in den Wintermonaten nur selten vorkommt.
Es war vier Minuten nach drei.
2
In den Norden von Maine kommt der November mit einem kalten Wind aus Kanada, der ungebremst durch den gelichteten Wald fegt und Schnee über die Flussufer und die Hänge der Hügel breitet. Es ist einsam hier oben, nicht nur im Herbst und im Winter, sondern immer. Das Wetter ist trüb und rau, die Landschaft ist weit und rau, und dieser Nordwind weht unbarmherzig durch jeden Spalt und bläst einem manchmal die Silben aus den Sätzen.
Ich bin in diesen Wäldern aufgewachsen, dem Waldland am westlichen Rand des St. John Valley, das an die kanadische Provinz New Brunswick grenzt und sich mit seinen sanften Hügeln und den kleinen, abgelegenen Siedlungen an den Ufern und südlich des St. John River entlangzieht. Mein Großvater war Akadier, wie meine Mutter, und baute die Hütte aus mir unbekannten Gründen meilenweit entfernt von den anderen Franzosen, auf baumbestandenem Land in der Nähe des großen Waldgebiets im westlichen Teil des Tals. Damals lag die Hütte sogar noch abgeschiedener als heute, was seltsam war, denn eigentlich hielten diese Leute zusammen: Die meisten, die in den Siedlungen hier wohnten, stammten von Akadiern ab und waren 1755 von den Briten aus Nova Scotia vertrieben worden. Einige gingen in den Süden nach Louisiana, die Übrigen landeten im Norden von Maine – ein Volk der Extreme, wie mein Vater sagte, Bewohner des tiefsten Südens und des höchsten Nordens.
Auch wegen der Winter war es seltsam. Mein Großvater errichtete die Hütte auf zwei Morgen gerodetem Land, ringsum von Wald umgeben, und mein Vater baute eine große Scheune an, noch größer als die Hütte, wo er sein ganzes Werkzeug, den Pick-up und all das aufbewahrte, was zerbrechlich war oder leicht verlorenging und die sechs Wintermonate im Freien nicht überstehen würde. Der Wald setzte sich aus Nadel- und Laubbäumen zusammen – Kiefern, Eichen, Fichten, Tannen und Ahorn –, und wenn sich die Blätter im September gelb und rostrot färbten und wie vertrocknete Haut abfielen, wenn sie sich im Oktober bräunlich auf dem Waldboden kräuselten und in den November davongeweht wurden, war es, als würden die Bäume rings um die Hütte zurückweichen, sich schrittweise entfernen.
Die Hütte stammt vom französischen Familienzweig meiner Mutter, denn mein Vater war Engländer, doch von ihm erbte ich sie. Er sagte, es sei kaum zu glauben, dass dieses Tal der sanft gewellten Landschaft Mittelenglands gleiche, aber statt der englischen die französische Sprache in diesen Hügeln erschalle. Auch das war eine seltsame Entscheidung – eine Akadierin, die einen Engländer heiratete –, doch es heißt, meine Mutter ging stets ihren eigenen Weg, und Akadier lassen sich ohnehin keine Vorschriften machen.
Die Hütte verschmilzt mit dem Wald oder der Wald mit der Hütte. Man steigt im Wald über einen Zweig, und plötzlich steht man auf einer Veranda und muss ganz vorsichtig sein. In diesen Wäldern wohnen viele Männer, die sonst nirgends leben können. Sie leben allein und sind noch für die geringste Beleidigung empfänglich, darum sollte man sich lieber gut benehmen oder erst gar nichts sagen. Sie kommen in den Norden, um ihr Lebensende abzuwarten, oder sie waren ohnehin hier und bleiben aus demselben Grund. Solche Männer leben am Ende aller langen Wege, die es auf der Welt gibt, und wenn sie an einen Ort wie diesen gelangen, sind ihnen die Länder, in denen sie nicht leben können, ausgegangen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu bauen, und auch hier, im tiefen Schatten der Bäume, gehen sie den anderen so weit wie möglich aus dem Weg. Ich wohnte weit entfernt von meinen engsten Nachbarn, die nächsten Hütten lagen fünf Kilometer westlich und östlich von hier.
Im Sommer legte ich am Rand der Lichtung ein Blumenbeet an, ungefähr zehn mal einen Meter groß, mit Kapuzinerkresse, Ringelblumen, Lilien und Fingerhut, und jedes Jahr vergrößerte ich die kleine Rasenfläche, die sich im Sommer in einen warmen grünen Teppich verwandelte, auf dem ich liegen, den Duft der Blumen einatmen und den blauen Himmel genießen konnte. Diesmal war der Winter erst spät gekommen. Im Oktober hatte größtenteils ein seltsamer, ziemlich warmer Südwind geweht, und ein paar Blumen verströmten noch ihren Duft, obwohl ihre Zeit längst vorbei war. Ich hatte sie mit schwarzen, zu kleinen Zelten gebauschten Plastiktüten abgedeckt, damit sie den ersten Nachtfrost überstanden, in der Hoffnung, dass sie noch eine Woche die Farbe behielten und die bevorstehenden trüben Monate verkürzten. Im Sommer hatten sie Freude in mein Leben gebracht, und ich wollte ihnen helfen. Aber in den letzten Tagen war die Temperatur gesunken, und bald würden sich auch diese Überlebenden ins sichere Erdreich zurückziehen und im Klammergriff des tiefen Winters in ihren Samen schlafen.
Abgesehen von meinem Hund lebte ich allein, denn ich hatte, bis auf ein einziges Mal vielleicht, nie daran gedacht zu heiraten, und darum gehörte mir hier auch die Stille. Das Haus war rings um die Stille errichtet: Mein Vater war ein eifriger Leser gewesen, und vom Holzofen im Wohnzimmer bis hinter zur Küche und nach rechts und links in die beiden Schlafzimmer erstreckten sich an den Wänden lange, mit vier Brettern ausgestattete Bücherregale, in denen alle Bücher standen, die er je besessen oder gelesen hatte, was ein und dasselbe war, denn mein Vater hatte tatsächlich alles gelesen. So war ich von 3282 Büchern umgeben, in Leder gebundene Erstausgaben, Taschenbücher, alle in gutem Zustand, alphabetisch geordnet und mit Füller katalogisiert. Und da die Regale die gesamte Hütte säumten – und es in manchen Zimmern dunkler und kälter war, weil sie weiter vom Holzofen entfernt lagen –, gab es warme und kalte Romane. Viele der kalten Romane waren von Autoren verfasst worden, deren Nachname mit einem Buchstaben zwischen »J« und »M« begann, denn Schriftsteller wie Johnson und Joyce, Malory und Owen standen hinten bei den Schlafzimmern. Mein Vater hatte es die »Zweigstelle Alexandrias in Maine« genannt, nach der griechischen Bibliothek, und wenn er nach der Arbeit nach Hause gekommen war, hatte er am liebsten die Socken zum Feuer gestreckt, bis sie dampften, sich dann eine Pfeife angezündet, immer noch im dicken Pullover, sich zu mir umgedreht und um ein spezielles Buch gebeten, und ich konnte mich noch an die kalten Seiten in meinen Händen erinnern, wenn ich meinem Vater den Band brachte, den er haben wollte, und beobachtete, wie sich das Buch unter seinem Blick am Feuer erwärmte, und sobald er fertig war, hatte ich das warme Buch wieder ins Regal geschoben, wo es nicht mehr so gut hineinpasste, weil es in der Wärme ein bisschen größer geworden war.
Obwohl er schon zwanzig Jahre tot war, behielt ich die Romane und Reiseberichte, die Theaterstücke und Shortstorys bei mir, so wie er sie hinterlassen hatte, alles, was er war und wusste.
An jenem Montagnachmittag nahm ich eins dieser Bücher und las darin, russische Kurzgeschichten, und als ich mit der ersten fertig war, spähte ich aus dem Fenster. Noch immer kein Hund.
Wieder ein Blick auf die Uhr: zwanzig nach drei.
3
Ich trat auf die Lichtung hinaus und rief.
Hobbes!
Ich hoffte, er würde hinter mir angerannt kommen oder aus dem Pick-up springen, wo er tagsüber oft auf dem Sitz schlief, wenn die Sonne auf die Windschutzscheibe brannte und alles in ein Treibhaus verwandelte, aber auch nach drei weiteren Rufen tauchte er nicht auf. Um auf andere Gedanken zu kommen, nahm ich noch ein paar Scheite vom Holzstoß und stapelte sie neben der Tür. Mein Magen krampfte sich zusammen, und obwohl ich es ignorierte, mir noch ein Buch holte und mich damit ans Fenster setzte, wollte sich die Anspannung nicht lösen. Die Erstausgabe eines Essays von Alexander Pope, erschienen 1757 in London, einer von zehn Bänden in Originalledereinband, die Katalogkarte im Umschlag. Zwecklos. Ich konnte mich nicht darauf einlassen, und was mir sonst Freude bereitet hätte, war jetzt nur ein ödes Gewirr von Wörtern in meinem Kopf, jedes wie ein Stein: »Werke Alexander Popes Esq. In 10 Bdn. London: Gedruckt für A. Millar, Jan R. Tonson, H. Lintot und C. Bathurst, 1757. Mit Frontispiz und dreiundzwanzig Stichen, eigenem Titelblatt für jeden Band in Rot und Schwarz, in zeitgenössischem gemasertem Ledereinband, mit rotem Saffianetikett in vergoldeten Lettern.«
Schließlich schlug ich das Buch seufzend zu, da meine Anspannung mit jedem Augenblick wuchs.
Der Schuss war viel zu nah an der Hütte gefallen und auch lauter gewesen als ein Gewehr. Ich spielte alles noch mal durch und schätzte die Entfernung auf nicht einmal fünfhundert Meter.
Um zwanzig vor vier ging ich wieder zum Waldrand, legte die Hände um den Mund und rief den Namen meines Hundes. Das Echo klang wie ein übers Wasser hüpfender flacher Stein. Dann folgte ich einem Pfad in den Wald, hundert, zweihundert Meter, und rief wieder. Es würde bald dunkel werden. Um diese Zeit kamen die Hirsche hervor. Vielleicht hatte er einen entdeckt und war ihm nachgerannt, eine Verfolgungsjagd, die ihn drei, vier Kilometer weit wegführen konnte. Wenn ich mit Hobbes unterwegs war, hatte ich oft erlebt, wie er losstürzte und einem großen Hirsch hinterherjagte, den er unmöglich fangen konnte, und ich weiß auch gar nicht, was er getan hätte, wenn er ihn wirklich eingeholt hätte, jedenfalls war er immer vor mir zu Hause und wartete schon mit wedelndem Schwanz und ausgedörrter Kehle.
Am Beginn der Jagdsaison hatte ich ihm ein orangefarbenes Tuch um den Hals gebunden, damit die Jäger nicht auf ihn anlegten, doch es war irgendwann abgerissen, und ich hatte es nicht ersetzt, was ich jetzt auf dem Rückweg zum Haus bereute. Sinnlos, weiterzugehen und im Dunkeln herumzutappen.
Um fünf vor vier kam ich auf die Lichtung und sah ihn im Blumenbeet liegen, blutüberströmt, kaum noch atmend. Er hatte die Augen geöffnet und hob den Kopf, als er mich hörte. Ich lief zu ihm und sah die Wunde: eine Schrotflinte.
Er atmete noch, als ich ihn nach Fort Kent zum Tierarzt brachte, eine Strecke von fünfundzwanzig Kilometern, die ersten fünf Kilometer auf einer unbefestigten Straße mit überhängenden Bäumen. Ich wich den Schlaglöchern aus, hielt ihn fest und übte Druck auf die Wunde aus, sagte seinen Namen, damit er ein vertrautes Wort zu hören bekam, spürte die Feuchtigkeit an meiner Hand. Sobald ich die Asphaltstraße zur Stadt erreichte, gab ich Gas. Als ich beim Arzt klopfte, saß er im weißen Kittel in der Küche und aß zu Abend. Seine Frau öffnete die Tür und beschirmte die Augen unterm Verandalicht, während sie mich von Kopf bis Fuß musterte.
Mein Hund ist angeschossen worden, sagte ich.
Sie blickte zum Pick-up hinüber, der mit laufendem Motor und offener Tür in der Einfahrt stand, und sah Hobbes im Licht auf der Sitzbank liegen. Sie fasste sich an den Kragen, nickte und rief ihrem Mann zu: Ein Hund ist angeschossen worden.
Ich wusste zu schätzen, dass sie sich so kurzfasste. Sie war jemand, der wusste, wie kostbar Sekunden sein können. Der Arzt kam herausgestürzt, und wir trugen den Hund in seine Praxis direkt neben dem Haus, wo wir ihn auf eine Metallbank legten.
Er ist aus der Nähe angeschossen worden, sagte er.
Das hätte ich auch schon festgestellt, entgegnete ich.
Nein, aus allernächster Nähe, sagte der Tierarzt, aus einer Entfernung von ein paar Zentimetern. Die Schrotkugeln sitzen tief im Rücken.
Sie meinen, die Flinte hat ihn fast berührt, sagte ich.
Der Schütze kannte den Hund, vielleicht hat er ihn vorher getätschelt, damit er so dicht herankommt, erklärte er.
Dann forderte er mich auf, mit seiner Frau den Raum zu verlassen, denn er könne allein besser arbeiten. Ich bat, bleiben zu dürfen, damit der Hund einen vertrauten Menschen sah, doch der Arzt schüttelte den Kopf und bat mich noch einmal zu gehen.
Seine Frau führte mich in die Küche, goss mir eine Tasse Tee ein und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie war eine gute Frau, und ich mochte sie. Ich erinnerte mich, wie nett sie meinen Vater behandelt hatte, als er vor über zwanzig Jahren, kurz vor seinem eigenen Tod, mit einem anderen Hund den langen Weg hergekommen war. Ich sah, dass sie mich wiedererkannte.
Sie sind Julius Winsome, sagte sie.
Ich nickte.
Er muss einem Hirsch nachgerannt sein, weil er so weit vom Haus entfernt war, sagte ich.
So was kommt manchmal vor, erwiderte sie. Armer Kerl.
Oder er ist spazieren gegangen, die Nase in der Luft, mutmaßte ich.
Darauf sagte sie: Hunde gehen gern spazieren, genau wie Menschen.
Eine Glocke ertönte, und sie sagte, wir sollten wieder nach nebenan gehen. Als wir eintraten, sah ich nur blutrote Bandagen. Hobbes hatte Unmengen von Blut verloren.
Man muss ungeheuer grausam sein, um so auf einen Hund abzudrücken, sagte der Arzt und legte mir die Hand auf die Schulter, und da wusste ich, was er sagen wollte. Die beiden gingen, und ich hörte seine Frau fragen, was los sei und warum er den Hund nicht retten könne. Seine Antwort war nicht mehr zu hören, weil sie die Tür schlossen, und ich stand da mit meinem Hund, der unter der einzigen Lampe lag.
Der kleine Kerl sah mich an, und ich hielt seinen Kopf, dann legte er ihn auf meinen Arm und hörte auf zu atmen, als könnte er jetzt, wo ich da war, einfach loslassen.
4
Um ehrlich zu sein, die Fahrt zur Hütte zurück war unendlich lang. Hobbes lag neben mir, und ich zog seinen Kopf auf meinen Schoß, um es ihm auch im Endstadium bequem zu machen. Aus seinem Körper war fast alle Wärme gewichen, das Blut klebte in seinem Fell und auf dem Sitz. Noch am selben Abend, kurz nach meiner Rückkehr zur Hütte, begrub ich ihn im Scheinwerferlicht des Pick-ups im Blumenbeet, da, wo ich ihn gefunden hatte, an einer Stelle, die ich sehen konnte, wenn ich aus dem Fenster schaute. Es fiel mir schwer, die erste Schaufel Erde auf sein Gesicht zu werfen, ihn, der so oft hinter den von mir geworfenen Spielsachen hergelaufen war, der zitternd auf dem Fußboden gelegen hatte, während er im Traum lief und bellte, reglos in einem Loch liegen zu sehen. Immer wieder glitt die Schaufel aus dem Licht ins Dunkel und umgekehrt, und die Erde fiel auf seinen Bauch, den Rücken, in seine Ohren und Augen, während ich ihn zusammen mit allem, was ihn ausgemacht hatte, begrub: seinen Spaziergängen, seinen Verschnaufpausen, der Gewohnheit zu fressen, sobald er Hunger hatte, den Sternen, die er manchmal betrachtete, dem ersten Tag in meiner Hütte, dem ersten Mal, dass er Schnee sah, und jeder Sekunde seiner Freundschaft. All das nahm er mit in die Stille und Reglosigkeit. Ich schaufelte die ganze Welt auf meinen Freund und spürte ihr Gewicht, als läge ich bei ihm dort im Dunkeln.
Als ich fertig war, stellte ich die Schaufel in die Scheune, kehrte in die warme Hütte zurück und überließ ihn der Leichenstarre. In der Nacht regnete es, und als das Feuer heruntergebrannt war, wurde es kalt. Ich lag im Bett und hörte den Wind wie ein Seil ums Haus peitschen.
5
Als ich am Dienstagmorgen erwachte und die Sonne zum ersten Mal nicht mehr über einem lebenden Hobbes aufging, fiel ein Lichtsplitter durchs Fenster. Hobbes’ Grab war bloß fünf Meter von der Hütte entfernt, zu nah, um es übersehen zu können, selbst wenn man vorbeigehen wollte, und ich konnte mich nicht überwinden, nach draußen zu gehen und es zu sehen, also tappte ich durchs dunkle Haus, an den aufgereihten Büchern entlang, zog sie aus der Enge der Regale und wischte sie in dem zum Fenster hereindringenden Sonnenstrahl ab, bis die Luft voller Staub war, der im Morgenlicht wirbelte. Dann ging ich ins Gästezimmer, wo ich zwei Kästen unter dem Bett hervorzog, die beide die Aufschrift »Alexandria« trugen und sorgfältig mit braunem Gummiband umschlungene Karteikartenstapel bargen.
Mein Vater hatte tatsächlich 3282 Bücher im Haus aufgestellt, bei weitem zu viele, um sich alle merken zu können, darum hatte er für jedes einzelne eine Karteikarte angelegt, auf der er Autor, Verlag und Erscheinungsjahr sowie eine kurze Inhaltsangabe festhielt. Ich konnte mich noch an das Kratzen seines Füllers erinnern, wenn er auf seinem alten bequemen Gartenstuhl saß, der noch immer am Ofen steht, wenn er über seine Brille hinweg jeden Einband gewissenhaft musterte, alle Angaben notierte, den Kopf hin und her wandte und beim Schreiben vor sich hin murmelte. Der Füller kratzte durch Schnee und Frühling, durch Regen und Herbst. Ich blieb im Zimmer, über den Kasten gebeugt, während das Bild meines Vaters auf mich einströmte wie ein Sturzbach im Wald nach dem Regen: wie er kerzengerade in seinem grünen Wollpullover dasaß, seinem vom Rasierwasser verfärbten Kaschmirschal, der seinen Hals bedeckte, wenn es trotz des Feuers kalt wurde, und wie ich in seiner Nähe blieb und ebenfalls las, während sich die Stille wie eine Weinrebe durch die Hütte rankte, nur unterbrochen, wenn einer von uns beiden aufstand, um Tee oder Butterbrote zu machen. Er war ein freundlicher Mensch gewesen, mit dem man gut auskommen konnte, denn er nahm nicht viel Platz in Anspruch. Solche Menschen gibt es nicht oft, und von ihm lernte ich auch, wie man still ist. Wir lebten allein zusammen: Er hatte nicht wieder geheiratet. Er sagte, für ihn gebe es nur eine einzige Frau, auch wenn sie tot sei, und das zeigte mir, was Treue ist, wenn man das bloße Wort mit Leben erfüllt.
Als ich zwei Kannen Tee getrunken hatte und das Feuer bis zur Glut heruntergebrannt war, blickte ich zum dritten Mal in zwei Tagen auf die Uhr, so oft wie seit mindestens zwei Monaten nicht mehr. Es war erst Mittag. Ich musste Holz holen, sonst würde es um drei in der Hütte eiskalt sein. Es war die Zeit des Jahres, die ich die Holzzeit nannte, weil ich nur mit den Scheiten der zersägten abgestorbenen Bäume heizte; in der nächsten Woche musste ich den Öltank auffüllen lassen, um die Temperatur aufrechtzuerhalten. Wenn in dieser Gegend der Winter anbrach, konnte man einen ganzen Wald verbrennen, ohne gegen die Kälte anzukommen.
Das Grab zu meiner Linken, überquerte ich die Lichtung und schnappte mir ein paar Scheite. Alle strömten den intensiven Geruch des Monats aus, in dem sie in der lauen Sonne gestapelt worden waren, und von den Bäumen fielen Hunderte rostroter Blätter, strichen auf dem Weg nach unten die Rinde entlang, schwebten noch einmal in die Luft und landeten dann prasselnd wie Regentropfen. Mit vier Scheiten im Arm und auf den Boden geheftetem Blick kehrte ich direkt zur offengelassenen Tür zurück. Ich wollte nicht hinschauen, aber es passierte dennoch – irgendwie sah ich aus dem Augenwinkel die frische Erde mit dem Stein, den ich daraufgelegt hatte, um Raubtiere fernzuhalten, und mir wurde schwer ums Herz. Als ich wieder in der Hütte war und das Feuer schürte, spürte ich zum ersten Mal, dass er mir fehlte, und dieses Gefühl versetzte meinem Herz einen schrecklichen Schlag, denn auf einmal begriff ich die wahre Bedeutung des Wortes »tot«. Es bedeutet, dass niemand sieht, wie man lebt oder was man tut.
Und mit der Trauer kroch noch etwas anderes zur Tür herein, der Hauch von etwas anderem, meine ich. Es musste vom Holzstoß gekommen oder aus dem Wald hereingeweht sein, denn so ein Gefühl hatte ich noch nie gehabt.
6
Als ich noch ganz klein war, hat mir mein Vater von einem Mann namens William Shakespeare erzählt, der sich Tausende von Wörtern ausgedacht habe, und zum Beweis zog er die Theaterstücke dieses Mannes aus dem Regal – Julius Caesar, Cymbeline und König Richard II. –und zeigte mir das Kleingedruckte am Fuß der Seiten, wo diese Wörter und ihre Bedeutung standen. Im Rahmen meiner Erziehung ließ er mich mit seinem Füller Listen mit Shakespeares Wörtern erstellen, jeden Tag ein paar neue, und wenn sich diese Wörter mit dem Geruch der Tinte in meinem Kopf festsetzten und ich sie im Alltag benutzte, freute sich mein Vater im Stillen und lächelte breit hinter seinem Buch hervor, während am Ofen seine Socken trockneten. So vergrößerte ich meinen Wortschatz jede Woche um zirka zwanzig elisabethanische Wörter, die den langen Weg aus dem 16. Jahrhundert zurückgelegt hatten, um in meinem Mund und meiner Hand zu liegen, wenn ich sie zusammen mit den Erläuterungen buchstabierte. Mir fiel die Ausbeute eines bestimmten Tages ein: blutdurchsiebt hieß voller Blut, bestoben hieß voller Schmutz.
Ich lese mehr, als ich schreibe, doch wenn nötig, kann ich auch einen Satz zusammenfügen. So viele Jahre später, mit einundfünfzig Jahren, nahm ich nun also ein großes Blatt Papier, klebte es mit einem zweiten zusammen, breitete es im letzten Sonnenlicht der Hütte auf dem Fußboden aus und kniete mit einem schwarzen Leuchtstift davor nieder. Warum ich das tat, weiß ich nicht, und das, was ich damit erreichen wollte, blieb ein ferner, lästiger Fleck am Horizont. Doch ich setzte die ersten Zeilen auf, die ich – abgesehen von meiner Unterschrift oder einer Adresse – seit langem zu Papier gebracht hatte, schrieb in Großbuchstaben die Worte HUND ERSCHOSSEN, darunter in kleineren Buchstaben: »Am 30. Oktober zwischen den Wallagrass Lakes und dem McLean Mountain, Belohnung für jeden Hinweis«, und gab schließlich als Adresse mein Postfach an, wo ich einmal wöchentlich, im Winter manchmal auch nur alle zwei bis drei Wochen, meine Post abholte.
Stimmt schon, ich setzte diese Worte am Ofen auf, als Hobbes schon unter der Erde lag und durch Buchstaben nicht mehr zu retten war, und ich kann nicht erklären, warum ich das überhaupt tat, doch ich glaube, das, was an jenem Morgen hinter mir zur Tür hereingekrochen war, brachte mich dazu, oder vielleicht war es auch Shakespeare gewesen, der mich zu dem Plakat inspirierte. Eins von beiden.
Ich ließ den Pick-up warm laufen und brach mit der Bekanntmachung auf, erreichte bald die gut ausgebaute Straße am St. John River und fuhr von da nach Fort Kent, wo ich das Plakat vor dem Supermarkt aufhängte. Ich klebte es richtig fest, damit es dem Wind standhielt, und schlug mit einem flachen Stein, den ich in der Manteltasche aus dem Wald mitgebracht hatte, vorsichtshalber noch einen Nagel ein. Es war früher Nachmittag, und ich kaufte im Supermarkt Brot, Milch, Streichhölzer und Gemüse ein, setzte mich dann ins Café, weil ich Lust auf schwarzen Kaffee hatte und gern im Warmen, Hellen sitzen, mal etwas anderes zu Gesicht bekommen und andere Stimmen hören wollte, denn wegen Hobbes und allem lastete die Hütte zu schwer auf meinem Gemüt. Der dunkle, feuchte Wald war manchmal ein eigenständiges Wesen.
Ich legte meine Handschuhe auf den Tisch und beugte leicht den Kopf, als die Kellnerin mit ihrem Notizblock zu mir kam. Das kannte sie schon von mir, und sie lächelte.
Was darf ich Ihnen bringen?, fragte sie.