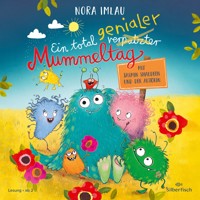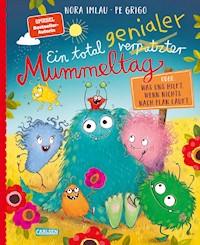10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
"Wie viel Eltern braucht ein Kind? Wie können wir Fürsorgepflicht und Freiheitsdrang vereinen? Und vor allem: Wie kann es uns gelingen, ein gutes, stabiles Bindungsnetz für unsere Kinder zu knüpfen?" Nora Imlau Es heißt, es brauche ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Doch in unserer modernen Welt ist es gar nicht so leicht, dieses Dorf zu finden. Schließlich leben wir längst nicht mehr in Großfamilienverbänden zusammen. Und wir wollen unsere Kinder auch nicht irgendwem anvertrauen. Im Gegenteil: Je sorgsamer wir unser Familienleben so gestalten, wie wir es für richtig halten. Desto schwerer fällt es uns, unsere Kinder auch anderen anzuvertrauen. Wie schaffen wir das also: unsere Kinder nicht in unserem Kleinfamilienkosmos festzuhalten, auch aber nicht zu riskieren, dass all unsere Bemühungen um Bindungssicherheit anderswo zunichte gemacht werden? Diesen brennenden Fragen und berechtigten Sorgen widmet Nora Imlau, selbst Mutter von vier Kindern, ihr neues Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
In guten Händen
Die Autorin
Nora Imlau, geboren 1983, ist Buchautorin, Journalistin und Referentin. Zu ihren erfolgreichsten Büchern gehören So viel Freude, so viel Wut, Schlaf gut, Baby, Mein kompetentes Baby und Mein Familienkompass. Journalistisch schreibt sie seit vielen Jahren u.a. für ELTERN und ELTERN family, ZEIT online, chrismon und wird regelmäßig von überregionalen Medien interviewt. Sie hält Vorträge sowohl auf Fachkongressen und Fortbildungen als auch bei Veranstaltungen im Bereich der Familienbildung. Aktiv auf Facebook, Twitter und Instagram. Mit ihrem Mann und ihren vier Kindern lebt sie in Süddeutschland.
Das Buch
Es heißt, es brauche ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Doch in unserer Welt ist es gar nicht so leicht, dieses Dorf zu finden. Schließlich leben wir längst nicht mehr in Großfamilienverbänden zusammen. Alle Eltern stellen sich diese Fragen: Wie können wir ein stabiles, gutes Beziehungsnetz für unsere Kinder knüpfen? Wie können wir Fürsorgepflicht und Freiheitsdrang vereinen? Wie können wir erkennen, ob unser Kind anderswo gut aufgehoben ist? Ob Kita, Schule, Nachmittagsbetreuung, Babysitter oder Großeltern – wir wollen unsere Kinder in gute Hände geben. Bestsellerautorin Nora Imlau zeigt, wie uns das gelingen kann.»AIs Nora Imlau mit 23 Jahren bei einem Eltern-Magazin anfing, wollte sie nichts weniger, als die deutsche Erziehungslandschaft zu verändern. Zehn Bücher später muss man sagen: Hat geklappt.«Süddeutsche Zeitung
Nora Imlau
In guten Händen
Kita, Schule, Großeltern - wie wir ein starkes Bindungsnetz für unsere Kinder knüpfen können
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
ISBN 978-3-8437-2820-1© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAutorinnenfoto und Umschlagfoto: © Nessi GassmannUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenE-Book powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Einleitung Wir müssen das nicht alleine schaffen!
Erstes Kapitel Ein Dorf für uns und unser Kind
Wir alleine reichen nicht aus
Anfangen, wo wir stehen
Nur die Mama? Steinzeitmythen loslassen – Bindung zulassen
Betreuungsvielfalt in anderen Kulturen
Das »Früher war alles besser«-Märchen
Mit einem stützenden Netzwerk durch die Babyzeit
Zweites Kapitel Auf die Bindung kommt es an
Vom Schreihals zum Bindungswesen: Wie sich unser Bild vom Kind gewandelt hat
Neun Merkmale von Bindung
Baby, Kleinkind, Teenager: Bindungsbedürfnisse verändern sich
Verschiedene Menschen brauchen verschiedene Dinge
Familie ist ein System
Wie verbessern wir unsere eigenen Bindungsqualitäten?
Drittes Kapitel Familie und Freundeskreis
Der engste Kreis: Bindungen in der Kernfamilie
Unser Familienbild auf dem Prüfstand
Großeltern: Gesetzt und nicht ersetzbar
Onkel, Tanten und andere Verwandte
Freundschaften als Wegbegleitung für uns und unsere Kinder
Achtung, Energievampire?
Viertes Kapitel Was prägt uns in der Betreuungsfrage? Eine Spurensuche
Woher kommen unsere Überzeugungen?
Die Schere zwischen Ost- und Westdeutschland
Krippenerfahrungen in der DDR
»Die ersten Jahre gehört das Kind zur Mutter« – Glaubenssätze in der alten Bundesrepublik
Was heißt hier »Fremdbetreuung«?
Im Land der Bewertungen
Fünftes Kapitel Unseren Weg als Familie finden
Die Sache mit der freien Wahl in der Kleinkindbetreuung
Was für ein Leben soll’s denn sein?
Was für ein Mensch ist unser Kind – und was für ein Mensch bin ich?
Betreuung, die nach Hause kommt: Babysitter*innen, Nannys und Au-pairs
Ohne Kita durch die Kleinkindzeit
Wenn Pläne nicht aufgehen
(Fast) jede Lösung kann eine gute sein
Sechstes Kapitel Ein guter Ort für unser Kind
Zwischen Qualitätskriterien für Kitas und Bauchgefühl
Ist frühkindliche Betreuung schädlich?
Ambiguitätstoleranz – auch in der Betreuungsfrage
Kita oder Tagespflege?
Wie finden wir eine gute Tagespflege?
Frühe Bildung oder frühe Bindung? Worauf es bei frühkindlicher Betreuung wirklich ankommt
Besondere pädagogische Konzepte: Montessori- und Waldorfeinrichtungen
Siebtes Kapitel Es geht los!
Wie können wir uns vorbereiten?
Stillen
Schlafen und essen
Eine gute Eingewöhnung
Tränen lügen nicht oder: Abschiedsschmerz gehört dazu
Was fürs Ankommen hilfreich ist
Unser neuer Kitaalltag
Wir haben jetzt ein Kindergartenkind!
Achtes Kapitel Neue Beziehungen: Schule und Kinderfreundschaften
Welche Schule für unser Kind?
Zehn Impulse für eine gute Schulentscheidung
Jede Bezugsperson ein Mensch
Zwischen Gefahrenbewusstsein und Gottvertrauen
Freundschaften unter Kindern verstehen
Die Werte der anderen
Zum Schluss Ein Netz, das uns trägt
Verwendete Literatur
Leseempfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Einleitung Wir müssen das nicht alleine schaffen!
Widmung
Das Gegengift zu Einsamkeit ist nicht das wahllose Zusammensein mit irgendwelchen Leuten. Das Gegengift zu Einsamkeit ist Geborgenheit.
Benedict Wells
Für meine Eltern Hans und Sabine Imlau, die für mich ein sicheres Bindungsnetz knüpften und mir dann die Fäden selbst in die Hand gaben.
Einleitung Wir müssen das nicht alleine schaffen!
Eine meiner prägendsten Erinnerungen ans Mutterwerden ist dieser Moment, als mein Mann und ich nach der Geburt unseres ältesten Kindes mit dem Baby zum ersten Mal ganz allein zu Hause waren. Da lag dieses winzige Neugeborene zwischen uns und schlief, und mir wurde plötzlich klar, dass wir ab jetzt auf uns allein gestellt sein würden. Keine Hebamme, keine Frauenärztin, keine Säuglingsschwester würde dafür Verantwortung tragen, dass dieses Kind gesund und sicher groß werden würde. Das war nun unser Job. Unserer ganz allein. Im Nachhinein muss ich ein wenig schmunzeln über das Pathos, das in dieser Erkenntnis gefühlt mitschwang: wir zwei. Allein. Verantwortlich. Für immer.
Dass ich damals das Gefühl hatte, von nun an müssten wir es ohne Hilfe schaffen, ist kein Zufall, sondern eine Botschaft, die in unserer Gesellschaft tief verankert ist: Kinder sind keine Gemeinschaftsaufgabe, sondern Privatvergnügen. Wer nicht eigenständig für sie sorgen kann, soll halt keine kriegen. Und wer welche hat, übernimmt gefälligst auch die Verantwortung für sie, ohne dabei dem Rest der Welt zur Last zu fallen.
Wohin dieses Verständnis von Elternschaft als eine Art zeitintensives Hobby im Extremfall führt, zeigte sich während der Corona-Pandemie wie unter einem Brennglas: Während Schulen und Kitas geschlossen blieben und Großeltern sowie andere familiäre Bezugspersonen als Unterstützung ausfielen, wurde von Eltern ganz selbstverständlich erwartet, die gleiche Arbeitsleistung wie sonst auch zu erbringen – nur eben im Homeoffice und im Zweifelsfall mit Kleinkind auf dem Schoß. Besonders prägnant brachte die Autorin Nicole Huber diese Haltung des gesamtgesellschaftlichen Sich-nicht-zuständig-Fühlens auf den Punkt. Sie forderte in ihrem 2011 erschienenen Buch Kinderfrei das Ende der staatlichen Familienförderung mit dem Argument, es sei ungerecht, dass fleißige Kinderlose von ihren Sozialabgaben die klimafeindliche Kinderkriegerei anderer Leute unterstützen sollen. Ein Jahr später postulierte die Wirtschaftsjournalistin Heike Göbel: »In hohem Maße zahlen Kinderlose für fremder Leute Kinder. Und zwar ohne Gewähr, ob diese Kinder später zu guten Beitrags- und Steuerzahlern werden – oder in die Fürsorge fallen.«1 Die solidarische Unterstützung von Familien: ein wenig lukratives Investitionsmodell.
Und wir Eltern? Wir nehmen diesen unausgesprochenen Auftrag, bitte niemanden mit unserem Nachwuchs zu stressen, mehr oder weniger selbstverständlich an. Schließlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft, in der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit einen hohen Stellenwert haben. Wer will sich da schon schwach fühlen, angewiesen auf die Hilfe anderer? Dann lieber alles alleine wuppen, wie viel Kraft es auch kosten mag.
Da gibt es nur ein Problem: Wir mögen in unserer modernen Gesellschaft Kinder vielleicht nicht als Gemeinschaftsaufgabe ansehen. Das ändert aber nichts daran, dass Kinder Gemeinschaft brauchen. Eltern auch. Und das gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen brauchen Familien die Unterstützung der Solidargemeinschaft, also etwa familienfreundliche Gesetze, die sie vor Diskriminierung schützen, sowie gemeinschaftlich
gestemmte Investitionen in eine Infrastruktur, vor allem in Form qualitativ hochwertiger Betreuungs- und Bildungsstätten. Doch Eltern und Kinder brauchen Gemeinschaft nicht nur im großen, gesellschaftlichen Sinne, sondern auch im Kleinen: in ihrem ganz konkreten Alltag. »Alleine geht es nicht, zu zweit geht es auch nicht besonders gut. Wir müssen Familie größer denken«, fasste die österreichische Politikwissenschaftlerin und Autorin Mariam Irene Tazi-Preve diese Erkenntnis 2017 im Interview zusammen.2 Was sie damit meint: Natürlich gibt es Alleinerziehende, die gefühlt alles irgendwie ohne große Hilfe hinkriegen. Und Eltern, die niemanden haben, der ihnen im Familienleben unter die Arme greift, die ihr Kind trotzdem gut großkriegen. Nur: Die gesamte Verantwortung auf die Schultern von nur einer Person zu packen, ist eine unfassbare Zumutung, und auch für zwei Menschen allein wiegt die Last im Grunde noch zu schwer. Ein Kind ins Leben zu begleiten bedeutet nicht nur, Liebe, Fürsorge und Verbundenheit zu geben. Es ist auch unbeschreiblich harte Arbeit, sowohl körperlich als auch emotional. Allein die ganz praktische Care-Arbeit vom Wecken übers Anziehen, Wickeln, zu essen Geben, Einkaufen, Kochen, Putzen, Aufräumen, Wäschewaschen bis hin zum Fahren und Begleiten zu Terminen, Therapien und Hobbys hat in vielen Familien bereits den Stundenumfang eines Vollzeitjobs. Dazu kommt der Mental Load, den so ein Familienleben mit sich bringt. Das sind all die Dinge, die wir im Kopf behalten und über die wir uns Gedanken machen müssen, von Geburtstagsgeschenken, die besorgt, bis zu Anrufen, die getätigt werden müssen, von Vokabeln, die abgefragt, bis hin zu wettergerechten Jacken und Schuhen, die rechtzeitig gekauft sein wollen. Diese unsichtbare Arbeit – die in vielen Familien nahezu unbemerkt von der Mutter erledigt wird – bedeutet eine immense Kraftanstrengung. Da ist dann immer noch nicht die emotionale Arbeit eingerechnet, die es bedeutet, ein weinendes Baby auch dann liebevoll zu halten, wenn es sich davon nicht trösten lässt, ein zweijähriges Kind mehrmals pro Tag geduldig durch Wut- und Frustanfälle zu begleiten, einen Vierjährigen mit Albträumen nachts im großen Bett willkommen zu heißen, ein Schulkind mit schlechtem Zeugnis wieder aufzubauen und den ersten Liebeskummer eines Teenagers mit auszuhalten. Wenn in der Familie auch Kinder mit Behinderungen oder Krankheiten leben, ist die Belastung zeitlich und emotional oft besonders groß.
Wie unglaublich herausfordernd all das ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. Als Mutter von vier Kindern zwischen zwei und fünfzehn Jahren bin ich an jedem einzelnen Tag damit beschäftigt, Essen zu kochen, Tränen zu trocknen, Nasen zu putzen, Windeln zu wechseln, Kinder zur Logopädie, Ergotherapie und Nachhilfe zu fahren, Brotdosen zu befüllen, Müll rauszubringen, Spül- und Waschmaschine ein- und auszuräumen, mir die neusten TikTok-Trends erklären zu lassen und jeden Abend mindestens eine Stunde an den verschiedenen Bettkanten zu sitzen, bis all meine Kinder gut einschlafen können. Mein Mann kann von sich dasselbe sagen. Wir sind zum Glück ein wirklich gutes Elternteam und kümmern uns beide mit Leib und Seele um unsere Rasselbande. Trotzdem ist mir gerade in den letzten Jahren immer stärker klar geworden, wie aufgeschmissen wir wären, läge die Verantwortung für unsere Kinder tatsächlich ganz allein auf unseren Schultern, wie ich das als junge Mutter dachte. Wenn ich mir anschaue, was mich und uns in den vergangenen Jahren durch all die Anstrengungen, Herausforderungen und sicher auch manchmal Überforderungen des Elternseins getragen hat, dann war es genau das: eben nicht allein zu sein mit allem, sondern Verantwortung abgeben und teilen zu können. Mit Menschen, denen wir vertrauen und denen unsere Kinder vertrauen. »Vater, Mutter, Kinder – das sind viel zu wenige Personen, um sich gegenseitig sämtliche Bedürfnisse erfüllen zu können«, meint Mariam Irene Tazi-Preve, und ich glaube, damit hat sie sehr recht.
Trotzdem handeln nahezu alle Bücher über Eltern- und Familienthemen von genau dieser Beziehung: der zwischen Eltern und Kindern, und davon, wie besonders und kostbar und einzigartig sie ist. Meine eigene Arbeit nehme ich davon explizit nicht aus. Seit 2006 schreibe ich als Fachjournalistin für Familien über Bindungs- und Beziehungsthemen, und bestimmt 95 Prozent meiner Artikel handelten dabei von Eltern und ihren Kindern. Auch in meinen bisherigen Büchern nimmt die Eltern-Kind-Beziehung mit all ihren Herausforderungen und Facetten den größten Raum ein. Das ist ja auch verständlich: Wenn wir Eltern werden, wollen und müssen wir erst einmal verstehen, was wir selbst tun und wie wir mit unseren Kindern umgehen wollen, um ihnen und uns ein gutes gemeinsames Leben zu ermöglichen.
Doch ich bin überzeugt: So wichtig es ist, uns über die Werte klar zu werden, die das Miteinander zwischen uns Eltern und unseren Kindern bestimmen und prägen sollen, so entscheidend ist es auch, dass wir über den Blick ins Innere unserer Familie nicht die Außenwelt aus dem Blick verlieren: all die Menschen, die zu unserem Umfeld gehören und ebenfalls eine wichtige Rolle im Leben unserer Kinder spielen können, und damit auch in unserem. Wir sollten nicht vergessen, dass auch die liebevollsten Eltern der Welt nur ein Mosaikstein einer bindungs- und beziehungsreichen Kindheit sind. Ein besonders zentraler, wichtiger und schöner sicherlich. Aber nicht das ganze Bild.
Unsere Kinder tragen die tiefe Sehnsucht in sich, in die Welt hinauszugehen und sie sich selbst zu erobern. Dazu gehört, dass sie Beziehungen außerhalb des engsten Familienkreises knüpfen und eigenständig gestalten. Das heißt nicht, dass wir sie gegen ihren Willen aus dem Nest hinausschubsen müssten oder dass jede Erfahrung mit anderen Menschen für sie gut oder wertvoll wäre. Im Gegenteil: Unsere Kinder brauchen uns als sicheren Hafen, in dem sie Geborgenheit und Schutz erleben können, bis sie für neue Erfahrungen und Abenteuer bereit sind. Natürlich gehört es zu unseren Aufgaben, über ihre ersten Schritte aus unserem geschützten Kreis hinaus zu wachen und achtzugeben, dass sie auch außerhalb unserer Kernfamilie an Menschen geraten, die ihnen wohlgesinnt sind. Damit das gelingt, bauen wir in den ersten Lebensjahren unserer Kinder eine enge Bindung zu ihnen auf – die Grundlage dafür, dass unsere Kinder selbst die Fähigkeit entwickeln können, tragfähige Beziehungen zu gestalten und sich in der Welt zurechtzufinden.
Doch zwischen Muttermythos und Kleinfamilienidyll vergessen wir hierzulande schnell, dass Bindung nicht nur Eltern und Kinder betrifft. Im Gegenteil: Wir sind es so gewohnt, beim Thema Bindungssicherheit einzig und ausschließlich an Kernfamilien zu denken, dass wir jedes Kümmern einer anderen Person schnell als zweitklassig, wenn nicht sogar schädlich empfinden. Dabei können bewusst gesuchte, gestaltete und gepflegte Bindungsbeziehungen außerhalb des engsten Familienkreises für alle Beteiligten so wertvoll sein! Denn nicht nur für unsere Kinder ist es wunderbar und bereichernd, wenn es neben uns Eltern noch weitere Menschen gibt, die sie kennen und lieben. Auch für uns gibt es keine größere Entlastung, als diesen Menschen unsere Kinder anvertrauen zu können, und keine bessere Voraussetzung, uns selbst eingebunden zu fühlen. Deshalb will ich Familien dazu aufrufen und ermutigen, sich ein solches tragfähiges Bindungsnetz zu schaffen: ein auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse angepasstes Dorf, das dabei hilft, unsere Kinder in die Welt zu begleiten.
Ein solches Bindungsdorf zu bauen stellt Eltern vor viele Entscheidungen. Unser Kind das erste Mal für länger als zwei oder drei Stunden einem anderen Menschen zu überlassen ist für die meisten ein riesiger Schritt. Das gilt oft auch schon für eine Übernachtung bei den Großeltern. Besonders groß fühlt dieser Schritt sich an, wenn die Betreuungsperson, die wir für unser Kind gewählt haben, uns selbst nicht schon lange vertraut ist; sondern eine bezahlte Kraft, die wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt haben, aber ja trotzdem kaum kennen. Wie, fragen wir uns da natürlich, soll diese Person unserem Kind auch nur annähernd so gerecht werden können wie wir? Da ist ja auch was dran: Niemand kennt unser Kind so gut wie wir. Niemand liebt es so wie wir. Niemand ist ihm so nah, so vertraut mit ihm und so verbunden. Natürlich sind wir Eltern für unser Kind unersetzlich. Die Frage ist nur, ob das im Umkehrschluss bedeutet, dass niemand anderes für unser Kind auch gut sein kann? Manche Familien tun sich mit dieser Frage sehr schwer. Für andere ist es die größte Selbstverständlichkeit der Welt, dass ihr Kind mit einem Jahr in die Kita gehen wird.
Um weitere Menschen in unser sorgsam geknüpftes Bindungsnetz zu integrieren, bedarf es häufig einer ehrlichen Begegnung mit uns selbst. Die Entscheidung, wem wir unser Kostbarstes, unser Kind, wann und wie lange anvertrauen, berührt uns im Kern: Niemand hat in der Frage, ob Betreuung insbesondere für kleine Kinder außerhalb der Kernfamilie okay, ganz wichtig oder doch eher eine Notlösung ist, nicht zumindest ein diffuses Bauchgefühl. Dieses Bauchgefühl speist sich aus unserer eigenen Biografie, unseren Bindungs- und Beziehungserfahrungen in der frühen Kindheit, später erworbenem Wissen über kindliche Entwicklung und Bedürfnisse sowie aus unseren Werten, Überzeugungen und Glaubenssätzen, die häufig emotional stark aufgeladen sind. Unsere Haltung dazu ist aber oft viel weniger individuell, als wir meinen. Wir glauben zwar gerne, dass wir unsere Entscheidungen ganz persönlich und frei von gesellschaftlichen Einflüssen und Zuschreibungen treffen. Doch letztlich sind unsere spontan-emotionalen Antworten auf die Frage, ob ein Kind mit einem Jahr in die Krippe gehen sollte oder mit drei in den Kindergarten, ob kleine Kinder am besten zu Hause bei Mama bleiben oder andere Kinder brauchen, immer stark beeinflusst von kulturellen Botschaften, die wir so verinnerlicht haben, dass wir sie kaum noch hinterfragen. Ob wir in der DDR mit ihrem etablierten Krippensystem aufgewachsen sind oder in der Bundesrepublik, wo Kinder selbstverständlich lange bis zum Kindergartenalter zu Hause waren – oder ganz woanders, wo es wiederum eine eigene Betreuungskultur gibt und gab –, spielt dabei auch eine Rolle.
Genau diesen Prägungen – den individuellen wie den gesamtgesellschaftlichen – gehen wir in diesem Buch gemeinsam auf die Spur. Wir schaffen nicht nur ein größeres Bewusstsein für unsere eigenen biografischen Erfahrungen, sondern ergänzen unser diffuses Bauchgefühl außerdem um handfeste Fakten aus der Bindungsforschung, die uns helfen können herauszufinden, wie für unsere Familie ein wirklich passender Weg in der Betreuungsfrage aussehen kann. Dabei finde ich es sehr wichtig, dass wir innere Widerstände ernst nehmen und uns nicht dazu drängen lassen, das eigene Kind jemand anderem anzuvertrauen, bevor es sich stimmig und richtig anfühlt. Keine Studie und kein Forschungsergebnis der Welt kann sagen, was für eine individuelle Familie der richtige Weg ist, Bindungen und Beziehungen zu gestalten. Und: Ein Dorf zu bauen heißt nicht, das eigene Kind dort auch von anderen Menschen betreuen lassen zu müssen, erst recht nicht, wenn es noch ganz klein ist. Ein unterstützendes Dorf kann sich auch mit uns zusammen um unsere Kinder kümmern oder uns den Rücken freihalten, damit wir ganz für unsere Kinder da sein können. Das Bindungsnetz, von dem ich spreche, ist also kein Synonym für eine praktische Betreuungslösung, sondern meint viel mehr: nämlich ein stärkendes, stützendes Umfeld, in dem unsere Kinder und wir selbst sichere Bindungs- und Beziehungserfahrungen machen können. Nur auf dieser Grundlage können wir unsere Kinder irgendwann vertrauensvoll in gute Hände geben. Dann, wenn sie dafür bereit sind. Und wir selbst auch.
Als Autorin verspreche ich Ihnen, von keiner heimlichen Agenda angetrieben zu sein. Ich will weder alle Familien in Richtung Krippe drängen noch pauschal vor familienergänzender Betreuung warnen. Ich quatsche Ihnen keinen Mehrgenerationenhaushalt auf, den Sie gar nicht wollen oder den Ihre Familie schlicht nicht hergibt, und mache Ihnen kein schlechtes Gewissen, wenn Ihr Kind mit vier noch nicht in den Kindergarten geht. Ich stelle einfach nur die vielfältigen Möglichkeiten dar, wie ein tragfähiges Bindungsnetz für Familien entstehen, wachsen und sich wandeln kann – und was davon für Sie und Ihre Familie passt, entscheiden Sie bitte unbedingt selbst! Mit meinen eigenen vier Kindern habe ich übrigens ganz unterschiedliche Betreuungsmodelle gewählt: Eins kam bereits kurz vor dem ersten Geburtstag zur Tagesmutter, ein anderes war zwei Jahre lang mit mir zu Hause und ging dann in die Kita. Eins kam mit drei in den Kindergarten und mit dreieinhalb wieder raus, weil es noch mehr Zeit brauchte. Eins wurde mit vier eingeschult, weil wir damals in England lebten. Eins startete mit sieben zum zweiten Mal in die erste Klasse. Wir haben mit unseren Kindern Erfahrungen in der Tagespflege und in der Montessori-Kita gesammelt, in großen Einrichtungen mit mehreren Hundert Kindern und in einem kleinen, beschaulichen Dorfkindergarten. Wir haben als Familie zeitweise viele Tausend Kilometer von allen Großeltern und anderen Verwandten entfernt gelebt und zu anderen Zeitpunkten nah beieinander. Durch unsere vielen Umzüge haben wir immer wieder neu anfangen müssen, Beziehungen und tragfähige Bindungen für uns und unsere Kinder aufzubauen. Gerade dadurch haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass echte Nähe manchmal keine Frage von Kilometern ist.
Was ich mit diesem kurzen Einblick in mein eigenes Familienleben sagen will: Nichts hat meinen Horizont in Bezug auf Bindungs- und Betreuungserfahrungen in der frühen Kindheit so geweitet wie zu erleben, dass je nach Kind, Ort und Lebenssituation etwas ganz anderes richtig, gut und dran sein kann. Deshalb muss ich mich auch nicht verbiegen, um Ihnen zu versprechen, dass ich mitnichten glaube, den einen richtigen Weg in der Betreuungsfrage für Sie und Ihre Familie zu kennen. Ob Sie Ihr Kind nach der Lektüre dieses Buches also in der Krippe oder bei einem Tagesvater anmelden, die Großeltern stärker einspannen oder Wunschgroßeltern suchen, Ihren Job an den Nagel hängen, einen beruflichen Neuanfang starten oder ein Betreuungsnetzwerk im Freundeskreis gründen – es wird bestimmt eine gute Entscheidung sein! Nicht, weil es egal wäre, wie wir unsere Kinder begleiten, oder weil man in der Betreuungsfrage nichts falsch machen könnte; sondern weil ein tragfähiges Bindungsnetz, das wir bewusst und angepasst an unsere individuellen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse schaffen, immer eine gute Sache ist. Dieses Netz kann aus Verwandten oder Wahlverwandten, bezahlten oder unbezahlten Vertrauenspersonen, vielen oder wenigen Menschen bestehen. Entscheidend ist allein, dass es uns als Familie die Fürsorge und Entlastung schenkt, die wir brauchen, um gemeinsam gut zu leben.
Natürlich können wir uns kein ideales Betreuungsnetzwerk backen. Kompromisse gehören im Leben dazu, erst recht, wenn unsere Ressourcen begrenzt sind. Doch wenn wir wissen, worauf wir im Sinne unseres Kindes achten wollen, dann wissen wir auch: Selbst wenn wir uns gerade nicht selbst um unser Kind kümmern, ist es trotzdem – in guten Händen.
Erstes Kapitel Ein Dorf für uns und unser Kind
Dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, ist eine dieser Postkartenweisheiten, die Eltern überall begegnen und sie nicht selten ratlos und manchmal verunsichert zurücklassen. Denn das sprichwörtliche Dorf, das uns hier und heute dabei helfen soll, unsere Kinder gut großzukriegen, ist eben kein Dorf im eigentlichen Wortsinn, kein Ort, der einfach existiert und an dem eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Menschen nur darauf warten, uns Eltern zu entlasten und unser Kind mit ins Leben zu begleiten. Hinzu kommt: Jeder, der schon einmal in einem echten Dorf gelebt hat, weiß, wie einsam es für Familien auch dort sein kann. Jeder kümmert sich um sich selbst und die eigenen Nächsten, andere Hilfe gibt es allenfalls gegen Bezahlung – diese moderne Lebenswirklichkeit ist in Kleinstädten, Metropolen und eben auch dörflichen Gemeinschaften längst gleich. Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben Familien heute also kein Dorf um sich herum, das ganz selbstverständlich da ist und sie im Alltag unterstützt. Und wenn es ein solches gewachsenes Netzwerk aus Verwandten, Freunden und Menschen aus der Nachbarschaft gibt, die uns alle unter die Arme greifen wollen, heißt das noch lange nicht, dass Eltern davon zwingend entlastet werden. Denn zu unserer Realität gehört auch, dass es keinen weitreichenden
gesellschaftlichen Konsens mehr darüber gibt, wie man mit Kindern umgehen sollte. Das fängt schon bei den unterschiedlichen Vorstellungen und Prägungen unserer eigenen Elterngeneration an, geht aber noch weiter: Wir Eltern stehen heute vor der Aufgabe, uns aus einer Vielzahl an Theorien, Konzepten und Ideen das Familienleben zu bauen, das uns am sinnvollsten und stimmigsten erscheint. Mit meinem Familienkompass habe ich eine Orientierungshilfe im Dschungel dieser Möglichkeiten vorgelegt und aufgezeigt, wie Familien ihren eigenen Weg finden können, der ihnen und ihren Werten entspricht. Im Folgenden will ich einen Schritt weitergehen und über die Kleinfamilie hinausdenken: Wie kann es uns gelingen, für uns und unsere Kinder ein gutes und tragfähiges Beziehungsnetz zu gestalten?
Wir alleine reichen nicht aus
Die überwältigende Mehrzahl der Literatur zu Familienthemen stellt Eltern und ihre Kinder, also die Kleinfamilie, in den Mittelpunkt – was sehr schön aufzeigt, wie wenig der Spruch vom Dorf, das mit uns unsere Kinder großzieht, unserer gelebten Realität entspricht. Bei meinen Vorträgen erfahre ich das immer wieder sehr deutlich: Da erzählen mir Eltern davon, wie sie sich tagtäglich zerreißen, um allen gerecht zu werden, und dabei trotzdem immer wieder schmerzlich an ihren eigenen Ansprüchen scheitern. Sie gehen dabei wie selbstverständlich davon aus, dass alles, was sie stresst, allein ihre Aufgabe sei: Geld verdienen, den Haushalt schaffen, für warme Mahlzeiten sorgen und natürlich die eigenen Kinder liebevoll begleiten. Kinder großkriegen als echte Gemeinschaftsaufgabe? Dieser Gedanke ist uns modernen Eltern nicht nur fremd, sondern auch unheimlich. Schließlich würde das bedeuten, ein ganzes Stück der eigenen Verantwortung und letztlich auch Kontrolle aus der Hand zu geben. Und zwar an Menschen, die vielleicht ganz anders ticken als wir. Genau an diesem Punkt regt sich bei vielen Eltern heftiger Widerstand, was durchaus nachvollziehbar ist. Wer sich gut überlegt hat, warum das eigene Kind wie aufwachsen soll, will natürlich nicht, dass andere all diese Bemühungen wieder zunichtemachen. Da machen wir lieber alles selbst, und zwar so, wie wir es gut finden.
Bleibt nur ein Problem: Dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, ist mehr als eine Postkartenweisheit. Wenn wir das Dorf als Bild für eine unterstützende Gemeinschaft im eigenen Lebensumfeld verstehen, fasst dieses Bild im Kern eine der wichtigsten Erkenntnisse aus Entwicklungspsychologie, Soziologie und Resilienzforschung zusammen: Ja, unsere Kinder brauchen uns Eltern ungemein. Und es ist gut und richtig, dass wir unsere Rolle ernst nehmen und uns nach Kräften darum bemühen, so liebevoll, zugewandt und authentisch wie möglich zu sein. Aber: Das alleine reicht nicht aus. Wir alleine reichen nicht aus. Denn der Motor für menschliche Entwicklung sind Begegnungen und Erfahrungen mit unterschiedlichen Menschen innerhalb und außerhalb der eigenen Kernfamilie – mit uns Eltern als sicherem Hafen im Hintergrund. Menschen brauchen vielfältige Bindungen, das hat die Wissenschaft längst gezeigt. Sind wir vor allem in den ersten Lebensjahren natürlich noch Dreh- und Angelpunkt der Welt unserer Kinder, darf und muss sich diese Welt langsam Schritt für Schritt öffnen, wollen wir unseren Nachwuchs in die Selbstständigkeit entlassen und befähigen, seine eigenen Beziehungs- und Lebensentscheidungen zu treffen.
Ein modernes Dorf – ein Bindungsdorf, wenn man so will – ist also kein physischer Ort, sondern vielmehr ein Beziehungsgeflecht. Menschen, die in unserem Leben bereits präsent sind, stellen gemeinsam mit anderen, die wir extra für diese Aufgabe ausgewählt haben, ein Umfeld, das für unser Leben als Kernfamilie den größeren Rahmen bildet. Das Dorf, das Familien heute um sich bauen können, ist also nicht mehr die schicksalhafte Dorfgemeinschaft früherer Zeiten, sondern eine Mischung aus Gewachsenem und Gewähltem. Heißt konkret: Neben Menschen, die etwa aus verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen heraus ohnehin zu unserem Umfeld gehören – wie etwa Großeltern –, inkludieren wir zusehends bezahlte Kräfte wie etwa Tageseltern oder Erzieher*innen. Sie werden damit ebenfalls Teil unseres Dorfes, wobei sie alle jeweils unterschiedliche Rollen einnehmen. Manche sind unmittelbare Bindungspersonen für unsere Kinder und teilweise auch uns Eltern, andere fungieren eher als Unterstützer*innen im Hintergrund. Beide Rollen sind wichtig: Während unmittelbare Bindungspersonen für unsere Kinder zu einer echten Familienerweiterung werden, kann uns ein unterstützendes Netzwerk im Rücken die Entlastung ermöglichen, die wir für unsere eigene Bindungszeit mit unseren Kindern brauchen. Ein freundlicher Mensch, der für uns die Wäsche wäscht oder uns Essen bringt, damit wir mit unserem Kind spielen können, kann eine genauso wichtige Rolle in unserem Bindungsnetz einnehmen wie jemand, dem wir direkt unser Baby ins Tragetuch packen würden. Mit den Jahren können sich diese Rollen natürlich wandeln: Je nachdem, was unsere Kinder und wir, aber natürlich auch die Menschen um uns herum gerade brauchen und geben können. Denn ein Bindungsdorf ist kein einseitiges Konstrukt. Es geht dabei nicht darum, dass Menschen, die selbst nichts zu wollen haben, uns Eltern möglichst alles abnehmen. Stattdessen geht es um ein vertrauensvolles Miteinander, das alle Seiten als fair und weitgehend ausgewogen empfinden. Damit das klappt, müssen wir unsere Beziehungen aktiv gestalten, sowohl mit den Menschen, die schon da sind, als auch mit denen, die neu dazukommen. Dabei sollten wir nicht den Anspruch an uns haben, alle Leute lieben zu müssen, die mit unserem Kind in Kontakt kommen. Aber ein vertrauensvolles Verhältnis, das auf gegenseitigem Respekt beruht – das sollte unser Leitstern sein.
Das Geniale an einem modernen Bindungsdorf ist, dass es an vielen Orten zugleich sein kann. Nicht alle Menschen, die uns nah und wichtig sind, müssen in unserer Nähe leben. Ein Bindungsdorf entsteht auch, wenn Enkelkinder mit ihren weit entfernt lebenden Großeltern videotelefonieren, wenn wir uns gegenseitig Päckchen und Briefe schicken, uns aufeinander freuen und aneinander denken. Ich habe eine sehr enge Freundin, die ich nur ausgesprochen selten sehe. Also wirklich: alle zwei bis drei Jahre. Trotzdem sind wir über Messenger nahezu täglich in Kontakt und haben regen Anteil am Leben der anderen, und unser Austausch über unsere Herausforderungen im Familienalltag ist für mich so wertvoll und stärkend, dass diese Freundin auf jeden Fall eine wichtige Säule meines persönlichen Bindungsnetzes darstellt.
Gleichzeitig lebt unser Dorf jedoch auch von ganz konkreter Hilfestellung vor Ort, davon, dass Menschen da sind und anpacken können, wenn wir Unterstützung brauchen. Doch weil unser Bindungsnetz so groß und weit sein kann, wie wir wollen, ist darin für alle Platz, die uns wichtig sind: Menschen in der Nähe und in der Ferne, Verwandte und Freunde, bezahlte und unbezahlte Lebensretter. Unser Dorf kann winzig klein sein oder riesengroß, ganz lokal verankert oder über mehrere Länder verstreut – Hauptsache, es trägt uns und gibt uns das gute Gefühl, mit unseren Kindern nicht völlig auf uns allein gestellt zu sein. Denn das tut niemandem gut.
So klug es ist, sich darüber klar zu werden, was für Eltern wir sein und wie wir in unserer kleinen Familie miteinander umgehen wollen, so unklug wäre es, dort stehen zu bleiben. Kindheit ist mehr als das Miteinander im trauten Kreis der Kleinfamilie. Großwerden bedeutet immer auch freischwimmen, rausgehen in die Welt, neue und eigene Erfahrungen sammeln. Dazu braucht es ein Dorf. Genauer: ein Umfeld, in dem unsere Kinder in einem sicheren Rahmen erleben können, dass die Welt größer, bunter und vielfältiger ist, als unsere eigene kleine Familie das je sein könnte. Und dass es wertvoll ist, beides zu haben: Menschen, die unser Zuhause sind. Und Menschen, die uns zeigen, was es sonst da draußen noch so alles gibt.
Anfangen, wo wir stehen
Ein tragfähiges soziales Netz ist Gold wert – trotzdem kann der Gedanke daran auch Druck machen. Viele Eltern haben ohnehin das Gefühl, dass ihre To-do-Liste niemals endet. Und jetzt sollen sie sich auch noch ein ganzes Dorf bauen? Das klingt schnell überfordernd.
Deshalb ist es mir an dieser Stelle wichtig zu betonen: Ein Bindungsnetz, das auf länger gewachsenen und über Jahre gepflegten Beziehungen beruht, ist viel Arbeit. Es gibt Menschen, denen geht diese Arbeit leichter von der Hand als anderen. Gesellschaftlich werden große soziale Netze oft als Erfolg gesehen und manchmal etwas unkritisch bewundert. Dabei sagt die Größe noch nichts über die Qualität der in diesem Netz aufgehobenen Beziehungen aus und die gegenseitige Bereitschaft, füreinander da zu sein. Wie viele Menschen man zu seinem Umfeld zählen möchte, ist zudem schlicht individuell. Oder den Umständen geschuldet: Trennungen, Todesfälle oder auch Umzüge reißen manchmal Löcher in unser Netz, ohne dass wir das wollen.
Ein großes soziales Netz zu pflegen kann man ohne Weiteres mit einem Job vergleichen, bei dem man immer gut zu tun hat. Beziehungen, auch die virtuellen, leben von Kommunikation und gemeinsamer Zeit. Es gibt Menschen, die haben diese Zeit, die Persönlichkeit und auch die Kraft dafür, bevor sie Kinder bekommen – und können in den darauffolgenden Jahren von diesem Netz profitieren. Andere erben ein solches soziales Netz in weiten Teilen von ihren eigenen Eltern, indem sie deren Freundschaften und Kontakte sozusagen in nächster Generation weiterführen. Beides ist jedoch selten. Schließlich leben viele von uns heute nicht mehr dort, wo sie aufgewachsen sind. Selbst wenn, haben sich unsere Bedürfnisse mit den Jahren oft so verändert, dass die Freunde von früher nicht mehr unsere Wegbegleiter von heute sind. Und das ist okay. Wie unser soziales Netz gerade aussieht, hängt also von vielen unterschiedlichen Voraussetzungen ab, von denen wir manche in der Hand haben und andere nicht.
Damit ein Bindungsnetz zu knüpfen nicht zum nächsten Stressfaktor in unserem ohnehin oft überfrachteten Familienleben wird, ist es mir deshalb ganz wichtig, jeden Druck aus diesem Begriff zu nehmen. Ein Bindungsnetz, wie ich es meine, muss weder riesengroß noch seit Jahren im Bau sein. Es kann auch aus uns als Kleinfamilie, unseren besten Freunden und der Tagesmutter bestehen. Dann ist es nicht weniger wertvoll als ein weit verästeltes Familiengeflecht, das zig Generationen zurückreicht.
Die meisten Familien sind heute gar nicht in der Lage, ein großes Beziehungsnetz zu pflegen. Das ist kein Makel und erst recht kein persönliches Versagen, sondern schlicht: normal. »Dann müssen wir es eben alleine schaffen«, denken sich viele Eltern in dieser Situation, und darin ist oft ein wenig Selbstbestrafung enthalten: »Wenn wir es eben nicht gebacken kriegen, uns ein gescheites soziales Netz aufzubauen, dürfen wir auch nicht jammern, wenn wir alles ohne Hilfe hinkriegen müssen.« Genau das sehe ich anders. Ich bin überzeugt: Jede Familie hat das Recht auf Unterstützung durch die Gemeinschaft. Jede Familie darf sich ein Bindungsnetz schaffen, das zu ihr passt, auch ohne dafür viele Ressourcen aufwenden zu müssen. Meine Herangehensweise an die Entlastung des Systems Kernfamilie ist deshalb so simpel wie pragmatisch: Wir schauen uns an, welche Menschen in unserem Umfeld ohnehin schon da sind und wie sie uns besser helfen können – entweder weil sie Teil unserer weiteren Familie sind oder eben Freunde. Diese Hilfe ergänzen wir, wenn gewünscht, mit professioneller Unterstützung durch Menschen, die dafür bezahlt werden, entweder selbst gute Bindungsarbeit zu leisten oder uns für einen stressfreieren Alltag mit unseren Kindern den Rücken freizuhalten.
Niemand muss für ein Bindungsnetz, wie ich es Familien wünsche, erst einmal die ganze Nachbarschaft zum Kaffee einladen und sämtlichen Eltern-Kind-Gruppen der örtlichen Familienbildungsstätte beitreten. Stattdessen plädiere ich dafür, da anzufangen, wo wir stehen, und die Beziehungen, die ohnehin schon da sind, so zu gestalten, dass sie uns möglichst entlasten. Wenn wir wollen, können wir dann im nächsten Schritt zusätzlich in Kita, Tagespflege oder Schule nach neuen Beziehungen Ausschau halten, die uns und unseren Kindern guttun. Wir können da ruhig auch ein wenig den Kindern folgen. Spätestens wenn sie beginnen, Freundschaften zu schließen, eröffnen sich ihnen, aber auch uns neue Wege, unser Dorf weiterzubauen.
Nur die Mama? Steinzeitmythen loslassen – Bindung zulassen
Klingt gut, so ein Dorf – das finden wohl die meisten Eltern. Doch tatsächlich eins zu bauen fällt vielen Menschen der heutigen Elterngeneration schwer. Warum? Weil uns dabei oft unbewusst jede Menge Steine im Weg liegen, die mit unserer individuellen Biografie, kulturellen Prägungen und tief verankerten Überzeugungen und Glaubenssätzen zu tun haben. Diese Steine müssen wir uns anschauen, um gedanklich und emotional überhaupt wirklich offen für ein echtes Bindungsnetz jenseits unserer engsten Kernfamilie zu sein. Tun wir das nicht, zwingen wir uns vielleicht trotzdem irgendwann, unser Kind auch anderen anzuvertrauen, weil es eben nicht anders geht – aber das wird sich dann nicht gut und richtig anfühlen. Nehmen wir uns also die Zeit und sehen uns an, warum uns Eltern vor allem kleiner Kinder das Bindungs- und Betreuungsthema so verunsichert. Fragen wir uns, wie wir Ordnung schaffen können in dem Chaos im Kopf, im Bauch und im Herzen, das es uns oft so unfassbar schwer macht, unser Kind – zumindest gefühlt – in andere Hände zu geben.
Fangen wir dabei am Anfang an: in der Steinzeit, der Wiege der Menschheitsgeschichte. In den letzten Jahren ist es zu einer gewissen Mode geworden, Elternsein unter Steinzeitbedingungen zu verklären und zu einer Art vergessenem Menschheitserbe zu stilisieren, das es nur wiederzuentdecken gelte. Befeuert wurde diese Idee dadurch, dass tatsächlich für viele Familien sehr verbindende und hilfreiche Strategien wie das Tragen von Babys und Kleinkindern in Tüchern oder Tragehilfen, das Stillen, aber auch etwa das gemeinsame Schlafen im Familienbett zu besonders naturnahen, weil schon in der Steinzeit verbreiteten Praktiken erklärt wurden – auch wenn das zweifelsohne kuschelige Co-Sleeping in modernen Doppelbetten nur wenig mit den tatsächlichen Schlafbedingungen von Steinzeitbabys zu tun hat. Auch der fehlende unterstützende »Stamm« wurde ein Topos, der vielen Eltern heute geläufig ist – als Begründung für die eigene Erschöpfung und Überforderung, aber auch als Appell, sich zu vernetzen und in gewisser Weise die fehlenden, vermeintlich natürlichen Strukturen wiederaufzubauen.
Dabei wird die populäre Leitfrage »Was würden Steinzeiteltern jetzt tun?« weniger mit Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse denn auf romantisierende Vorstellungen eines so heimeligen wie ursprünglichen Steinzeit-Familienlebens beantwortet, das es so nie gab. Eine Mutter erklärte mir einmal am Rande eines Workshops, moderne Krippenbetreuung sei schon allein deshalb nicht artgerecht, weil Steinzeitbabys zwar auch von anderen Menschen betreut worden seien, jedoch immer die Freiheit gehabt hätten, zu ihren leiblichen Müttern zu krabbeln, wenn sie diese vermisst hätten. Schließlich hätten die Mütter früher ja immer in der Nähe ihrer Babys genäht und gekocht, während die Männer auf die Jagd gegangen seien. So idyllisch dieser Gedanke der ursprünglichen Steinzeitfamilie auch sein mag, in der jeder seinen Platz hat und kein Baby je von seiner Mama getrennt sein muss, so fern ist er auch von der Wirklichkeit, wie sie Forschungsergebnisse nahelegen. Zwar stieg vor rund 30 000 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch älter als dreißig Jahre wurde.3 Dennoch verloren nicht wenige Kinder vermutlich bereits in den ersten Lebensjahren wenigstens ein Elternteil und wurden fortan von anderen großgezogen. Ohne Mama, zu der sie mal eben krabbeln konnten. Zudem blieb die durchschnittliche Lebenserwartung eines Steinzeitmenschen bei rund dreißig Jahren stecken, auch wenn irgendwann immer mehr Menschen das späte Erwachsenenalter erreichten. Verantwortlich für diesen niedrigen statistischen Wert war die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit. 27 Prozent aller Babys überlebten ihr erstes Jahr nicht, und 47 Prozent aller Kinder starben, bevor sie die Pubertät erreichten.4 Auch sonst war die Welt unserer Vorfahren »nicht mit Plüsch ausgelegt«, wie es der Kinderarzt und Evolutionsforscher Dr. Herbert Renz-Polster in einem Interview formulierte.5 Schmerzliche Trennungen waren beim tagtäglichen Überlebenskampf in der Wildnis quasi vorprogrammiert. Krankheiten, Hunger und ernste Verletzungen gehörten zum Alltag. Als Wissenschaftler*innen und Freiwillige im Jahr 2015 im Steinzeitpark Dithmarschen aus Forschungsgründen anderthalb Monate lang versuchten, wie echte Steinzeitmenschen zu leben, nahm die Gruppe aus guten Gründen keine Kinder mit: So viel Steinzeit traute man sich dann doch nicht zu.6
Die typischen Steinzeitbilder von den Frauen am Feuer und den Männern auf der Jagd entstanden im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Die moderne Archäologie geht davon aus, dass steinzeitliche Funde damals so interpretiert wurden, auch weil das der zeitgenössischen Geschlechterordnung entsprach. Ob aber Steinzeitmütter wirklich immer in der Nähe ihrer Babys und Kleinkinder arbeiteten oder selbst auf die Jagd gingen und den Nachwuchs von zwei Männern an der Feuerstelle beaufsichtigen ließen – unser Wissen ist hier zumindest sehr lückenhaft. Möglich ist das eine wie das andere. Neuere Funde in Peru weisen jedenfalls darauf hin, dass es in der Steinzeit durchaus auch Jägerinnen gab.7
Betreuungsvielfalt in anderen Kulturen
Wenn wir unseren Blick auf Kulturen richten, die noch heute als Jäger und Sammler leben, stellen wir fest, dass es auch dort nicht ein Modell der Kinderbetreuung gibt, sondern viele verschiedene. In der breiten Bevölkerung ist genau das jedoch nicht bekannt. Stattdessen hält sich hartnäckig das Bild, dass in »ursprünglichen« Kulturen ausschließlich Mütter die Kinderbetreuung leisten würden und dass dies deshalb die gesündeste, natürlichste und beste Lösung sei. Diese Annahme fußt primär auf Beobachtungen der !Kung San, die im Norden Botswanas noch immer so leben, wie es unsere Vorfahr*innen wohl über Jahrtausende getan haben. Was der kanadische Anthropologe Richard Lee, der zu Forschungszwecken mehrere Monate bei den !Kung San lebte, in seinem Buch The !Kung San: Men, Women and Work in a Foraging Society über deren Kinderbetreuungspraxis zu berichten wusste, stützte tatsächlich das beliebte Bild der idealtypischen Steinzeitmütter: Für !Kung-Frauen ist Mutterschaft Vorrecht und primärer Lebensinhalt. Aber durchaus mit einem Detail, bei dem wir westlich geprägten Eltern ziemlich schlucken müssen: Nach der Geburt entscheiden !Kung-Mütter zunächst ganz grundsätzlich, ob sie ihr Baby überhaupt großziehen oder ob sie es gemeinsam mit seiner Nachgeburt beerdigen. Beide Entscheidungen werden als moralisch gleichwertig angesehen und sind ein anerkanntes Instrument zur Familienplanung, um etwa einer Überforderung der Mutter durch zu kurze Altersabstände zwischen Geschwisterkindern vorzubeugen. Entscheidet sich eine !Kung-Mutter jedoch für ihr Kind, ist sie für die darauffolgenden ungefähr drei bis vier Jahre tatsächlich nahezu mit ihm verwachsen, so eng ist die Bindungs- und Betreuungsbeziehung. !Kung-Kinder werden nahezu ausschließlich von ihrer Mutter am Körper getragen, beim kleinsten Maunzen gestillt, nachts neben ihr gebettet und sind kaum je von ihr getrennt. So entsteht eine ausgesprochen sichere Bindung, die sich erst lockert, wenn das älter werdende Kind nach und nach in die Strukturen der gemeinschaftlichen Kinderbetreuung überwechselt, während die Mutter typischerweise das nächste Baby bekommt und sich voll dessen intensiver Betreuung verschreibt.
Schilderungen dieser Art der Kinderbetreuung fanden in Medien und Öffentlichkeit hohen Anklang, auch, weil sie wie ein Beleg für die Thesen der jungen Autorin Jean Liedloff klangen. Liedloff hatte bereits 1975 mit The Continuum Concept (deutscher Titel: Auf der Suche nach dem verlorenen Glück) ein Buch über ihre Erfahrungen bei den indigenen Yequana in Venezuela veröffentlicht, wo sie ganz ähnliche Betreuungspraktiken beobachtet hatte. Die Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert konstatiert dazu: »Der Muttermythos in den westlichen Industrienationen der 1970er-Jahre profitierte in einem ungeahnten Ausmaß von diesen Berichten über Lebensweise und Kinderbetreuung bei den Naturvölkern.«8