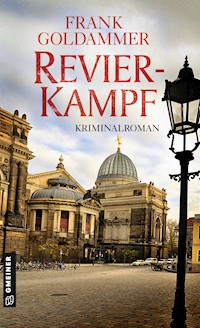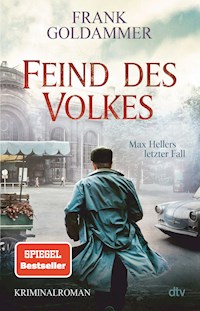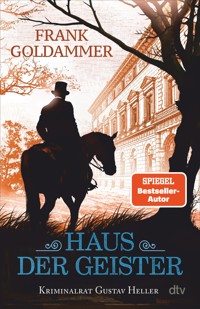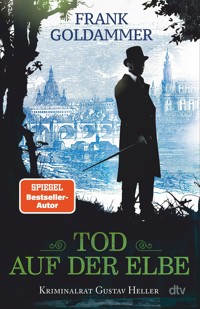12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Heller
- Sprache: Deutsch
Ein Kämpfer für Gerechtigkeit – wie Max Heller wurde, wer er ist 1917 kehrt der 21-jährige Max Heller verletzt und traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Im von Hunger, Gewalt und politischen Unruhen geprägten Dresden sucht er nach einem Weg zurück ins Leben, nach Ablenkung, nach Liebe und nach einer Aufgabe. Die Konfrontation mit brutaler Bandenkriminalität, sein großer Gerechtigkeitssinn und der Rat seines Großvaters Gustav Heller, einem Kriminalrat a.D., führen ihn in den Polizeidienst. Als frischgebackener Schupo verliebt sich Heller bei einem Elbdampferausflug in die junge Karin. Doch der Standesunterschied scheint eine Beziehung unmöglich zu machen ... Die bewegende Vorgeschichte von Max Heller und ein eindringlicher Blick auf ein erschüttertes Deutschland und seine Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Goldammer
In Zeiten des Verbrechens
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Prolog
Durch knietiefen Schlamm watete er vorbei am Wachposten, der auf einem hölzernen Absatz stand und durchs Periskop blickte. Es hatte aufgehört zu regnen, doch jeder ahnte, dass es nur eine kleine Verschnaufpause war. Der Himmel war grau, es regnete seit Tagen fast ununterbrochen. Nach der nächsten Biegung sprang er über eine scheinbar harmlose Pfütze. Er wusste, dass er bis zum Bauch darin verschwinden würde. Weiter hinten schaufelten zwei Kameraden, bewacht von einem Leutnant, Schlamm zur Seite. Die Grabenwand war eingestürzt, und die Männer versuchten sie zu begradigen und mit einem Lattengestell zu stützen. Doch der weiche Erdboden sackte immer wieder nach. Er salutierte dem Leutnant, der mit verdrossener Miene den Gruß erwiderte, und schob sich an ihm vorbei. Der Offizier war genauso nass, verdreckt, unterkühlt und hungrig wie alle anderen. Einer von den Guten.
Über allem lag das stetige Donnern der feindlichen Kanonen. Seit sechs Tagen ging das so. Stunde um Stunde bestrichen sie die gesamte Front mit Granatfeuer. Tausende, Hunderttausende Granaten, als kämen sie aus einer niemals versiegenden Quelle. Keiner wollte es eingestehen, doch das andauernde Gehämmer, das Pfeifen, das Zerbersten, der Schlamm, der tonnenweise aufgeworfen wurde und wieder zu Boden klatschte – das alles riss an den Nerven, machte die Männer mürbe. Alle dachten sie, mach doch, Franzos’, greif doch endlich an, denn das war es, worauf es schließlich hinauslaufen musste. Der Feind schoss und schoss und schoss, versuchte sie verrückt zu machen, versuchte ihre Kraft zu brechen. Noch schlimmer als das Feuern jedoch war der kurze Moment der Ruhe, nachdem eine Granate explodiert war, wenn sie aus gerade noch lebendigen Leibern, schlagenden Herzen und denkenden Hirnen einen Haufen zerfetzten Fleisches gemacht hatte.
Er lief weiter in Richtung seines Unterstandes, um dem Unteroffizier die Meldung zu bringen, die man ihm im Gefechtsstand übergeben hatte. Der Regen setzte erneut ein. Ganz plötzlich goss es aus heiterem Himmel, als schütte der liebe Gott Kannen aus. Seine Stiefel versackten im Schlamm, saugten sich darin fest, und auf den nächsten zwanzig Metern musste er sich ducken. Hier war der Graben nicht besonders tief. Immer wieder gab es Unvorsichtige, denen ein französischer Scharfschütze ein Loch in den Kopf schoss. Ein lautes Pfeifen kündigte eine Granate an, und er warf sich zu Boden. Das Geschoss schlug keine zehn Meter neben dem Graben ein, warf Gras und Erde auf, ließ die feuchten schweren Klumpen auf ihn niederprasseln. Er stand langsam wieder auf, war völlig durchnässt und von oben bis unten mit Schlamm bedeckt. Er hatte nichts zum Wechseln, konnte nur hoffen, dass ihm etwas Zeit bleiben würde, um sich an dem selbst gebauten kleinen Ofen in ihrem Unterschlupf ein wenig zu wärmen, bevor er auf Wache gehen musste.
Endlich sah er den Eingang, ein Loch, nur gebückt zu betreten. Jemand kam heraus und lachte, als er ihn sah. So voller Schlamm, ganz und gar rotbraun, musste er einen erbärmlichen Anblick abgeben. Er tauchte in den Unterschlupf ein. Der Raum war gerade so groß wie eine gute Stube, niedrig wie ein Bergwerksstollen und mit einem Dutzend Männern besetzt. Der Unteroffizier saß an einem hölzernen Tisch, auf dem eine Petroleumleuchte stand.
»Melde gehorsamst …«, begann er, als das gellende Kreischen einer Granate heranraste.
»Deckung!«, brüllte der Unteroffizier.
Schmerz brachte ihn wieder zu Bewusstsein. Erbarmungsloser Schmerz, ein höllisches Feuerschwert, das in seinem Fuß steckte. Er wollte schreien. Doch er konnte nicht. Weder bekam er Luft, noch konnte er seinen Mund bewegen. Nichts konnte er bewegen. Er sah nichts, hörte nichts, fühlte nur den Schmerz.
Und das Gewicht, das ihn niederpresste, das es ihm unmöglich machte, sich zu rühren. Es drückte ihn in den weichen Boden, und er merkte, wie er langsam versank. Kalter Schlamm stieg an ihm auf, durchnässte seinen Rücken, seinen Unterleib, stieg ihm bis zum Hals. Er konnte nichts tun, war begraben unter einer Tonnenlast, schmeckte Schlamm und Blut und fühlte, wie das brackige Wasser immer weiter stieg, Millimeter um Millimeter, schon fühlte er es in seine Ohren laufen. Er wollte schreien, wollte sich bewegen, wollte dagegen ankämpfen, glaubte etwas zu hören, wollte rufen, helft, helft, und die Angst, sie könnten gehen, ihn übersehen, und er müsste ersticken und ertrinken unter dieser Last aus Leibern, Schlamm und Holz, steigerte sich zu blinder Panik. Er schnappte nach Luft, schluckte blutigen Schlamm, wollte sich befreien. Doch er war gefangen, als hätte man ihn in Beton gegossen, eingeschlossen in eine tiefe Gruft, in der niemand ihn jemals finden würde, verschwunden, ausgelöscht, als hätte es ihn nie gegeben.
1917
Die Bremsen quietschten laut und schrill, als der Zug in den Bahnhof einfuhr. Mit einem letzten heftigen Ruck kam er zum Stehen. Max Heller musste einen kleinen Schritt zur Seite machen, um nicht zu fallen. Ihm war in den letzten zwei Stunden der Fahrt kein Sitzplatz beschieden gewesen, und so hatte er sich an die Tür gestellt, um wenigstens aus dem Fenster sehen zu können. Nun stand er dort und musste sich gegen das Drängen der anderen Fahrgäste wehren, die aussteigen wollten.
»Jetzt machen Sie doch mal«, beschwerte sich jemand.
»Steht da und hält Maulaffen feil«, meckerte ein anderer.
Ein Mann, der eine Melone trug, griff an Heller vorbei und entriegelte die Tür. »Hast es wohl geschafft?«, fragte er.
Heller nickte wortlos.
»Meine Jungen sind noch dort. Einer im Westen, einer im Osten, aber bei den Russen ist ja nun Revolution, schreiben die Zeitungen. Vielleicht geben sie ja den Krieg auf«, fuhr der Mann fort. Dann rief er nach hinten: »Nu drängeln Sie mal nicht so! Sie sehen doch, der ist Invalide!«
»Was heißt denn Invalide, da ist doch alles noch dran!«, beschwerte sich eine Frau.
»Lassen Sie sich mal nicht beirren.« Der Mann klopfte Heller väterlich auf die Schulter. »Was weiß die schon?«
Max Heller war mittlerweile die zwei Stufen hinabgeklettert und trat auf den Bahnsteig. Sein rechter Fuß schmerzte bei jedem Schritt. Dagegen konnte auch das Schienengestell, das man ihm als Stütze konstruiert hatte, nichts ausrichten.
Eine Weile lang sah er dem Treiben zu, den Pappkoffer mit seinen wenigen Habseligkeiten in der Hand. Er nahm kaum wahr, was geschah, so unwirklich erschien ihm alles.
Auch im Krieg reiste man also, dachte er. Doch das hier waren keine Ausflügler und Urlauber. Keiner von ihnen fuhr zum Vergnügen. Neben den Geschäftsreisenden sah er vor allem Menschen mit vollen Taschen und Rucksäcken, die wohl auf dem Land Kartoffeln und Mehl erstanden hatten. An der Treppe riefen Gepäckträger, boten ihre Dienste an, doch in diesen Zeiten trug jeder seine Sachen selbst. Es war Nachmittag, und in den Mienen der Leute las er, dass dieser Tag ihnen noch nicht viel eingebracht hatte.
»Nun mal runter vom Bahnsteig!«, mahnte ihn ein Schaffner gar nicht unfreundlich, nachdem der größte Teil der Reisenden an ihm vorbeigeströmt war. »Ohne Bahnsteigkarte kannst du hier nicht bleiben. Wenn du eine Bleibe suchst, im Foyer stehen welche von der Heilsarmee.«
»Danke, nein«, erwiderte Heller und machte sich langsam auf den Weg. Er fühlte sich ein bisschen dösig vor Hunger; den letzten Teil seiner Ration hatte er schon längst verzehrt. Am Leipziger Bahnhof hatte er sich nichts zum Mittagessen gekauft. Da er nicht wusste, ob ihm der nächste Sold gleich ausgezahlt werden würde, wollte er mit seinen letzten Groschen sparsam umgehen. Er wusste nicht mal, ob sich die Soldstelle noch immer am selben Ort befand. Und mit seinem Fuß kam ihm der Weg dahin jetzt auch viel zu weit vor. Zu viel hatte er erlebt mit dieser Armee. Vorerst aber hatte er nur ein Ziel.
Das Treiben vor dem Hauptbahnhof war ihm für einen Moment zu viel. Die Sonne schien frühlingshaft hell, doch die Luft war noch eisig. Er fühlte sich wie erschlagen. Wie konnte es sein, dass an einem Ort der Welt Schmerz, Leid und Tod herrschten, ewiger Kanonendonner, ständiger Hunger und Schmutz, und nur wenige Tagesreisen entfernt das Leben scheinbar seinen gewohnten Gang ging?
Eine Straßenbahnglocke schrillte, eine Autodroschke hupte. Zeitungsjungen priesen heiser schreiend die letzten Exemplare der Morgenausgaben an. Von einem hölzernen Turm auf der Kreuzung zum Wiener Platz gellte die Trillerpfeife eines Verkehrspolizisten. Links davon scherten die Pferde eines Lastkarrens aus, und der Kutscher hatte alle Mühe, sie zu zügeln. Passanten wichen aus.
»Vorsehen!«, rief ein Fahrradfahrer, als Heller vortreten wollte, und umkurvte ihn schlingernd.
Eine Frau mit kräftiger Statur fuchtelte dem Mann mit ihrem Regenschirm hinterher. »Auf dem Gehsteig haben Sie nicht zu fahren!«
Der Radfahrer lachte nur und schoss davon.
Die Frau wandte sich an Heller: »Sie sind wohl neu hier?«
Heller antwortete nicht, sondern fragte stattdessen: »Sagen Sie, die Bahnlinien stimmen noch?«
»Ja, warum denn nicht?«, wunderte sich die Frau. Dann sah sie seinen Fuß. »Sie kommen wohl vom Krieg. Es heißt ja, er wäre bald gewonnen.« Sie beugte sich verschwörerisch näher. »Ist das wahr?«
»So scheint es wohl«, erwiderte Heller.
Nur halb zufrieden hob die Frau das Kinn. Gern hätte Heller ihr gesagt, dass es ganz und gar nicht schien, als sei irgendetwas gewonnen. Doch er hatte noch keine richtigen Worte dafür gefunden. Er wollte nun erst einmal nach Hause zu seinen Eltern. Viel zu lange schon hatte er keine Gelegenheit gehabt, ihnen zu schreiben.
Viele Monate waren ihm im Lazarett verloren gegangen. Monate voller unsäglicher Schmerzen und Fieber, das nicht enden wollte. Immer wieder hatte man das Lazarett verlegen müssen, und jedes Mal war etwas von seinen Dingen abhandengekommen. Die Briefe, die seine Mutter ihm gewiss geschrieben haben musste, hatten ihn dort nie erreicht.
Es schien ihm eine Ewigkeit her zu sein, dass er den Feldscher angefleht hatte, ihm den Fuß zu lassen. Die Säge ratschte den ganzen Tag, und oft reichte die Zeit nicht, sie noch vom Blut des Vorgängers zu befreien. Oft genug verlängerte die Arbeit der Feldchirurgen und Ärzte das Leiden ihrer Patienten nur noch um wenige Stunden. Sie schienen längst nicht mehr zu sehen, dass es Menschen waren, die unter ihren Händen zuckten. Heller wusste nicht, warum der Chirurg seinem Flehen nachgegeben hatte. War er zu müde gewesen? Hatte er eine Sekunde lang Mitgefühl verspürt? War es ihm vielleicht völlig egal gewesen? Was auch immer es war, Heller wusste nicht, ob er ihm dafür dankbar sein sollte.
»Träumen Sie nicht in den Tag!«, fuhr ihn jemand an.
Heller drehte sich um. Der Tonfall hatte ihn schlagartig aus seinen Gedanken gerissen. Er war niemand, der sich etwas gefallen ließ, früher nicht und jetzt erst recht. Mochte sein Fuß auch kaputt sein, die Fäuste waren noch heil. Dann sah er, dass er einem Offizier der Reserve in piekfeiner Uniform gegenüberstand, kaum älter als er selbst. Er salutierte.
»Herr Oberleutnant!« Hellers Zorn flaute schnell ab. Männer wieder dieser endeten zu Tausenden in Schlamm und Blut. Und auch den hier würde es noch treffen. So schnell ging der Krieg nicht zu Ende, es würde noch der letzte Reservist gebraucht.
»Na also. Wo haben Sie sich zu melden?«
Heller nestelte seine Papiere aus der verblichenen Uniformjacke. »Bei der Soldstelle, Zeit hab ich bis Ende des Monats, Herr Oberleutnant. Den letzten Sold beziehen. Gelte als ausgemustert!«
Der Offizier prüfte Hellers Papiere. Er suchte wohl nach irgendeinem Anlass, sich noch ein wenig aufzuspielen. Doch er fand keinen. Die Stempel in den Papieren anzuzweifeln, hieße das Reich anzuzweifeln, den Kaiser höchstselbst und alles, was man ihm eingetrichtert hatte. Er gab die Papiere zurück. »Wie dem auch sei.« Er salutierte knapp und entließ Heller.
Dieser nahm nun den Koffer, den man ihm gegeben hatte, nachdem sein Tornister abhandengekommen war. In der abgenutzten, ausgeblichenen Uniform, die er bekommen hatte, weil seine ganze Habe verloren gegangen war, kam er sich gar nicht mehr wie ein Soldat vor. Mehr wie ein Landstreicher. Nichts war geblieben von dem Glanz und der Euphorie, mit der sie ausgerückt waren. Weder äußerlich noch innen. In ihm schien es nur noch Leere zu geben. All die Namen und Gesichter der letzten fast drei Jahre verschwammen zu einer grauen Masse. Keiner von ihnen mehr am Leben. Kein Freund, kein Kamerad, vier Leutnants zerstäubt, die guten wie die schlechten. Eine Granate machte keinen Unterschied.
Er lief auf die Haltestelle der Elektrischen zu. Niemand beachtete ihn mehr. Von irgendwo wehte der Geruch von Essen herüber und weckte seinen unterdrückten Hunger wieder, doch das konnte er aushalten. Er hatte viel Schlimmeres durchgestanden.
Die Straßenbahn kam. Noch bevor sie hielt, sprangen einige ab. Heller wartete, ließ andere Fahrgäste vor, griff dann nach der Haltestange, stieg mit dem linken Fuß hoch, zog den rechten nur nach.
»Bis nach dem Neustädter«, sagte Heller dem Schaffner und hielt ihm einen Groschen hin.
Der Mann nickte, reichte Heller ein Billet, schob sanft die Hand mit der Münze beiseite. »Ist gut so, Kamerad«, zwinkerte er ihm zu. Heller war zu verblüfft, um etwas zu erwidern. Er setzte sich auf einen freien Platz recht weit hinten, den Koffer nahm er auf den Schoß.
Fast drei Jahre war es her, dass er sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatte. Die ekelhaften Erniedrigungen vor der Musterungskommission kamen ihm in den Sinn, wo sie ihm und Hunderten anderen ins Maul geschaut hatten wie einem Gaul, wo sie sich hatten bücken müssen, die Pobacken spreizen, den Schwanz vorzeigen. Keiner hatte sich beschwert, denn so musste es sein. Das wusste jeder, der ein stolzer deutscher Krieger sein wollte. Und das war erst der Anfang gewesen. Unsägliches Exerzieren bestimmte die nächsten Wochen. Marschieren, marschieren, marschieren. Bett machen, auf den Zentimeter genau. Den Boden scheuern, der noch vom Vortag glänzte. Latrine putzen. Gebrüll und Schikane. All das für die Ehre, dem Ruf des Kaisers aufs Schlachtfeld folgen zu dürfen. Keiner, den Heller kannte, gab heute noch irgendetwas darauf. Da drüben im Graben wussten alle, dass sie irgendwann sterben oder zum Krüppel geschossen würden. An den Kaiser und den Sieg glaubte längst niemand mehr.
»Gestatten?«, fragte jemand ganz leise.
Heller sah auf und erhob sich hastig, als eine junge Frau neben ihm Platz nahm. Sie trug einen Korb, hatte Besorgungen erledigt. Nur ein Dienstmädchen in schlichter Kleidung, und doch senkte er den Kopf. Er fühlte sich, als stünde er tief unter ihr. Verstohlen sah er sich um. Sicher war kein anderer Platz mehr frei, sonst hätte sie sich nicht neben ihn gesetzt.
Nein, das ist nicht wahr, mahnte er sich. Sicherlich gab es noch andere Plätze. Heller sah wieder auf, sah sie von der Seite an, ganz kurz nur. Wie sie roch. So sauber, nach Seife und frischer Wäsche. So lang war er keiner Frau nahe gewesen, nicht wirklich nahe. Die Schwestern im Lazarett hatten immer kühle Distanz gewahrt, hatten sich abgeschottet von dem körperlichen und seelischen Elend um sie herum. Nur von einigen erzählte man sich, dass sie tief in der Nacht manchmal denjenigen Erleichterung verschafften, die keine Arme oder Hände mehr hatten.
Noch einmal wagte Heller einen Blick. Das Dienstmädchen senkte den Kopf und unterdrückte ein Lächeln.
Nein, sagte er sich, dafür würde noch die richtige Zeit kommen. Wie mochte er ihr erscheinen, in seiner Uniform, die an seinem Leib schlackerte? Er hatte abgenommen, war nur noch ein Schatten seiner selbst. Ausgezehrt von Hunger und Fieber, vom Kampf gegen die Entzündung, die ihn fast umgebracht hätte. Aber der Mann im Zug hatte recht gehabt. Was wussten sie schon, die anderen? Er musste sich nicht kleinmachen. Er musste sich nicht schämen, er hatte seinen Teil getan. Er trug seine Last. Und doch, wenn er in den Gesichtern der Fahrgäste las, glaubte er Widerwillen, Abscheu und Skepsis zu sehen. »Wie dem auch sei«, hatte der Oberleutnant beim Bahnhof gemeint. »Drückeberger«, hatte er wohl wirklich sagen wollen. Nur ein Stempel hatte ihn davon abgehalten.
Am Wettiner Bahnhof vorbei hatten sie schon die Elbe erreicht. Der Fluss war so anders als der Rhein, den er einmal überquert hatte, voller Abenteuerlust und Tatendrang, jung und gesund. Und später dann ein zweites Mal als Krüppel, ausgebrannt, jeder Illusion beraubt. Dies hier war sein Fluss, an diesen Ufern war er aufgewachsen. Doch wenn er geglaubt hatte, hier würde es besser werden, dann hatte er sich getäuscht. Das Gefühl, in einem Traum zu sein, verstärkte sich sogar noch. Die Angst, bald zu erwachen, auf der harten Pritsche des provisorischen Sanatoriums, noch in Hörweite der Artillerie, war übermächtig.
Er sah aus dem Fenster, hoffte, irgendein bekanntes Gesicht auf der Straße zu entdecken. Doch in einer Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohnern war das unwahrscheinlich. Er sah den riesigen Speicherbau, noch vor dem Krieg von Erlwein errichtet. Etwas weiter dahinter das Schloss, die Hofkirche. Das Ständehaus, die Sophienkirche. Noch weiter hinten gluckte die Frauenkirche und am anderen Elbufer das Japanische Palais. Alles bekannte Bilder, und doch waren ihm hier alle Leute fremd. Als wären es völlig andere Menschen als jene, die ihn und sein Hundertstes Königliches Grenadierregiment mit Blumen, Blasorchester und Jubelspalier verabschiedet hatten. Hier zeigte niemand Interesse an ihm. Niemand wollte wissen, was er gesehen und erlebt hatte.
Doch sicher urteilte er wieder zu hart. Sie hatten zu tun. Gewiss war alles knapp und rationiert. Gewiss hatten sie alle einen im Felde stehen, Vater, Bruder, Sohn. Und sicherlich kannte inzwischen jeder jemanden, dessen Vater, Bruder oder Sohn dort im Feld geblieben war. Fast musste man sich schon dafür schämen, zurückgekehrt zu sein.
»Schönen Tag wünsche ich noch«, verabschiedete er sich von dem Dienstmädchen, als sein Umsteigepunkt erreicht war. Die junge Frau nickte ihm freundlich zu.
Der Schaffner der Linie 15 nahm seinen Groschen und reichte ihm wortlos die Karte. Immer die Leipziger Straße entlang ging es nun in Richtung der Vorstadt Pieschen. Ein Weg, den er schon Hunderte Male gegangen oder gefahren war. Das Haus, in dem seine Eltern einen Laden und eine Wohnung gemietet hatten, wo er geboren und aufgewachsen war, lag nicht mehr weit entfernt. Wie mochte es ihnen ergangen sein? Was war ihnen widerfahren in den letzten Monaten? Er hatte seinen Kameraden Johann Holzapfel, dem kurz vor seiner Verwundung ein Urlaub genehmigt worden war, gebeten, ihnen einen Gruß zu bestellen. Doch Holzapfel war nie aus seinem Urlaub zurückgekehrt, und Heller befürchtete, dass er es nicht mal bis nach Dresden geschafft hatte. Ein Querschläger, ein verirrter Granateinschlag, ein Jagdflieger, eine Krankheit – es konnte einen überall erwischen. Im Schlaf, beim Essenfassen, auf der Latrine, bei einer Besorgung, auf dem Heimweg.
Wie absurd es war, dass hier alles seinen gewohnten Gang ging. Heller lachte laut auf und nahm sich sogleich zurück. Doch schon hatten sich ihm ein paar Gesichter zugewandt und musterten ihn.
Die Bahn hatte den ersten Winterhafen passiert, und der zweite kam in Sicht. Bald hieß es aussteigen, und endlich, endlich keimte in ihm etwas. Ein schwaches Gefühl von Freude, ganz vorsichtig noch, denn er wollte die Flamme nicht zu hoch brennen lassen. Vielleicht hatten sie ihm gar keine Briefe mehr geschickt. Schon vor dem Krieg war seine Mutter nie ganz gesund gewesen. Vielleicht war etwas geschehen; sein Vater hätte es nicht übers Herz gebracht, einen Brief mit so tragischem Inhalt an die Front zu schicken.
Schluss. Aus. Still, dummer Kopf, mahnte er sich. Mach dich nicht verrückt, so kurz vor der Heimkehr. So lang hast du ausgehalten, in wenigen Minuten wirst du es wissen. In wenigen Minuten empfängt dich deine Mutter, und alles wird sich aufklären. Dann bist du daheim.
Seinen Fuß würde man behandeln müssen. An Essen würde es nicht mangeln, und die Verkaufslizenzen würden auch in schlimmsten Zeiten eine Versorgung gewährleisten. Er würde sich Arbeit suchen müssen, sicher gab es auch für einen wie ihn etwas zu tun.
Etwas würde sich finden.
Die Bahn hielt, und als Heller mit dem linken Fuß voran vom Trittbrett stieg, sah er endlich das erste bekannte Gesicht. Der alte Sebastian verbrachte sein Leben am Hafen, saß auf Kisten und bettelte, immer eine Flasche unterm Rock. Wenn es einen wie den noch gibt, wenn einer wie der seinen Schnaps bekommt, können die Zeiten nicht so schlimm sein, sprach Heller sich Mut zu. Vermutlich hatte der Alte seine zehn Mark vom Wohlfahrtsamt geholt, sie sogleich im Spirituosenhandel eingelöst und wankte nun wieder zum Pieschner Hafen hinab.
Als Nächstes erkannte Heller die alte Polig, die mit einem Handkarren die Straße entlanglief. Wie immer sprach sie mit sich selbst, und der Eindruck, die Zeit sei hier stehen geblieben, verstärkte sich noch mehr, als die feuerrote Katze des Hafenvorstehers ganz gemächlich die Straße überquerte. Dabei ließ sie sich weder vom Omnibus stören, dessen Zugpferde schnaubten, noch vom Quäken einer Autohupe.
Heller bog in die Torgauer, dann in die Bürgerstraße ab. Vom Güterbahnhof hallten metallische Schläge herüber, Gestein prasselte in leere Loren, und das Kreischen von Bremsen war zu hören. Irgendwo krähte ein Hahn, Tauben gurrten, Sperlinge tschilpten. Hunde begannen zu kläffen, jemand schrie sie an und brachte die Tiere damit zum Verstummen. Viele Menschen kamen ihm entgegen oder überholten ihn auf dem Bürgersteig. Wirklich Notiz nahm keiner von ihm.
Dann sah er Waltraud, genannt Walli, die Tochter des Bäckers. Sie kehrte den Gehsteig, und er musste zweimal hinsehen, um sie zu erkennen. War sie bei seiner Abfahrt noch ein zierliches Mädchen gewesen, gerade konfirmiert, sah sie nun drall, fast pausbäckig aus. Ihr Gesicht hatte beinahe grobe Züge angenommen, und sie ähnelte ihrer streitsüchtigen Mutter. Heller nickte ihr zu, doch sie erkannte ihn nicht, hob schnippisch das Kinn wie eine Dame vom Adel und betrat den elterlichen Laden, als wäre er ein Schloss.
Dann endlich sah er den Laden seiner Eltern. Ein Fähnchen hing draußen, dasselbe wie vor drei Jahren. Der Saum war vom Wind ganz zerfasert. Der Sarotti-Mohr längst verblichen, kaum noch zu erkennen. Das Gemüse in der Auslage vor dem Schaufenster lag welk. Gerade verließen zwei Frauen den Laden und schimpften leise. Sie waren sich einig, dass die Hellers das gute Zeug unter der Ladentheke für die Herrschaften zurückhielten oder es selbst fraßen.
Garstige alte Weiber. Es juckte ihn, denen die Meinung zu geigen. Seine Eltern waren die bescheidensten Händler in der ganzen Straße. Zu bescheiden, wusste er. Mit wenig Geschäftssinn. Ihr kleiner Krämerladen hatte nie große Gewinne abgeworfen, selbst in guten Zeiten. Trotz des großen Sortiments, oder vielleicht gerade deshalb. Süßwaren und Milch gab es hier, Mehl, Zucker, Salz, Bonbons und Kerzen. Zigaretten, Schnaps, Butter und Käse, Öl und Petroleum, Eis für die Kühlschränke der Herrschaftshäuser. Streichhölzer und Draht, Waschpulver und Seife, Knöpfe und Nähgarn, sogar Schrauben und Nägel sowie unzählige andere Dinge, die immerzu bestellt und sortiert werden mussten. Geld für eine Aushilfe hatten sie nie gehabt. Diese Aufgabe hatte er übernommen, hatte klaglos alle Arbeiten ausgeführt, schon als kleiner Junge. Dafür hatten sie ihm die höhere Schule bezahlt, hatten sich das Geld vom Munde abgespart, um wenigstens ihrem Sohn bessere Perspektiven bieten zu können. Allein der Krieg hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht nur hatte er die Schule mit Notabitur abgeschlossen, um sogleich an die Front zu kommen. Seitdem er weg war, hatten sie auch noch allein auskommen müssen.
»Kennen Sie den Heinrich?« Jemand zupfte ihn am Ärmel, noch ehe er den Laden erreicht hatte. Er kannte die Frau. Sie hieß Itzig, und ihr Mann war vor vielen Jahren im König-Albert-Hafen von Fässern erschlagen worden, die von einem Kranseil fielen. Da war Heller gerade zehn Jahre alt gewesen. Wie so viele andere auch, war er damals hingelaufen, um die Leiche zu begaffen. Herr Itzig hatte dagelegen, als schliefe er. Für die Kinder war das fast enttäuschend gewesen, und keiner von ihnen hatte sich Gedanken darüber gemacht, welches Elend damit über die Familie gekommen war. Man hatte der Witwe zwanzig Mark als Entschädigung gegeben. Seitdem hatte sie mit ihrem Sohn Heinrich in einer Dachwohnung hausen müssen. Aus einem Brief, den Heller noch vor der Schlacht von Vimy von seiner Mutter erhalten hatte, wusste er, dass Heinrich dann gleich in den ersten Kriegstagen gefallen war.
»Ich kannte ihn«, sagte Heller und löste die Finger der Frau von seinem Ärmel.
»Haben Sie ihn gesehen?«, fragte sie weiter. »Sie waren doch drüben, haben Sie ihn gesehen?«
»So viele sind dort, Frau Itzig. An Ihren Sohn kann ich mich aber nicht entsinnen.« Was nützte es, ihr die Wahrheit an den Kopf zu werfen, wenn sie es offenbar noch immer nicht verstanden hatte?
»Geh’n Sie wieder hin?«
»Nein, Frau Itzig, ich bin jetzt daheim.«
»Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, er soll seiner Mutter schreiben!«
»Das werde ich, Frau Itzig. Ich bestell es ihm.«
»Guter Junge, ich danke dir!«
Heller sah der Frau nach, die mit kaputten Hüften davonschlich. Würde sie es je verstehen? Sollte sie das überhaupt? War ihr nicht ein letztes bisschen Leben in falscher Hoffnung zu gönnen?
Heller riss sich zusammen. Zwanzig Schritte noch, dann war er daheim. Dann würde er ein Bett haben, eine Badewanne, warme Mahlzeiten, vertraute Stimmen.
Aber würden sie wirklich vertraut sein? Was, wenn er gar nicht willkommen war? Abgeschrieben? Wenn sie längst akzeptiert hatten, was die Itzig nicht wahrhaben wollte?
Sei nicht feige, mahnte Heller sich. So viel hast du ausgestanden, sei nicht feige. Dem Tod hast du ins Angesicht gesehen.
Natürlich würden sie ihn willkommen heißen.
Heller holte Luft und machte die letzten Schritte. Er streckte seine Hand nach der Ladentür aus. Doch in diesem Moment öffnete sie sich bereits, das Glöckchen darüber läutete, und seine Mutter trat ihm entgegen, eine schmale Holzsteige mit Äpfeln unter einem Arm.
»Gehen Sie nur schon rein«, sagte sie. »Bin sogleich zurück! Zigaretten sind aber gerade aus.«
Heller erstarrte. Wie eine Schaufensterpuppe drehte er sich auf der Stelle und folgte ihrer Bewegung. Er sagte nichts und rührte sich nicht.
Und auch sie erstarrte jetzt vor dem Schaufenster. Die Holzsteige fiel zu Boden, die Äpfel hüpften heraus und rollten vom Bordstein auf die gepflasterte Straße.
»Lieber Herrgott im Himmel …«, stöhnte seine Mutter.
»Ich bin wieder zurück«, flüsterte Max Heller so leise, dass er nicht wusste, ob seine Stimme ihre Ohren überhaupt erreichte. Er fühlte sich elend. Sie hatten ihn nicht erwartet. Sie hatten ihn für tot gehalten.
»Lieber Herrgott im Himmel«, sagte seine Mutter noch einmal und wagte es nicht aufzusehen. »Lieber Herrgott im Himmel, verzeih mir, Max«, brachte sie heraus, und Heller trat vor, um seine Mutter aufzufangen. Denn es sah aus, als taumelte sie, als könnte sie jeden Augenblick zusammenbrechen, weil sie glaubte, einen Geist gesehen zu haben. Es ist alles gut, wollte er sagen, gräm dich nicht, es verletzt mich nicht. Doch er konnte es nicht sagen. Denn natürlich hatte es ihn verletzt, ein klein wenig nur, aber das war nicht ihre Schuld. Jetzt erst, in diesem schmerzhaften Augenblick verstand er, was der Krieg wirklich anrichtete. Er brachte nicht nur Elend, Krankheit und Sterben. Er sorgte nicht nur dafür, dass man seinem Leben nicht mehr traute, dass man keine Freundschaften mehr schloss, weil jeden Augenblick der Tod drohte. Er sorgte auch dafür, dass man die Seinigen nicht mehr erkannte.
Seine Mutter streckte die Hände nach ihm aus, fasste mit beiden Händen nach seinem Nacken und zog ihren Sohn, der einen Kopf größer war als sie, zu sich hinab. »Wie konnte ich damit rechnen, dass du hier bist, Max?«, schluchzte sie ihm ins Ohr.
Natürlich hatte sie nicht mit ihm rechnen können, und er selbst wusste, wie er sich verändert hatte. Seine Züge waren hart geworden, der ganze Leib ausgezehrt. Er bekam keinen Ton mehr über seine Lippen.
Dann erklang das Glöckchen erneut, und einen Augenblick später legte sich eine schwere Hand auf seine Schulter. So standen sie nun zu dritt da, und seine Mutter wollte sich gar nicht mehr von ihm lösen. Die Leute auf der Straße begannen sich umzudrehen und blieben mit neugierigen Blicken stehen, denn kaum jemand zeigte seine Gefühle so in der Öffentlichkeit.
»Ilse, komm, ich hol den guten Kognak«, sagte sein Vater.
Endlich ließ seine Mutter ein wenig von ihm ab und legte ihrem Jungen beide Hände auf die Ohren, sah ihn an, prüfte, begutachtete, blickte ihm in die Augen. »Du bist zurück«, flüsterte sie.
Max Heller nickte nur. So vieles geschah gerade in seinem Kopf. Vor allem packte ihn plötzlich das schlechte Gewissen mit aller Macht. Er war hier, bei seinen Eltern. Und die anderen lagen dort im Dreck.
»Was ist geschehen?«, fragte sein Vater, der nie in einen Krieg hatte ziehen müssen. Für heute hatten sie den Laden geschlossen und saßen nun am Küchentisch in der Wohnung darüber, auf dem immer noch dieselbe Wachstuchdecke wie früher lag.
»Man hat mich ausgemustert.« Erst der dritte Weinbrand löste Hellers Zunge. »Es ist der Fuß«, erklärte er.
»Er ist noch dran?«, fragte Vater, und es kostete ihn offenbar große Mühe. Vermutlich hatte er es noch nicht einmal gewagt, genau hinzusehen, um zu erkennen, ob sein Sohn auf einer Prothese lief. Er war kein Mann, der viele Worte machte, und seine Gefühle verbarg er.
»Man wollte ihn mir abnehmen. Ich hab gewollt, dass er dranbleibt.«
»Gut.« Sein Vater nickte. Die beiden schienen um zehn Jahre gealtert. Mutter hatte Wasser in den Beinen, Vater trug seit einem Jahr ein Bruchband. Grau waren sie geworden. Der Laden brachte sie um, und die Sorge um ihren Sohn hatte alles noch verschlimmert. Die Zeiten waren schlecht. Alles wurde rationiert, Marken peinlichst kontrolliert, jede Unachtsamkeit streng angemahnt. Kunden ließen anschreiben, beteuerten zu tilgen, drohten anderswo einzukaufen und bezahlten ihre Ausstände dann doch nicht.
»Kann man es sehen?«, fragte Mutter, die am Herd stand und Brot auf der Platte röstete. Es war der einzige Ofen der Wohnung, der noch beheizt wurde. Zu knapp waren Presskohlen und Holz.
Heller nickte. Dann streifte er sich den Stiefel ab, dessen Schaft man aufgeschnitten hatte, um Platz für die Schienen zu schaffen. Sein Fuß war komplett verhärtet und wüst vernarbt, wo das Fleisch zusammengenäht worden war. Bei jeder Bewegung fühlte es sich an, als steckte ein eiserner Dorn in seinem Gelenk. Heller löste die Lederriemen der Schiene. Er wollte sie sowieso loswerden, hatte er sich geschworen. Den Rest seines Lebens würde er nicht mit diesem Gestell verbringen.
Als er das Hosenbein hochschob und die Wollsocke abstreifte, sog Mutter leise Luft durch die Zähne. Er konnte sie verstehen. Sein Fuß sah aus, als wäre er ins Maul eines Löwen geraten. Ein Klumpen, der mehr Übel mit sich brachte als Nutzen. Er war schuld daran, dass man ihn misstrauisch beäugte, ihm sein Humpeln nicht abkaufte, ihn selbst zweifeln ließ. Denn was war seine Verletzung schon gegen das, was er in den Lazaretten gesehen hatte?
»Ich war lange Zeit dem Tod näher als dem Leben«, sagte Heller und gab sich dabei, als wäre es ein Bericht über einen Fremden. »Ich hatte Fieber, wochenlang, lag im Delirium. Man hatte mich wohl auch schon abgeschrieben.« Wochen über Wochen, an die er sich kaum erinnern konnte. In seinen Träumen drehte sich alles wahnhaft im Kreis. Krankenschwestern, die sein Gesicht kühlten, ihm kalte Umschläge machten. Die seine Verbände wechselten und ihm ein Beißholz gaben, damit er nicht schrie. Ärzte bei der Visite, die ihm mit ihren Mienen zu verstehen gaben, dass er Ressourcen verschwendete, ein Bett blockierte, Ärzte und Schwestern an sich band, die woanders dringender benötigt wurden.
»Wär’s dann nicht besser gewesen …« Sein Vater sprach den Gedanken nicht zu Ende aus.
»Möglich«, erwiderte Heller schnell. Wie oft hatte er seinen Fuß verflucht, wie oft den Arzt, der seinem Drängen nachgegeben hatte. Dieser Fuß war wie ein unentdecktes Glutnest, das ein gelöschtes Haus wieder und wieder in Brand setzte. Jedes Mal, wenn er genesen schien, war das Fieber zurückgekommen.
»Wahrscheinlich wäre es mir dann aber auch nicht besser ergangen«, fügte Heller an. Er hatte zu viele Männer gesehen, die nach der Amputation an Wundfieber eingegangen waren. Denen man erst den Fuß, dann den Unterschenkel und schließlich das ganze Bein abgenommen hatte, und die trotzdem verreckt waren.
»Nun bin ich ja hier«, versuchte er von seinen Gedanken loszukommen. »Ich soll gegen die Versteifung ankämpfen, sagte ein Arzt, auch wenn es schmerzt. Ich soll das Gelenk tüchtig bewegen. Es wird sich geben, irgendwann.« Wenn nur der glühende Dorn nicht wäre, der irgendwo da drin zu stecken schien und den es bei jedem Biegen und Dehnen immer tiefer ins Fleisch grub.
»Den Schuberts haben sie inzwischen alle Söhne genommen«, sagte sein Vater.
Heller wusste, dass es fünf Brüder waren. Ob man einen Sohn hatte oder fünf, alle mussten zum Feind, da gab es kein Erbarmen. Man konnte nur hoffen, dass sie nicht alle am selben Ort an die Front kamen. Ganze Schulklassen waren mit einem Schlag ausradiert worden, weil sie alle einer Kompanie angehörten, die von einer Granate getroffen wurde.
»Und Kaluweits wissen nichts von ihren beiden.«
»Lass uns nicht darüber sprechen, Vater«, bat Heller. Er wollte das nicht hören. Was nützte es ihm? Es bereitete ihm nur noch ein größeres schlechtes Gewissen. Und sein Vater sprach nur, weil seine Mutter schwieg und ihm das Schweigen noch unerträglicher war als das Sprechen.
Draußen wurde es dunkel. Der Tag neigte sich dem Ende zu, und damit näherte sich etwas, dessen er noch nicht Herr geworden war. Es lag ihm auf der Seele, seinen Eltern davon zu berichten.
Vater nickte in sich hinein und goss sich noch einen Kognak ins Glas. Mutter begann derweil in der Küche zu hantieren, legte Holzscheite nach, setzte einen Wassertopf auf. Statt das Deckenlicht einzuschalten, zündete sie eine kleine Petroleumlampe an. War das Geld so knapp, dass sie nicht einmal die Lichtrechnung bezahlen konnten?
Heller sah, dass seinem Vater etwas auf der Zunge lag. Seine Lippen bewegten sich, als suche er nach Worten.
»Dein Großvater erzählte oft vom Krieg«, brachte er schließlich heraus.
»Albert!«, mahnte Mutter.
Vater nickte zwar, sprach aber weiter. »Er schwärmte von seinen Erlebnissen.«
»Albert, lass den Jungen doch.«
Heller dachte lange nach und blickte ins niedrig gehaltene Flämmchen des Brenners. Er wollte nicht darüber sprechen. Im Gegenteil. Er wollte das alles vergessen. Begraben. Mit Zement und Asphalt bedecken. Doch er spürte, dass sein Vater etwas brauchte, um sich zu sortieren. Denn die Diskrepanz zwischen dem Hurra-Gebrüll und dem Heldengesang auf der einen Seite und all den Todesanzeigen sowie der Dauer des Krieges auf der anderen war einfach zu groß. Mit dem Feldzug gegen die Franzosen achtzehnsiebzig hatte das nichts zu tun. Das versuchte er wohl zu verstehen.
»Da war nichts, wofür es sich zu schwärmen lohnte«, sagte Heller leise und hoffte, dass sein Vater sich damit begnügen würde. Vom Großvater wusste er nicht viel. So gut wie gar nichts. Und von dem Krieg damals wusste er nur, dass es ein glorreicher Kampf gewesen war, der das Deutsche Reich geeint hatte. Zumindest hatte er das in der Schule gelernt.
»Hast du denn den Feind gesehen?«, fragte sein Vater weiter.
»Albert, lass gut sein!«, mahnte Mutter nachdrücklich.
Heller wusste, dass sein Vater eigentlich etwas anderes wissen wollte. Doch machte es einen Unterschied, ob er einen Feind getötet hatte? Oder zehn oder hundert? Half es ihm, seinen Sohn zu akzeptieren? Brauchte er das für sich oder um es anderen erzählen zu können? Grämte ihn, dass er keinen Orden an der Brust seines Sohnes sah? Dabei sollte er eigentlich wissen, dass man Orden inzwischen mit vollen Händen unter die Soldaten warf. Aber vielleicht juckte es ihn gerade deshalb so sehr, dass sein Sohn nicht wenigstens einen mitgebracht hatte, mit dem man hausieren gehen konnte.
Max Heller spürte, wie Zorn in ihm aufstieg. Doch er sagte sich, dass sein Vater auch nur ein Gefangener war, in den Werten seiner Zeit. So wie er selbst früher, als er sich freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatte. Dass sein Vater nur verstehen wollte, was vor sich ging. Denn was die Zeitungen schrieben, war inzwischen nur noch Geschwätz. Jeder Rückzug wurde in einen Sieg umgemünzt, die Entente stand seit drei Jahren kurz vor einer Niederlage, und jede anderslautende Meldung galt als Feindpropaganda.
Nun hatte er zu lang geschwiegen, und sein Vater begann wieder zu sprechen.
»Hast du …«
»Wirst du aufhören!«, schimpfte seine Mutter erneut.
Doch Max war bereits aufgesprungen, und der Schmerz in seinem Fuß verstärkte seinen Zorn nur noch. »Wär’s dir denn recht?«, donnerte er und schlug mit der flachen Hand so hart auf den Tisch, dass die Flasche und die Gläser sprangen. »Wär’s dir recht, ich hätte einen umgebracht, würdest du dann besser schlafen? Oder wär’s dir lieber, ich wäre gleich im Feld geblieben? Schämst du dich vielleicht für mich?«
Seine Mutter lief zu ihm, hängte sich an seinen Hals, strich ihm über den Kopf, über die Schultern, versuchte ihn auf den Stuhl zu drücken. »Keinen Streit, keinen Streit heute, ich flehe euch an. Es ist ein Freudentag. Ein Freudentag. Du bist wieder da, du lebst. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemand fragt mehr. Und Albert, du stellst die Flasche jetzt weg. Du lässt den Jungen in Ruhe, weiß Gott, was der gesehen hat. Aber es ist vorbei. Es ist jetzt vorbei!«
Doch es war nicht vorbei. Denn es kam zurück. Es kam immer wieder zurück. Wenn er schlafend dalag, der Verstand losgelöst von seinem Körper, losgelöst von allen Ablenkungen. Dann kam es wieder. Dann war er wieder dort, und ein Teil von ihm, vielleicht sogar der größere, würde wohl immer dortbleiben.
Dann begann es wieder zu regnen, stapfte er durch den Schlamm, wollte ins Trockene. Und doch auch nicht, denn er wusste, was geschah, sobald er den Unterstand erreichte. Dann kamen die Einschläge der Geschosse näher. Hämmerten auf seine Trommelfelle, seine Nerven ein. Dann schmeckte die Luft nach Blei und Blut, wurde von Granatsplittern mit grellem Kreischen zerschnitten. Dann kämpften Zuversicht und dunkelste Ahnungen in ihm. Nicht ich, dachte er dann, nicht ich. Und wusste es doch besser, denn es musste irgendwann geschehen. Es musste. Dass er verschont blieb, sprach gegen jede Wahrscheinlichkeit. Dann tauchte er in die stinkende Finsternis des Rattenlochs, in dem sie hockten. Das Schutz versprach und gar keinen bot, weder vor Nässe noch vor Kälte, Krankheit oder Granaten. Dann pfiff es laut, dann zerbarsten Holz und Knochen, zerrissen Stoff und Fleisch. Dann lag er wieder in wilden Schmerzen. Dann stieg der Schlamm.
»Junge«, rief seine Mutter. »Junge, komm doch zu dir, Max. Mein Junge, Max!«
Sie riss und schüttelte an ihm, und im Schein der Lampe erkannte er ihr Gesicht. Seinem Vater sah er an, dass er nun begriffen hatte: Dieser Krieg war nicht wie der seines Großvaters. Er hatte verstanden, dass man nicht Beine und Arme verlieren musste, um ein Krüppel zu sein.
Max wehrte seine Mutter ab, die ihm den Schweiß aus dem Gesicht wischen wollte. »Lass gut sein«, sagte er und hatte immer noch seine Mühe, in die Realität zurückzufinden.
Dann schellte die Türklingel. Man hatte ihn gehört, im ganzen Haus vermutlich. Sein Vater ging zur Tür.
»Was hast du nur gesehen, Junge?«, flüsterte Mutter. »Was ist nur geschehen mit dir?«
»Weck mich immer, wenn du mich hörst«, bat Heller leise.
»Geschieht das oft?«, fragte sie.
Er hatte gehofft, dass es ausbleiben würde, da er nun daheim war. Seit dem Tag, an dem sie die Leiber der Toten und die schweren Balken von ihm genommen und ihn aus dem Schlamm gezerrt hatten, schrie er jede Nacht. Er konnte es nicht abstellen. In der Nacht holten Geist und Körper nach, was begraben unter der tödlichen Last nicht möglich gewesen war. Er schrie sich die Angst aus dem Leib. Im Lazarett hatte man ihm Schlafmittel gegeben, Spritzen verabreicht. Man hatte ihm für die Nacht sogar den Mund zugebunden. Kameraden hatten ihn beschimpft, dass er sie um ihren Schlaf brachte, und Ärzte hatten die Geduld mit ihm verloren.
»Es wird besser«, versprach er. »Ich muss nur wegkommen von dort.«
An der Tür hörte er seinen Vater mit den Hausbewohnern sprechen, die sich beklagten, da sie am nächsten Morgen früh aufstehen mussten. Vaters Stimme brummte, als er versuchte, sie zu beschwichtigen.
Max warf die Decke weg und wollte an seiner Mutter vorbeistampfen. Er würde diesen Leuten vom Krieg erzählen. Sie würden es nicht noch einmal wagen, sich zu beschweren.
Doch seine Mutter hielt ihn auf. »Nicht!«, sagte sie und stemmte beide Hände gegen seine Schultern. »Ihnen ist doch nur der Schreck in die Glieder gefahren.«
»Und Vater? Er muss sich nicht für mich entschuldigen«, knurrte Heller. In ihm brodelte es. Er hörte sich selbst mit den Zähnen knirschen.
»Max, ich flehe dich an. Auch Vater muss es erst verstehen. Er versteht so vieles nicht. Er wäre an deiner Stelle hingegangen. So oft hat er das gesagt. Verstehst du? Er hätte es getan, damit du nicht musst. Fang keinen Streit an mit ihm. Es sind schwere Zeiten. Die muss man zusammen durchstehen.«
Als er am Morgen die Küche betrat, erfüllte ihn ein Gefühl von Scham. Es war still. Niemand sagte etwas. Sein Vater tat geschäftig, rechnete über Zetteln. Es war noch finster wie in der Nacht, das elektrische Licht schalteten sie trotzdem nicht an. Zwei Petroleumlampen brannten.
Mutter stellte Heller eine Tasse hin. »Es ist nur Plempe«, entschuldigte sie sich. Max nickte und setzte sich seinem Vater gegenüber an den großen Tisch. Sah den Mann an. Wie er seinen Kopf niederhielt, ihn sogar noch ein Stück senkte.
»Du hättest noch nicht aufstehen müssen«, meinte Hellers Mutter und stellte ihm einen Teller mit einem Butterbrot hin. Heller schob ihn zu seinem Vater hinüber. Ohne hinzusehen, nahm dieser das Brot und biss ab, während er mit dem Bleistiftstummel weiterschrieb.
»Was ist zu tun?«, fragte Max. Wenn Vater nicht sprechen wollte, ließ er es eben bleiben. Es sollte ihm recht sein. Doch ein kleines Zeichen wäre gut. Ein Blick wenigstens, eine Geste, die ihm half, die Scham zu überwinden. Es hieß immer, sein Großvater wäre ein gefühlloser sturer alter Bock. Doch was war sein Vater dann?
»Viel ist nicht zu tun«, sagte Mutter. »Eh alles knapp.«
Max nickte wieder. Er ließ seinen Vater nicht aus dem Blick, der das zu spüren schien und sich unmerklich noch weiter hinabbeugte, sodass kaum noch eine Faust zwischen Stirn und Tischplatte passte, kaute, schrieb.
»Warum brennt das Licht nicht?«, fragte Heller nun.
»Wir sparen nur. Man muss in diesen Zeiten auf jeden Pfennig sehen.«
»Lampenöl ist nicht billiger. Konntet ihr die Lichtrechnung nicht liquidieren?«
Nun hatte er erreicht, was er wollte. Vater sah auf. »Schalt es an, wenn es dir lieber ist. Wir wollen nur nicht, dass man uns morgens in die Küche sieht«, meinte er leise.
»Ihr lasst die Leute noch anschreiben, oder?«, fragte Heller. Doch er kannte die Antwort bereits. Sie ließen sogar die Herrschaftlichen anschreiben und die Dienstboten der Gasthäuser. Schon immer. Die Angst, keiner könnte mehr bei ihnen einkaufen, war zu groß. Dabei hatten sie es noch nie darauf ankommen lassen. Die Kunden würden nicht ausbleiben, da war er sicher.
Nun war Vater derjenige, der sich genierte. Er versteckte es unter einer Patina aus Groll. »Noch nicht mal einen Tag bist du zurück. Die Zeiten haben sich geändert.«
»Soll ich eintreiben gehen?«
»Nein, Max!«, empörte sich seine Mutter und kam ebenfalls an den Tisch.
»Es ist euer Geld. Kein Geld – keine neuen Waren. Ich kann es für euch holen. Gib mir nur den Zettel mit den Namen.«
»Alle haben Sorgen«, beschwichtigte seine Mutter.
»Aber das sind ihre Sorgen. Nicht unsere. Was kann ich sonst tun?«
»Eis bräuchten wir«, sagte sein Vater.
»Eine Bestellung zum Verkauf oder nur für uns?«
»Für unseren Eisschrank.«
»Und der Eismann liefert nicht mehr?«
»Es ist billiger, wenn man es holt.«
»Haben wir den Handkarren noch?«, fragte Max.
»Im Hof, im Schuppen«, sagte sein Vater.
»Aber Max, dein Fuß …«, mahnte seine Mutter.
»Das muss«, sagte Max. »Es muss ja werden.«
Einen Orden müsste man haben, dachte er, als er in der Morgendämmerung mit dem Handkarren loszog. Das eiserne Kreuz oder ein Verwundetenabzeichen, wie es die Franzosen wohl bekamen. Es hätte ihm vielleicht erspart, dass man ihm hinterherblickte oder ihn unverwandt anstarrte. Denn das taten sie. Vielleicht aber fragten sich die Leute auch nur, woher sie sein Gesicht kannten, versuchten ihn einzuordnen. Er musste sich bemühen, nicht immer gleich das Schlechteste zu denken.
Es war sehr kalt, und sein Atem kondensierte. Er trug seinen alten Mantel und seine Wollmütze.
Noch war der Wagen leicht zu ziehen, denn er hatte sich ausgeruht und etwas gegessen. So konnte er einigermaßen laufen, und war der Fuß erst mal warm und die Sehnen gedehnt, wurde es besser. Die ersten Schritte am Morgen waren jedoch immer die allerschlimmsten. Der Arzt, der ihm gesagt hatte, man müsse ihn bewegen, gebrauchen, auch quälen, in den Schmerz hineingehen, dieser Arzt sollte recht behalten, dachte Heller. Zum Eislager war es nicht allzu weit. Zwanzig Minuten Fußweg. Mit leerem Wagen zumindest, leicht hinab in Richtung der Elbe, vorbei am Winterhafen. Er musste nur auf seine Schritte achten, nicht stolpern oder ausrutschen, keinen unerwarteten Sprung machen.
Ein Auto kam ihm entgegen, blendete ihn mit seinem Licht. So etwas müsste man haben. Fahren durfte er. Das einzig Gute, das ihm die Ausbildung bei der Armee gebracht hatte, war der Fahrschein für Automobile und Laster. Wenn die Leute nicht in den Laden kamen, fuhr man eben zu ihnen hin, dachte Heller. Man könnte Bestellungen aufnehmen und die Leute beliefern, so wie er früher die Herrschaftshäuser beliefert hatte. Mit dem Hundekarren damals freilich nur. Den er jetzt zog. Er hatte selbst noch erlebt, dass man ihre beiden Schnauzer für die Reichswehr konfiszierte. Wie stolz Vater damals noch gewesen war, etwas für den Sieg des Deutschen Reiches beitragen zu können. Wie er sie aus dem Zwinger genommen und ihnen rot-weiß-schwarze Schleifen um den Hals gebunden hatte. Max schüttelte den Kopf, er durfte nicht ungerecht werden. Selbst er war stolz gewesen.
Auf der Elbe waren die Segler schon unterwegs. Ruderkähne setzten über. Vermutlich heimlicher Fährbetrieb, ohne königliche Lizenz. Viele Männer arbeiteten auf der anderen Seite im städtischen Vieh- und Schlachthof oder im König-Albert-Hafen. Schupos waren weit und breit nicht zu sehen. Im Hafen drehten sich schon Flaschenzugkräne. Eine Dampfmaschine wurde angeheizt, der Kesseldruck reguliert, Ventile fauchten und pfiffen.
Nachtfischer kehrten von ihrer Arbeit zurück. Zu müde zum Scherzen oder Fluchen banden sie ihre Boote an, warfen Bastkörbe mit ihrem Fang an Land, wo schon die Burschen der Fischhändler warteten. Gleich würden sie um den Preis zu feilschen beginnen.
Während Heller den Hafen passierte und in Richtung des großen Eiskellers ging, fragte er sich, ob er vielleicht fischen konnte. Ob er mit seinem Fuß auf dem Boot Balance halten konnte wie die Fischer, wenn sie ihre Netze warfen. Oder Reusen stellen. Könnte er womöglich im Fischereibetrieb arbeiten? Wollte er das, Fische putzen, tagein, tagaus? Der Laden rentierte sich nicht für drei. Er musste Geld reinbringen. Der letzte Sold würde schnell aufgebraucht sein.
»Bist du neu hier?«, fragte Ullrich, der Besitzer des Eislagers, als Heller das Tor erreichte.
In Hellers Augen hatte er sich kaum verändert. Stoppeliger Bart, Lederkappe, die Augen vom ewigen Zigarettenrauch verkniffen. Wettergegerbtes Gesicht, die Figur eines Möbelpackers. Eine Zigarette glomm zwischen seinen Lippen. Gerade startete ein Lastwagen, auf dessen Ladefläche sich Eisblöcke türmten.
»Lass ihn nicht zu lang leerlaufen!«, rief Ullrich dem Fahrer zu, doch der winkte nur lachend ab, obwohl es ganz ernst gemeint schien. Dann wandte sich Ullrich an Heller: »Brennstoff wird jeden Tag teurer und rationiert noch dazu. Würden wir nicht an den Hof liefern, wir bekämen wohl kaum noch welchen. Und die blöden Hunde lachen nur. Ich weiß genau, die lassen den Motor laufen, während sie abladen. Und, was willst du?«
»Ich brauch zwei Blöcke, für Heller.«
Ullrich stutzte. »Mensch, Junge, jetzt erst erkenn ich dich. Maxe, biste zurück!« Er klopfte Heller mit seiner Pranke freudig die Schulter. »Habt ihr’s dem Franzmann richtig gezeigt?«
»Ja, und er uns«, entfuhr es Heller. Dabei sollte man mit so etwas vorsichtig sein.
»Recht so«, nickte Ullrich. »Viel Feind, viel Ehr’.« Noch einmal klopfte er Heller auf die Schulter. »Gut, wenigstens einen mal wieder zu sehen. Die ganzen Jungen sind fort. Man sieht nur noch Kinder oder Alte. Du humpelst?«
»Alles noch dran«, sagte Heller nur knapp.
»Gut, Junge. Hör zu, lauf nach hinten zum Lager, da ist Chipka, sag ihm, du bekommst zwei Stangen. Der Eiskeller ist voll vom letzten Winter, und wenn das Eis aus ist, muss seine Majestät sein Bier eben warm trinken.«
»Jawohl, ich dank recht schön!« Heller salutierte, ehe er sich wieder besann. Es steckte einfach zu tief in ihm drin.
»Max!«, rief Ullrich noch mal. »Ich freu mich wirklich!«
Heller nickte erneut, und erfüllt von einer Welle aus warmer Dankbarkeit zog er den Karren zum Lager.
Dort hörte er es rumoren. Das Eislager war wie ein Lagerhaus, das man tief in die Erde gegraben hatte. Mit einem gewölbten Dach, überwachsen mit Gras und Moos, ohne Fenster und einer Schräge nach unten als Zufahrt ähnelte es einer Höhle. Im Inneren sägte der Hilfsarbeiter an den Eisblöcken, schnitt sie handlich für die Eisschrankfächer zu. Nun kam er heraus und wischte sich mit dem Ärmel die Nase. »Nu, Bruder, was kann ich tun?«, fragte er mit seinem böhmischen Zungenschlag. Er wankte beim Laufen. Max wusste, dass ihm einst die Füße abgefroren waren, er lief auf Schuhen, in denen nur noch Beinstümpfe steckten. Doch dafür war er erstaunlich geschickt, hüpfte und balancierte über das Eis.
»Kennst mich doch noch. Der Max bin ich.«
»Maxe, Mensch, groß biste geword’n, hamse dir auch in Krijg jeschickt?«, fragte Chipka im besten Kuchldeutsch.
»Ja, ich war da. Ullrich meint, du gibst mir zwei Blöcke.«
»Was der Ullrich saacht, wird jemacht. Bist ja kein Lügner nich, wie ich dir in Erinnerung hab. Komm nu glei mit die Wagen rinn.« Er drehte sich um und tauchte ins Finstere hinab. Heller folgte ihm die Schräge hinunter, wollte ihm nach, durch den mannshohen Eingang. Doch in dem Augenblick, als er durch die Türpfosten trat, presste ihm eine riesige Zange das Herz zusammen, quetschte alle Luft aus seinen Lungen, und im Dunkeln begann sich etwas zu bewegen, wollten Tentakel und kalte Hände nach ihm greifen, schoben sich die Wände heran. Heller taumelte nach hinten, stolperte über die Deichsel des Handwagens, fiel rückwärts.
»Was ist, bist du jerutscht?«, lachte Chipka irgendwo da drinnen, doch seine Stimme klang wie die eines Ungeheuers, hallend, keifend, grunzend. Heller schnappte nach Luft. Jeden Moment würde eine Klaue hinauslangen und ihn in die Höhle zerren.
Er kroch rückwärts weg vom Loch. Die finstere Öffnung schien ihn anzuziehen wie ein Sog. Als der Hilfsarbeiter ins Freie trat, um ihm die Hand zu reichen, wich er aus, als wäre es ein Dämon aus der Hölle.
»Hast du keine Angst vor mir, bin ich nur der alte Chipka, kann nicht läsen und nicht schreiben, hab dir noch nie nichts getan.«
»Ich hab keine Angst«, murmelte Heller und stand ohne Hilfe wieder auf. Doch er keuchte, und kalter Schweiß klebte auf seiner Stirn. Das hatte er noch nicht erlebt, das war ganz neu für ihn.
»Hast du nicht, ich weiß schon. Niemand hat Angst. Ich mach Licht drin, ja, hab verjessen, Chipka läuft da blind herum, du brauchst was zu gucken für de Äuglein.«
Der Mann kehrte um, wandte sich nach rechts, und ein elektrisches Licht ging an. Nun sah Heller endlich etwas, sah den großen niedrigen Raum, größer als eine Turnhalle, Bogengewölbe, gemauerte Stützen, dazwischen das Eis, im Winter aus der Elbe und dem Hafen gesägt.
Er nahm die Deichsel wieder auf und trat erneut an die Tür heran. Nun sah er, dass sechs Glühbirnen an den Wänden leuchteten. Chipka stand drinnen, winkte ihn freundlich zu sich, doch es war Heller noch immer ganz und gar unmöglich, nur einen Schritt hinein zu machen. Er wusste, augenblicklich würde das Licht erlöschen, würden die Wände zusammenrücken, das Dach sich senken, bis er eingezwängt war, unfähig, sich zu bewegen und zu atmen.
»Nu was, mein Junge, möchtest, dass ich ganze Arbeit allein mach?«
»Ich kann nicht, Chipka«, keuchte Heller und war entsetzt, diese Seite an sich zu entdecken. Es hatte ihm früher nichts ausgemacht, in einen Keller zu steigen. Doch schon bei dem Gedanken, diesen Eiskeller zu betreten, wurde ihm speiübel und er schnappte nach Luft. Er taumelte zur Seite, musste sich auf die steinerne Brüstung setzen.
Chipka kam ein weiteres Mal zurück. »Was ist, Junge?«, fragte er. »Is dir nicht jut? Willst eine rauchen? Ich dreh dir eine, hab noch Tabak und Papierchen.«
»Nein, Chipka, lass gut sein.«
»Junge sag, warste verschitt jewesen?« Er wackelte um Heller herum, setzte sich neben ihn. »Freund von mir, weeßte, war Berchmann, im Silber, der war verschitt jegangen, wie die Decke vom Stollen runterkam. Und wie sie den rausgeholt ham, nach paar Stunden, da wollte der nicht mehr ohne Licht sein, und in der Berch konnter nimmer gehen. Der war wie verrickt in de Birne. Keine Tir konntst mehr schließen, hat der jleich jeschrien. Und du, mein Junge? Biste auch verrickt in Kopp? Kannste nimmer da rein gehen?«
Der Gedanke war ihm noch nicht gekommen. Er hatte noch keine Gelegenheit gehabt, es herauszufinden, war noch nicht in Verlegenheit geraten, in einen Keller zu müssen. Doch was, wenn ihn Mutter demnächst nach unten schickte, um Kohlen zu holen?
»Komm, Chipka, lass uns reingehen.« Er stand auf, zumal ihm der Hintern sowieso kalt geworden war.
»Gut, Junge, gehst mir nach, bekommen wir hin!«
Der Hilfsarbeiter stellte sich auf, bückte sich nach der Deichsel des Wagens, betrat den Eiskeller. Heller folgte ihm, doch es gelang ihm nur, durch die Tür zu treten. Nicht einen Schritt weiter konnte er gehen. Heller streckte die Hände aus, suchte die Wand, den Türpfosten, trat wieder ins Freie, schnappte nach Luft, keuchte, und ihm war übel.
Chipka sagte nichts mehr. Er tat drinnen seine Arbeit, erschien wieder, den Wagen hinter sich. »Is jut, Junge, hier!« Er reichte Heller die Deichsel. »Wird wieder, wird schon. Denk nur, wie gut du bist davonjekommen. Hab Leite gesehen, die wo kein Gesicht mehr hatten und keine Beine. Ruhe brauchste, was anderes zum Drandenken, ein hibsches Fräulein vielleicht.«
Heller nickte nur, unfähig, Dank auszusprechen. Mühsam zog er den Karren die Schräge hinauf, tat so, als sähe er die Leute nicht, die ihm entgegenkamen, wich einem Laster aus, der zurückstieß.
Bei Herrn Ullrich am Tor blieb er stehen. »Was bekommen Sie? Eine Mark?«
»Lass stecken, Junge. Deine Eltern krebsen doch auch nur rum.«
»Nein, wirklich, das ist nicht nötig!«
»Max, mach mich jetzt nicht unglücklich. Ich geb’s gern.« Ob er etwas von dem Vorfall mitbekommen hatte, ließ er sich nicht anmerken.
»Dann dank ich schön!«
»Lass dich mal sehen, vielleicht hab ich Arbeit für dich. Es gibt immer mal was zu transportieren oder zu tragen, wenn du kannst. Und im Winter, wenn es friert, könntest du Eis sägen kommen. Ich sag’s nur, wenn mal Not am Manne ist.«
»Gut, ich werde dran denken. Schönen Tag erst mal noch.«
Heller griff sich an die Mütze und machte sich auf den Heimweg, wobei er den Schmerz in seinem rechten Fuß solange es ging ignorierte. Doch die letzten Meter wurden eine furchtbare Qual, und nur weil er zu stolz war, vor aller Augen in Tränen auszubrechen oder auch nur eine Pause zu machen, hielt er sie aus.
Daheim verfrachtete er das Eis in den Kühlschrank. Ein Stück schlug er sich ab und kühlte damit seinen rot glühenden Knöchel. Er schloss die Augen und genoss es, wie der Schmerz nachließ. Dann ging er den Gehweg fegen und half Vater ungefragt, die Auslage vor dem Laden anzurichten. Als der Milchmann mit seinem Pferdekarren kam, nahm er ihm die Kannen ab und trug sie ins Haus. Doch dann war nichts weiter zu tun, und er kam auf den Gedanken, einmal sein Viertel abzuklappern, ob sich nicht der eine oder andere fand, den er aus seinem Jahrgang kannte. Armin vor allem, sein bester Freund, den er gleich nach Kriegsbeginn aus den Augen verloren hatte. Er zog sich seine Uniform an, damit man ihn auf der Straße nicht schräg ansah, was sicher passieren würde, wenn er als Mann seines Alters in Zivil unterwegs war.
Mit Armin war er durch dick und dünn gegangen. Sie gingen so vertraut miteinander um, dass man sie oft genug für Brüder gehalten hatte. Seit Heller sich erinnern konnte, wuchs sein Freund ohne Vater auf. Als sie zur Schule gekommen waren, hatte Heller ihn einmal gefragt, was mit seinem Vater wäre. Er wüsste es nicht, lautete die Antwort, und damit war das Thema ein für alle Mal beendet. Nur wenn jemand anders der Meinung war, er könnte Armin deshalb verspotten, dann hatte dieser Jemand lernen müssen, dass ihn nicht nur Armins Fäuste und Flüche trafen, sondern auch die von Max Heller. Nicht selten hatten die beiden dafür nachgesessen oder sogar Stockhiebe bekommen. Doch gelohnt hatte es sich allemal, denn es wagte bald niemand mehr, dem vaterlosen Jungen unverschämt zu kommen.
»Ich versuche mich mal bei der Soldstelle«, rief er seinen Eltern zu. Damit sie ihm nicht ausredeten, was er vorhatte.
Zuerst ging er zu Frau Richter, Armins Mutter. Sie erkannte ihn im ersten Moment ebenso wenig wie seine eigene Mutter. Als sie endlich begriff, wer vor ihr stand, stieß sie einen kurzen Freudenschrei aus und bat ihn in die Wohnung. Dann brachen alle zurückgehaltenen Ängste um ihren Sohn aus ihr heraus. Armin hatte ihr zuletzt vor einem halben Jahr geschrieben, seitdem hatte sie nichts mehr von ihm gehört. An der Schlacht an der Somme sollte er teilgenommen haben, zumindest war das seine letzte bekannte Adresse im Feld gewesen, und man hörte nichts Gutes über diese Schlacht, flüsterte sie und sah ihn fast flehend an, als ob er ihr über Armins Verbleib irgendetwas anderes berichten könnte.
Sie gab ihm einen Schnaps und briet ein paar Kartoffeln, die vom Abendessen übrig waren. Viel mehr gab es auch nicht. Kaum Zwiebeln, keinen Speck, und Heller genierte sich fast, der Frau die letzten Reste wegzuessen.
»Nun schau nicht so, ich verhungere nicht«, mahnte sie. »Es macht mir einfach Freude, dich so zu sehen. Wenn ich auch zugebe, tausendmal lieber sähe ich meinen Sohn da sitzen. Aber es macht mir Hoffnung, dass noch Wunder geschehen.«
»Ich versteh schon, Frau Richter.« Heller aß und verkniff sich, das zu sagen, was ihm auf der Zunge lag. Er wird schon heimkehren, könnte er sie trösten. Viele andere kamen heim, könnte er ihr sagen. Doch all das waren nur leere Worte. Er hatte Leute getroffen, die von der Somme kamen, und die ihm berichteten, was dort passierte. Hunderttausende sollen dort umgekommen sein. Ein Schlachthaus, in dem ohne Sinn und Verstand die Leben junger Männer vernichtet wurden. Wie absurd es war, dass so viele zum Ruhme eine Nation sterben mussten. Noch vor drei Jahren war ihm das logisch erschienen. Doch ginge es jetzt nach ihm, dann sollten alle Kriege enden, egal wer die Gewinner und die Verlierer waren. Denn weder Freude am Sieg noch Scham wegen einer Niederlage brachte die Toten zurück.
Schließlich zog er weiter, besuchte Haus um Haus, Straße um Straße lief er ab, bis ihm kein Name mehr einfiel, nach dem er noch fragen könnte. Er fand niemanden. Alle waren sie im Krieg, kaum einer hatte im letzten Jahr Urlaub bekommen, viele von ihnen waren schon gefallen, einige wurden vermisst, wieder andere lagen in Hospitälern, wo man versuchte, aus den zuckenden Überresten ihrer Körper und ihres Geistes etwas zusammenzuflicken, das man den Angehörigen zurückgeben konnte.
Und er war hier, humpelnd, mit kaum erträglichen Schmerzen bei jedem Schritt. Doch die sah man nicht, weil er die Zähne zusammenbiss. So lief er in seiner verwaschenen Uniform als König der Invaliden durch die Straßen, denn er hatte sein Augenlicht noch, konnte noch hören, konnte laufen, hüpfte und zappelte nicht, wie viele, die er im Lazarett gesehen hatte, die ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle hatten, unter dem Granatschock litten. Kriegszitterer, Schüttelneurotiker, nannten die Ärzte sie. Er jedoch hatte seinen Geist, hatte seinen Körper unter Kontrolle, wenigstens am Tage. Doch er erntete finstere Blicke dafür. Er spürte die Scham seines Vaters, der eigentlich stolz sein sollte. Oder wenigstens froh, dass er noch lebte, denn um stolz zu sein, brauchte es Orden und Auszeichnungen. Da genügte es nicht, dass sein Sohn in einem verjauchten Graben gehockt hatte, auf den Befehl zum Angriff wartete und andere junge Männer umbrachte, die auch nur nach Hause wollten.