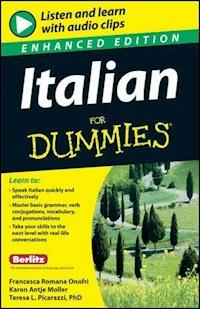Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Studien Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Praxisnahe Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Schulalltag einer Volksschul-Integrationsklasse gibt Susanna Bews in diesem Buch weiter, fundierte Informationen, wie die neuen Aufgaben gemeinsam bewältigt werden können. Ihr positives Resümee: Die individuellen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten aller Beteiligten werden herausgefordert - Lernen mit hohem persönlichen und sozialen Nutzen kann erfolgreich stattfinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanna BewsIntegrativer Unterricht in der Praxis
Impulse: Arbeiten aus dem Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck
Neue Folge Band 2herausgegeben vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck
Susanna Bews
Integrativer Unterricht in der Praxis
Erfahrungen – Probleme – Analysen
StudienVerlag Innsbruck-Wien
2., aktualisierte Auflage
© 1996 by StudienVerlag, Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
www.studienverlag.at
Die Deutsche Bibliothek- CIP-Einheitsaufnahme
Bews, Susanna: Integrativer Unterricht in der Praxis: Erfahrungen, Probleme, Analysen / Susanna Bews.-
Innsbruck ; Wien: StudienVerlag, 1996
ISBN 978-3-7065-5819-8
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.studienverlag.at.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Dr. Volker Schönwiese
Vorwort zur zweiten Auflage
Einleitung
1 Vorbereitungsphase
Persönliche Vorbereitung
Vorbereitung auf die Kinder und die Eltern
2 Schuleingangsphase
Meine Geschichte mit Elvira –Der Versuch, am Mißerfolg zu wachsen
3 Stabilisierungsphase
Entwicklungsphasen unserer Teamarbeit
Die “Warming-up-Phase”
Aufarbeiten eingeschliffener Mechanismen
Flucht nach vorne – Flucht nach hinten – Der Mittelweg
Vertrauensbildung
Resignation und Mißerfolg
Aufhebung von Widersprüchen –Gemeinsamer Weg – Gemeinsames Lernen
4 Die Ausbildung als bestimmendes Merkmal der Arbeit in der Integrationsklasse
Grundsätzliche Überlegungen zur LehrerInnenbildung
Folgen getrennter Ausbildungslehrgänge
Konsequenzen für eine Ausbildung, die zurintegrativen Arbeit befähigen soll
Vom Lernen
Alexej Leontjew
Paulo Freire
Celestin Freinet
Maria Montessori
Beziehungen im Schulalltag – Der Dialog
Zusammenfassung und Schlußbemerkungen
5 Integration als gemeinsames Lernen und Leben
Zur Methode in der Integrationsklasse
Projektunterricht
Offenes Lernen
Freie Arbeitsphase
Entwicklungsschritteaufgrund integrativer Didaktik
Martin
Nina
Katharina
Einzelförderung
Therapie – Einzelförderung oder Teil desintegrativen Unterrichts?
Resümee
6 Fortsetzung des Schulversuchs im Mittelstufenbereich
7 Rahmenbedingungen und daraus folgende Konsequenzen für den Schulversuch
Organisation der “Integrativen Klasse”
Dauer des Schulversuchs
Probleme für ein Schulteam
Klassenschülerzahl und Zweilehrer-System
Seiteneinsteiger
Unterrepräsentanz von Kindernausländischer MitbürgerInnen
Anmeldung behinderter Kinder
Supplierung
Mehrbelastung für das LehrerInnenteam
8 Ausblick auf Verbesserungen
Eine LehrerInneninitiative entsteht
Arbeit der Aktionsgemeinschaft derIntegrationslehrerInnen – Wien
9 LehrerInnen forschen – Zur Methode
10 Schlußbemerkungen
Anhang
Anhang zur zweiten Auflage
Literaturverzeichnis
Vorwort
Fördern ohne auszusondern
Schulreform in Österreich ist im Zeichen der Bildungspartnerschaft ein schweres Unterfangen. Zentrale Merkmale der österreichischen Schulreform sind, bei starker parteipolitischer Fixierung, die Entstehung von Entscheidungsmonopolen, sowie Kompromiß und Stagnation1. Echte Bürgerbeteiligung und entsprechender Reformwille sind in der österreichischen Schulentwicklung-sgeschichte nicht bekannt.
Umso erstaunlicher ist es, daß in den letzten Jahren von der Öffentlichkeit relativ unbeachtet eine bedeutsame Schulreform durch die Entwicklung von Formen des gemeinsamen Unterrichts von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Gang gekommen ist. Initiativen von Eltern behinderter Kinder - quer zu allen politischen Parteien - haben es gemeinsam mit engagierten LehrerInnen und Expertinnen geschafft, eine Reform von unten einzuleiten2, deren Auswirkungen auf die gesamte Schule noch nicht vorherzusehen sind.
Der neu eingeforderte Bildungsauftrag der Schule kann in diesem Zusammenhang so definiert werden: Fördern ohne auszusondern, wobei davon auszugehen ist, daß die Integration (Nichtaussonderung) pädagogisch für die Entwicklung aller Kinder - ob behindert oder nichtbehindert - förderlich ist, indem die individuellen sozialen und kognitiven Fähigkeiten und Möglichkeiten aller Kinder ohne sozialen Ausschluß in den Mittelpunkt gestellt werden müssen.
Historisch ist die Entwicklung der Sonderschulen nicht von der Förderung behinderter Kinder ausgegangen, sondern von den katastrophalen Zuständen in der allgemeinen Schule (z.B. mit bis zu 100 Kindern in einer Klasse), die jede gemeinsame Entwicklung unmöglich machte3. Die folgende bürgerlich philantropische aber auch sozialdemokratische Vorstellung der speziellen Heilung, Therapie und Pädagogik für behinderte Kinder (z.B. bei Glöckel), kippte allerdings zunehmend in institutionalisierte Überwachung des “Andersartigen” und in gesellschaftliche Abwehr von Behinderung um4.
Eltern von behinderten Kindern waren hingegen immer schon gegen Aussonderung. Daß sie sich nun politisch organisieren und auch LehrerInnen darin Chancen für eine Schulreform sehen, die ihren Schulalltag entscheidend verändern kann, ist neu. Sicher hat dazu beigetragen, daß sich in den letzten Jahren die Möglichkeiten von sozialen Bürgerbewegungen auch bei uns verbessert haben und daß eine größere Sensibilität, bezogen auf die Einlösung von deklarierten Grundrechten bzw. Menschenrechten, entstanden ist.
Bei den neuen Bestrebungen nach Integration handelt es sich hier allerdings nicht um isolierte österreichische Versuche. Im Gegenteil: Österreich ist - bezogen auf den internationalen Stand der Integration von behinderten Menschen - ein “Entwicklungsland” (vgl. z.B. die Integrationsgesetze folgender Staaten: USA, Kanada, Norwegen, Dänemark, Schweden, England, Spanien, Italien). Dennoch wurden in Österreich in den letzten Jahren sowohl in Kindergärten als auch in Schulen weitgehende Erfahrungen mit der Integration gesammelt. Diese Erfahrungen sind überaus positiv und zugleich zutiefst widersprüchlich, wobei es für die zukünftige Entwicklung entscheidend sein wird, ob die notwendigen strukturellen Voraussetzungen für die Nichtaussonderung geschaffen werden.
Das vorliegende Buch gibt einen ausgezeichneten Einblick in den Schulalltag einer integrativen Klasse und bietet gleichzeitig eine wichtige Analyse, wie Integration in Zukunft besser unterstützt werden kann, damit die Integration in Österreich nicht ein einsames Pflänzchen im Irrgarten österreichischer Schulreform bleibt.
Volker Schönwiese
Vorwort zur 2. Auflage
Es ist sehr erfreulich, daß dieses Buch in die zweite Auflage geht und inzwischen so etwas wie ein Standard-Werk zum integrativen Unterricht geworden ist. Der Bedarf nach praxisnaher Dokumentation und Analyse der schulischen Integration ist offensichtlich groß.
In Ergänzung zum ersten Vorwort kann noch angemerkt werden, daß sich schulpolitisch Versuche der Spaltung ohne Reform abzeichnen. Einerseits wird Integration geduldet (15. SCHOG-Novelle, Versprechen der Übernahme der Integration in die Sekundarstufe), andererseits versucht die Sonderschulen auszubauen sowie mehr und neue äußere Differenzierung einzuführen (Einführung von Eliteschulen, Versuche der Veränderung der Lehrpläne von Hauptschule und AHS-Unterstufe, der Ruf nach Privatisierung).
Es ist zu befürchten, daß die “Selektionsfunktion” von Schule durch immer mehr äußere Differenzierung verstärkt wird und Integrationsklassen zum Angebotsteil eines sich weiter spaltenden Schulsystems wird. Deregulierung (statt Erstarrung), und damit Abschied von gemeinsam begründeter Politik, ist nicht umsonst das wichtigste Schlagwort der letzten Jahre. Das schon genannte Ziel von Integration, erstmals in der Schulgeschichte wirklich eine gemeinsame Schule für alle zu schaffen, wird so unterlaufen und in sein Gegenteil verkehrt.
In diesem Zusammenhang ist es ein lokales österreichisches Phänomen der erstarrten Bildungspartnerschaft, daß ein gemeinsamer Unterrichts der 10-15jährigen z.B. in Form der integrierten Gesamtschule hierzulande als sozialistisches Schreckgespenst gehandhabt wird, obwohl in nahezu allen “entwickelten” Industriestaaten (mit der Ausnahme des deutschsprachigen Raumes und Japan) die integrierte Gesamtschule schon seit Jahrzehnten umgesetzt ist (allerdings ohne daß behinderte Kinder damit auch schon integriert wurden).
Es muß immer wieder betont werden: Integration ist keinesfalls irgend eine humanitär/karitative Idee. Die Forderung nach Integration und damit nach innerer Differenzierung (“Individualisierung und Kooperation am gemeinsamen Gegenstand” - bitte keinesfalls mit den sog. Koop-Klassen verwechseln!5) ergibt sich als klare Konsequenz, wenn Bildung wissenschaftlich begründet und nach unseren besten Kenntnissen umgesetzt werden soll.
Hoffentlich bleibt die Chance im österreichischen Bildungssystem, Integration und neue Qualität einzuführen, weiter bestehen.
Frühjahr 1996
Volker Schönwiese
Anmerkungen
1 vgl. DERMUTZ, Susanne: Der österreichische Weg - Schulreform und Bildungspolitik in der Zweiten Republik. Verlag für Gesellschaftskritik, Wien 1983, Seite 54 ff.
2 vgl. FORCHER Heinz/SCHÖNWIESE Volker: Zur Geschichte der schulischen Integration in Österreich. In: MEISTER, Birgit/SCHÖNWIESE, Volker/THALER, Klaus/WIESER, Ilsedore (Hrsg.): BLINDER FLECK UND ROSAROTE BRILLE. Behinderung und Integration als Herausforderung für Familie, Kindergarten und Schule. Österreichischer Kulturverlag, Thaur 1989, Seite 91-105.
3 vgl. ALTSTAEDT Ingeborg: Die Entwicklung der Sonderschule als Teil des niederen Schulwesens. In: DEPPE-WOLFINGER, Helga (Hg.): Behindert und abgeschoben. Zum Verhältnis von Behinderung undGesellschaft. Beltz Verlag, Weinheim 1983, Seite 131-144.
4 vgl. GSTETTNER, Peter: Die nicht stattgefundene “Begegnung” oder: Zur fortgesetzten Abwertung von Abweichenden. In: FORSTER,Rudolf/SCHÖNWIESE, Volker (Hg.): Behindertenalltag - wie man behindert wird. Verlag Jugend und Volk, Wien 1982, Seite 131-152.
5 FEUSER, Georg: Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995, Seite 168 ff
Einleitung
Den Schulversuch Integration gibt es in Wien seit Herbst 1986. Nichtbehinderte und behinderte Kinder lernen und leben miteinander und werden auf ihre Zukunft vorbereitet.
Es war sicher kein Zufall, daß ich als Lehrerin mit diesem Schulversuch noch vor seiner Installierung bekannt wurde. Meine eigene Sozialisation wurde geprägt durch Achtung vor allen Menschen und von der Solidarität gegenüber Minderheiten. Meine Eltern, die als Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden, lehrten mich Toleranz gegenüber Menschen, die “anders” sind.
Die Integrationsbewegung wurde aufgrund der Forderungen und des Durchhaltevermögens einiger engagierter Elterngruppen möglich gemacht. Betroffene Eltern haben großen Anteil daran, daß in Wien die erste Integrationsklasse eröffnet werden konnte. “Die Integrationsbewegung hat an der Basis eine solidarische Kraft entwickelt. Dadurch ist sie nicht mehr so leicht zu stoppen und kann darüber hinaus ein Potential im täglichen Kampf gegen die Ausgrenzungs- und Isolationstendenzen der Gesellschaft bilden. Dieses Widerstandspotential wird umso wichtiger, je härter die Gesellschaft gegenüber allen Abweichenden, Außenseitern, ‘Minderleistern’, Alten, Kranken, Fremden und ‘Nicht-Normalen’ mit dem Stempel der Randgruppen-Stigmatisierung reagiert.” (GSTETTNER 1990, S. 9)
Für mich ist die Auseinandersetzung mit Fragen der Integration vor allem mit einer Demokratisierung unserer Schulen verbunden, die auf einem humanen Menschenbild basieren sollte, wo Platz ist für alle Kinder, wo das gemeinsame Lernen nicht als Gnadenakt oder Zugeständnis an einige engagierte “Utopisten” gesehen wird, sondern als selbstverständliches Recht.
1
Vorbereitungsphase
Ich war bereits zwei Jahre an dieser Volksschule, als ich im April 1986 davon in Kenntnis gesetzt wurde, daß ein Versuch zur Integration behinderter Kinder in das Regelschulwesen gestartet werden sollte. Eine sehr engagierte Kollegin unseres Lehrkörpers sollte mit dem Pilotversuch in Wien beginnen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß an unserer Schule der Anteil ausländischer MitschülerInnen sehr hoch ist, es für uns also immer schon Berührungspunkte zur Auseinandersetzung mit Benachteiligungen von Minderheiten in unserem Schulsystem gegeben hat und wir dadurch mit Vorurteilen gegenüber Minderheiten bereits konfrontiert waren. Auch deshalb wollten wir uns und die Eltern unserer Schule mit dem Schulversuch auseinandersetzen, zumindest sollte er bekannt gemacht werden.
Um uns alle mit der Thematik von Behinderung in unserer Gesellschaft im allgemeinen und der möglichen Integration geistig behinderter Kinder vertraut zu machen, starteten wir eine Projektwoche an unserer Schule, ich knüpfte Kontakte zu Institutionen, die sich mit Behinderung befaßten, und wollte solche selbst kennenlernen. Bei meinen ersten Hospitationsbesuchen in Sonderanstalten entdeckte ich auf einmal Ängste und unbekannte Emotionen, die ich mir zuerst nicht erklären konnte. Vor allem interessierte mich immer mehr die Frage: “Wo sind denn die behinderten Menschen in unserem Alltag?” Ich war vorher in meinem Leben nur peripher mit Behinderten konfrontiert worden, im Straßenbild fallen sie nicht auf, und wenn man auf einen Behinderten trifft, schaut man verlegen und mitleidig weg und weiß nicht recht, wie man sich verhalten soll. Andererseits sah ich nun in Heimen und Sonderschulen eine so große Anzahl geistig behinderter Kinder, daß ich mich immer stärker fragen mußte: “Warum steckt man sie einfach weg, sondert sie aus der ‘normalen’ Gesellschaft aus? Gefährden sie gar unser Bild einer gesunden Gesellschaft?” Nach außen hin wird diese Absonderung immer als besondere Betreuung angepriesen, in speziellen Institutionen für Behinderte könnten diese Menschen fürsorglich und besser betreut werden. Nach meinen Besuchen in solchen Anstalten kam diese meine Einstellung zu den Sondereinrichtungen sehr ins Wanken (siehe BEWS 1989, S. 21). Der Gedanke: “Integration setzt dort ein, wo zuerst ausgesondert wurde” gewann immer mehr an Bedeutung. Dabei wurde mir immer klarer, daß sich Überlegungen im Zusammenhang mit der Integration auf alle Gruppen, die derzeit aus unserem vielgegliederten Schulsystem ausgesondert werden, umlegen lassen.
Während der Projektwoche, an der sich alle Klassen unserer Schule beteiligten, versuchten wir Erstkontakte mit Klassen von Sonderschulen in kooperierender Form zu knüpfen, gemeinsame Ausflüge, Spiel-, Musik- und Werkstunden zu gestalten, da wir der Meinung waren, daß sich Ängste und Vorurteile gegenüber Behinderten vor allem im persönlichen, intensiven Kontakt abbauen lassen. “Aus der Vorurteilsforschung ist z.B. bekannt, daß häufige oberflächliche und zufällige Kontakte gar nichts an Vorurteilen ändern, sondern sie eher verstärken.” (CLOERKES 1982, S. 565) Für die Eltern organisierten wir einen Film- und Diskussionsabend, der über Probleme behinderter Kinder Auskunft gab und eine Diskussion mit Hilfe einer betroffenen Mutter in Gang bringen sollte. Das alles war nur ein Tropfen auf den heißen Stein, jedoch sicherlich eine Möglichkeit, daß sich alle Menschen in unserem Schulhaus und die Eltern, deren Kinder bei uns zur Schule gehen, mit den Problemfeldern ansatzweise auseinandersetzen konnten und niemand im neuen Schuljahr gänzlich unvorbereitet mit behinderten Kindern zusammentreffen würde.
Während dieser Zeit stellte ich fest, wie groß die Chancen waren, mit so einem Schulversuch innovative Arbeit für die Unterrichtsarbeit insgesamt zu leisten. Unterrichten nach verschiedenen Lehrplänen, kein Druck mehr, alle Kinder über “einen Kamm scheren zu müssen”. Die Möglichkeit, aus der Situation der Einzelkämpferin in der Schulklasse herauszutreten, mit einer Kollegin über Probleme sprechen zu können (damals wußte ich noch nicht, wie sehr die Kooperation aller Beteiligten einen Kernpunkt der Integrationspädagogik darstellt), all dies sah ich als neue Denkanstöße, an meiner eigenen Unterrichtsarbeit Veränderungen vornehmen zu können.
Persönliche Vorbereitung
Im April 1987 erfuhr ich, daß ich im kommenden Schuljahr die nächste erste Klasse an unserer Schule, die integrativ - im Sinne einer gemeinsamen Beschulung nichtbehinderter und behinderter Kinder - geführt werden sollte, übernehmen dürfe. Ich besuchte daraufhin verschiedenste Sondereinrichtungen und vor allem die Sonderschule, von der wir die Kinder zugewiesen bekommen würden. Dies war mein erster bewußter Kontakt mit geistig behinderten Kindern, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Ich war geschockt über meine eigenen zwiespältigen Gefühle, einerseits wollte ich meinen theoretischpädagogischen Ansatz einer Schule für alle Kinder verwirklichen, andererseits wußte ich selbst noch nicht, wie ich mit Behinderung umgehen sollte, zumal ich die Atmosphäre in den Sonderschulen, die ich primär als “Aufbewahrungsanstalt” erlebte, erst verdauen mußte. (Manchmal hatte ich das Gefühl, ich könne dieses Haus nie wieder betreten.)
Zu diesem Zeitpunkt kannte ich schon die Kollegin, mit der die kommende Integrationsklasse geführt werden sollte. Wir trafen uns öfter, ich lud sie zu mir ein, um einen Gedankenaustausch zu forcieren. Als ich meine Betroffenheit und Ängste über meine Erlebnisse und Eindrücke in den Sonderschulen für Schwerstbehinderte äußerte, wurde ich heftigst kritisiert. Das als Entschuldigung für die Berechtigung der derzeitigen Zustände der Sonderschule gebrachte Argument: “Es wird aber immer Kinder geben, die man nicht im Regelschulwesen halten kann, und für die braucht man dann die Sondereinrichtung” stieß bei mir auf heftigen innerlichen Widerstand. Ich konnte diese Aussage emotional nicht annehmen, zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht rational argumentieren. Das veranlaßte mich auch, mich mit der vielschichtigen Problematik über Behinderung und der sogenannten “Integrationsfähigkeit” noch intensiver auseinanderzusetzen. Ich wollte es nicht gelten lassen, daß die behinderten Kinder, die ab nun in die Regelschule gehen würden, ausgesucht sein könnten. Sicher beginnt man sich tiefergreifend mit dem Sinn einer Sache dann auseinanderzusetzen, wenn einem Begrenztes und Negatives widerfährt. Inzwischen weiß ich, daß die Frage: “Wer kann integriert werden bzw. wer nicht?” an sich unzulässig ist. Damit wird womöglich impliziert, daß nur Kinder mit Behinderungsformen oder einem Grad der Behinderung aufgenommen werden können, die einem herkömmlichen, “normalen” Unterricht zu folgen imstande sind, die also anpassungsfähig genug sind, keine Veränderung des Unterrichts inhaltlicher und organisatorischer Art nötig zu machen. Damit wird eine Schuldzuweisung von “Integrationsfähigkeit” auf das betreffende Kind veranlaßt, anstatt die Möglichkeiten und Grenzen im derzeitigen Schulsystem zu suchen. Eine Veränderung der Bedingungen, die eine Schule für alle Kinder ermöglicht, kann aber nur stattfinden, wenn sie auch als konkrete Schwierigkeiten einzelner Personen in bestimmten Situationen und der Institutionen, in die sie eingebettet sind, gesehen werden. Hinz meint zu den Zweifeln über diese Frage: “..., daß die Kategorie ‘Integrationsfähigkeit’ keinen positiven Beitrag um integrative Beschulung zu leisten vermag.” (HINZ 1990, S. 134) Die Auseinandersetzung mit diesen immer wieder auftretenden Argumenten lehrte mich zu erkennen, wie oft ich die “falschen Fragen” stellte, und machte mich sensibel dafür, daß Integration nicht mit verdeckter oder beschönter Form von Aussonderung beginnen dürfe oder gar eine Schaffung von zwei Klassen von Behinderten, nämlich integrierbare und nicht integrierbare, zur Folge haben dürfe. Akzeptiert man die gemeinsame Beschulung aller Kinder als menschliches Grundprinzip, werden alle theoretischen Begründungen überflüssig. “Es sind unsere grenzen, wenn wir es nicht schaffen, uns das gemeinsame leben und lernen mit einem schwer behinderten kind vorzustellen, wenn wir die notwendigen organisatorischen bedingungen nicht herstellen können, um ein schwer behindertes kind täglich in die schule zu transportieren, zu windeln, zu füttern.” (SCHÖLER 1987, S. 241)
Vorbereitung auf die Kinder und die Eltern
Nach den ersten Versuchen, unsere beiden Standorte zu bestimmen, versuchten wir Lehrerinnen, Informationen über die Kinder, mit denen wir arbeiten sollten, einzuholen. Ich wußte nun, daß die Klasse aus 15 deklarierten Volksschulkindern und drei schwerstbehinderten Kindern bestehen würde. Zusätzlich wurden wir gebeten, ein Kind aufzunehmen, von dem bekannt war, daß es bereits zweimal aus der Volksschulklasse zurückgestellt worden war, das jedoch nicht als “geistig schwerstbehindertes Kind” einzustufen war, zumal sich die Eltern geweigert haben, das Kind in eine Sonderschule zu geben. Anfangs war ich sehr unsicher darüber, wie ich mit dieser Tatsache umgehen sollte, einerseits wollte ich nicht, daß die Zahl der aufzunehmenden Kinder überschritten würde (zu diesem Zeitpunkt war die Richtlinie: 15 Volksschulkinder), andererseits kam es mir absurd vor, ein Kind in die Allgemeine Sonderschule geben zu müssen, wo doch die Integrationsklassen gerade gestartet wurden. Nach einer Aussprache mit der Mutter des Kindes und einem Kennenlernen von Herbert nahmen wir ihn gerne zu uns in die Klasse. Die Mutter meinte, daß sie alles in ihrer Macht Stehende unternehmen würde, um ihrem Kind die Laufbahn einer Sonderschule zu ersparen, und wenn es sein müsse, würde sie es privat unterrichten lassen.
Wir beriefen unseren ersten Elternabend ein, der noch im Juni - also vor Beginn der großen Ferien und der ersten Klasse - stattfand. Initiative dazu und das Besorgen aller Adressen ging auf meine Bemühungen zurück, es ist nämlich nicht üblich, den ersten Elternabend noch im Juni vor Beginn des folgenden Schuljahres abzuhalten, ich wollte jedoch die Eltern und die Kinder, die mitkommen wollten, schon vorher kennenlernen, und sie sollten die Möglichkeit erhalten, Fragen zu stellen, die Schule und uns kennenzulernen.
Beim Elternabend überwog die positive Stimmung, es gelang im großen und ganzen, Inhalte und Schwerpunkte über das kommende Schuljahr zu vermitteln.
Protokollauszug dieses Elternabends:
Ein Vater: “Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie soll der Unterricht aussehen, sind die Kinder immer beisammen, wie wird die Notengebung aussehen? Die Kinder können doch gar nicht alle rechnen lernen?” (Damit sind die behinderten Kinder gemeint). Eine Mutter: “Werden die Kinder auch genug lernen für ihre Zukunft? Können wir zuschauen kommen?”
Diese Beschreibung zeigt deutlich, daß die Eltern von offizieller Seite keinerlei Informationen über den Schulversuch erhalten haben, außer einem kurzen Gespräch bei der Einschreibung ihres Kindes, da ja die Teilnahme am Schulversuch auf freiwilliger Basis erfolgen soll, daß keinerlei Vorstellungsmöglichkeit Platz hat und auch Ängste versteckt sind, sich konkret auszudrücken. Vor allem was Fragen über die behinderten Kinder betrifft, ist große Unsicherheit spürbar, manche Eltern wissen nicht einmal, wie sie “solche” Kinder benennen sollen. Da ist es vielleicht einfacher, man übersieht einstweilen die Behinderten, es ist doch peinlich, über sie zu sprechen, wenn die betroffenen Eltern anwesend sind. Auch ich war der Aufgabe noch nicht gewachsen, offen und ohne Scheu in eine Diskussion über die angerissenen Problemfelder einzusteigen. Unsere Vorstellungen über eine integrative Klasse bestanden zu diesem Zeitpunkt nur im Kopf, waren also noch abstrakte Wünsche, die Eltern sollten jedoch nicht den Eindruck bekommen, mit ihren Kindern würde “herumexperimentiert”. Deshalb gaben wir den Eltern zu verstehen, daß sie jederzeit in der Klasse willkommen sein würden, boten ihnen an, auch aktiv an der Unterrichtsgestaltung teilnehmen zu können und freuten uns über das große Interesse am Geschehen in der Klassengemeinschaft. Mein Vorschlag, in regelmäßigen Abständen Elternrunden zu einem bestimmten Problemkreis (wie z.B. Notengebung, Unterrichtsformen etc.) zu initiieren, wurde interessiert angenommen.
Die Gefahr, daß das Angebot einer Integrationsklasse vor allem den artikulationsfähigen und bildungsinteressierten Eltern offensteht - und Eltern, die sich nicht so gut ausdrücken können, abwartend im Hintergrund bleiben -, darf jedoch nicht übersehen werden. Deutlich zu spüren war eine gewisse Skepsis bei einigen Eltern, ob das Leistungsniveau in dieser Klasse nicht sinken würde bzw. ob die Kinder die AHS-Reife erlangen würden. Das Argument der Vorteile der kleinen Gruppe und der Betreuung durch zwei gleichberechtigte LehrerInnen ließ die Zweifel bei einigen Eltern schrumpfen. Wir vereinbarten, daß jederzeit Besuch in der Klasse willkommen sei, die Eltern vorbeikommen könnten und mithelfen sollten, wann immer sich dazu Gelegenheit bot. Dieses Zuschauen und Dabeisein-Können hilft am ehesten, Ängste und Vorurteile abzubauen, und erlaubt den Aufbau von Verständnis. Bei mitgebrachten Aufstrichen, Brötchen und Kaffee ließen wir den Abend gemütlich ausklingen, die ersten Kontakte waren geknüpft, und ich freute mich auf das kommende Schuljahr.
2
Schuleingangsphase
Vor dem ersten Schultag richteten wir die beiden nebeneinanderliegenden Klassenräume, die uns zugeteilt wurden, ein und schmückten die Klassenzimmer und den Gang bunt. Die Tische stellten wir in Gruppen auf, legten ein kleines Geschenk auf jeden Platz und warteten gespannt auf den ersten Schultag.
Aus meinem Protokoll:
Erster Schultag - Spannung und Aufregung liegt in der Luft, der Klassenraum der Volksschüler (!) ist gerammelt voll. Eltern und manche Großeltern sind unserer Einladung gefolgt. Manche Kinder sehen uns LehrerInnen zum ersten Mal, sind verschreckt an ihre Muttis geklammert, andere wiederum wollen nach unserer Begrüßung nicht nach Hause gehen. Wir geleiten die Kinderschar bis zum Schultor. Ein aufgewecktes Mädchen sagt bei der Verabschiedung: “Ich bleib noch bei dir, du mußt mir doch Lesen und Schreiben zeigen”. Ein anderes Kind versteckt sich weinend hinter dem Rücken der Mutter.
Die Kindergruppe war, wie in anderen ersten Klassen auch, bunt und sehr unterschiedlich. Erst später wurde mir selbst bewußt, daß die behinderten Kinder überhaupt nicht aufgefallen waren und keiner von ihnen bewußt Notiz genommen hatte. Das blieb auch in den nächsten Tagen so. Der Zufall wollte es, daß in unsere Klasse ein schwarzes Kind eingeschrieben wurde. Dieser Bub erregte die Aufmerksamkeit und Neugier der anderen Kinder viel mehr, die äußerliche Auffälligkeit lenkte den Blick der Großgruppe viel eher auf den schwarzen Buben als auf die als behindert eingeschulten Kinder. Wir versuchten von Anfang an, den kurzen Tagesablauf “normal” zu gestalten, also so, wie wir es immer in ersten Klassen gewohnt waren. Wir spielten oft und lange, ließen die Kinder dafür von zu Hause Spielsachen mitbringen, machten viele Kennenlern- und Kontaktspiele. In dieser jungen Anfangsphase kam es zu keinen Auseinandersetzungen zwischen den Kindern, weder in der ganzen Gruppe noch mit den behinderten Kindern. Es erhob sich die Frage: “Fallen die behinderten Kinder einfach nicht auf, oder gehen die Kinder einer Konfrontation unbewußt aus dem Weg?”
Aus meinem Tagebuch:
3. Schulwoche: Ich bin bei einem Kinderfest meiner Freundin zu Besuch. Der Sohn Peter besucht ebenfalls eine Integrationsklasse in einem anderen Bezirk als Schulanfänger. Er weiß nicht, daß ich Lehrerin in “so einer” Klasse bin. Auf meine Frage, wie es ihm in der Schule gefalle, meint er: “Ich habe zwei Frau Lehrerinnen, und bei uns sind vier behinderte Kinder. Ich habe aber erst zwei davon bemerkt.”
Diese Aussage zeigt, wie anders Kinder an die Konfrontation mit Neuem herangehen. Ich - als Erwachsene - richtete meine Beobachtungen vor allem auf die Kinder mit Behinderungen und wartete auf Reaktionen aus der Klasse. Für die Kinder selbst war die neue Situation des Schuleintrittes allgemein so beanspruchend, daß sie die behinderten Kinder nur zum Teil wahrgenommen hatten. Peters oben zitierte Aussage öffnete mir dahingehend die Augen, daß meine, wie auch immer gelagerten Erwartungen und Vorinformationen meinen Blick in eine bestimmte Richtung lenken ließen. Ein Rückblick auf diese Eingangsphase zeigt, wie unsicher mein eigenes Verhalten gegenüber den behinderten Kindern und ihrer Stellung in der Großgruppe war. Ich mußte selbst erst lernen, einen natürlichen Umgang mit der ganzen Gruppe zu entwickeln, was den Kindern teilweise viel besser gelungen war.
In der dritten Schulwoche tauten die Kinder auf, sie kannten sich inzwischen gut genug, um ihre anfänglichen Hemmungen fallen lassen zu können, sie kannten sich im Schulhaus aus, und das Schulleben wurde zu einer gewissen Routine. In dieser Phase kam es auch zu den ersten Konflikten unter den Kindern. Streitereien um Spielsachen und andere Materialien waren an der Tagesordnung. Dazu kam, daß wir Lehrerinnen keine Basis finden konnten, wie wir mit solchen Situationen umgehen sollten. Betonen möchte ich, daß diese Auseinandersetzungen der Kinder sicherlich in jeder Klasse geschehen, wir aber mit unserem Anspruch, vor allem das soziale Verhalten der Kinder prägen zu wollen, diese überforderten. Wir konnten es nicht zulassen, daß sich die Kinder untereinander Konflikte ausmachen sollten, und konnten ihre Abgrenzungsversuche gegenüber einzelnen Kindern nur langsam akzeptieren.
Aus meinem Protokoll:
4. Schulwoche: Wir erarbeiten einen Buchstaben im offenen Stationenbetrieb. Einige Kinder arbeiten gerade mit Plastilin. Ein Bub mit einer Behinderung reißt einem Mädchen das Material aus der Hand und wirft es durch die Klasse. Das Mädchen weint. Meine Kollegin nimmt den Buben an der Hand und verläßt mit ihm den Raum.
Wir Lehrerinnen waren auf so eine Situation nicht vorbereitet und konnten darauf spontan nicht anders reagieren. Der Weg des kurzen Herausnehmens aus der Großgruppe erschien uns in diesem Moment als beste Lösung. In unserem anderen Klassenzimmer versuchten wir Martin dann zu erklären, daß er so etwas nicht tun dürfe, und erkannten nicht, daß dieses Auf-ihn-Einreden gar nichts lösen würde und wir ihn der Möglichkeit beraubt hatten, einen Konflikt innerhalb der Gruppe, in der es zum “Ausbruch” kam, aufzuarbeiten. Rückblickend betrachtet wollten wir nur die aggressive Reaktion des Buben “abstellen”, ohne genau auf die Ursachen einzugehen. Dabei stießen wir aber an unsere Grenzen, die zusätzlich von Zeitmangel und unzureichender Ausbildung in Konfliktverarbeitung geprägt waren.
Immer wieder reagierte das eine oder andere Kind mit Zornausbrüchen oder aggressiver Verweigerung, und wir konnten zu diesem Zeitpunkt nur mit einem Zugeständnis zur Auflösung der Großgruppe antworten. In Gesprächen zwischen uns Lehrerinnen wurde nun immer deutlicher, daß dieser Weg des Trennens der Kinder in zwei Gruppen für meine Kollegin immer mehr zum gangbaren Weg wurde. Die objektiv erscheinende Entlastung führte zu einer eingeschränkten Sichtweise in bezug auf die ursprüngliche Idee. Ich konnte noch nicht eingestehen, daß mir diese Lösungsstrategie falsch erschien, weil eine echte Aufarbeitung der Wurzel aggressiven Verhaltens nicht gegeben war, und es gelang mir nicht, meinen Anspruch an integrative Arbeit zu artikulieren.
Diese Erlebnisse prägten jedoch unsere weitere Arbeit zusehends. Immer öfter trennten wir die Kindergruppen, ohne die Auswirkungen dieses Vorgehens zu hinterfragen, und es gelang anfangs sehr gut, daraus folgende Konsequenzen zu verdrängen. Sicherlich wurde dieses - nun nach außen ruhig erscheinende - Vorgehen unserer Arbeit von einem permanenten Erfolgsmeldezwang begünstigt. Dazu kam die große Unsicherheit, da wir in bezug auf integratives Arbeiten keinerlei Unterstützung erhielten und somit ganz auf uns selbst gestellt waren. (Zu diesem Zeitpunkt bestand noch keine Supervisionsmöglichkeit oder eine begleitende Unterstützung des Schulversuches.)
Immer tiefer rutschten wir in eine Sackgasse, die Auseinandersetzung mit problembehafteten Situationen wurde von uns nicht als notwendiger Schritt auf dem Weg zur effizienteren Kooperation erkannt, wir konnten nichts Positives daraus ableiten. Unser Weg wurde zu einem linearen Geschehen, der keine Abweichungen mehr zuließ und deshalb stabilisierend auf unsere Trennung und unsere schlechte Arbeitsbeziehung wirkte. Dies sei im folgenden Kapitel verdeutlicht.
Meine Geschichte mit Elvira –Der Versuch, am Mißerfolg zu wachsen
Elvira kam drei Wochen nach Schulbeginn der 1. Klasse zu uns. Sie ist ein zartes, kleines Mädchen, das sehr schnell und offen auf andere Menschen zugeht. Sie ist sprachlich sehr gut gefördert, kann daher alles sprechen, sich verbal sehr gut ausdrücken und ist immer für Späße aufgelegt. Sie kam von einer privat geführten Sonderschuleinrichtung für schwerstbehinderte Kinder zu uns in die Integrationsklasse, nachdem die Eltern von der gemeinsamen Erziehung und Bildung nichtbehinderter und behinderter Kinder erfahren hatten. Den weiten Schulweg für ihr Kind nahmen sie gerne in Kauf. Wir wußten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, daß der Schulwechsel auch deshalb vollzogen wurde, weil Elviras Eltern mit dem Unterricht der privaten Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder nicht zufrieden waren. Elvira kam mit Down-Syndrom zur Welt und hat mehrere Geschwister.
Wir alle, Erwachsene und Kinder, nahmen uns um Elvira sehr an, beschäftigten uns lange Zeitabschnitte des Vormittags eingehend mit ihr, da wir die wichtige Einschulungs- und Kennenlernphase fast abgeschlossen hatten und wir nicht wollten, daß sie aufgrund ihres späteren Schuleintrittes Nachteile erleben sollte. Elvira wurde von allen Kindern der Klasse sehr lieb aufgenommen und bald als voll zugehörig erlebt. Das Mädchen war uns nun als viertes behindertes Kind anvertraut worden, und damit war die Schülerhöchstzahl in unserer Klasse erreicht, wir konnten also beruhigt weiter am Aufbau der Gruppenzusammengehörigkeit arbeiten, ohne damit rechnen zu müssen, daß unerwartete weitere Einschulungen auf uns zukommen würden (siehe auch Kap. 6, Rahmenbedingungen).
Die Sonderschullehrerin bemühte sich sehr um Elvira, sicher auch deshalb, weil man mit dem Mädchen viel sprechen konnte und die Kommunikation mit ihr bedeutend leichter fiel als mit den anderen behinderten Kindern. Die Kleine war sich dessen jedoch bald bewußt und forderte immer stärker ihre Rolle als Mittelpunkt innerhalb der Gruppe der behinderten Kinder ein. Sie war lernbegierig, wollte immer beschäftigt werden, und wir hatten anfangs den Eindruck, sie könnte mit der Gruppe der Volksschulkinder ohne weiteres mithalten. Fleißig erarbeitete die Sonderschullehrerin mit Elvira die Kulturtechniken, immer wieder wurde mit ihr allein geübt und wiederholt. Bald konnte sie einige Buchstaben erkennen und abschreiben, jedoch ‘nur’ bedingt auswendig niederschreiben, und das Zusammenlauten klappte gar nicht. Ich selbst konnte mich nun des Eindrucks nicht mehr erwehren, daß Elvira in die Rolle des “Vorzeigekindes” gedrängt wurde, das immer wieder beweisen mußte, wie gut sie doch die von ihr erwarteten Leistungen erbringen könne. Kam Besuch zu uns in die Klasse, wurde sie z.B. aufgefordert, Buchstaben zu benennen, sie wurde öfter als andere Kinder gebeten zu sprechen , sie ging auf alle Besucher sofort unerschrocken zu, setzte sich mit ihrer “lieben” Art zu agieren sofort in den Mittelpunkt und erstickte damit andererseits oftmals Gruppenaktivitäten.
In diese Phase von Elviras Lernerfolgen fielen die ersten Auseinandersetzungen zwischen mir als Volksschullehrerin und meiner Kollegin als Sonderschullehrerin. Die unterschiedlichen Ansätze zur Förderung und Bildung von behinderten Kindern wurden immer deutlicher, ich konnte sie jedoch nicht konkret benennen und hatte Probleme damit, einer “Spezialistin” meine Bedenken klar darzustellen. Ich wollte in dieser frühen Phase unserer Integrationsarbeit eher das soziale Lernen in den Vordergrund stellen, ging mit den Kindern bewußt langsam im kognitiven Bereich vor und wollte die Zeit der ersten Schulwochen primär für die Gruppenbildung, das Kennenlernen und die Anbahnung von Kommunikationsfähigkeit nutzen. Vor allem hatte ich mir vorgestellt, soviel wie möglich mit offenen Lernformen zu unterrichten und Anregungen der Kinder selbst in unsere Arbeit aufzunehmen. Für diese Art des Unterrichtens konnte ich meine Kollegin nicht gewinnen.
Die Sonderschullehrerin legte den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf das Kennenlernen von Kulturtechniken, wollte den schwerstbehinderten Kindern primär Lesen und Schreiben beibringen und sah diesen Anspruch aufgrund von Elviras Fortschritten und den positiven Rückmeldungen über die Lernerfolge gerechtfertigt. Mir ist es leider nicht gelungen, meinen Anspruch integrativer Arbeit innerhalb des gesamten Klassenverbandes an meine Kollegin heranzutragen bzw. diesen “Idealvorstellungen” gerecht zu werden, da die Sonderschullehrerin immer im Rahmen der Einzelbetreuung ihre Erfolge verwirklicht sah. Das wiederum führte zu einer oftmaligen örtlichen Aufteilung der zwei Kindergruppen auf die zwei Klassenräume, wo jede von uns Erwachsenen “ihre” Arbeit machte und sich immer mehr von der anderen abkapselte. Mit der Zeit trat dann ein, was ich befürchtet hatte. Elvira war nur mehr zum Arbeiten zu bewegen, wenn ein Erwachsener neben ihr saß und sie einzeln betreut wurde. Sie war nun auf die anderen Kinder eifersüchtig, konnte es nicht ertragen, wenn wir uns einem anderen Kind intensiver widmeten als ihr, und verweigerte mit der Zeit das Lernen in einer größeren Gruppe, störte oder schaltete zur Gänze ab.
Immer wieder versuchte ich mit meiner Kollegin über unsere unterschiedlichen Ansätze zu diskutieren. Die Gespräche waren jedoch immer zu kurz, außerhalb der Dienstzeit fanden wir zu selten zueinander, ich war mehr und mehr verunsichert, ob meine Ansprüche nicht doch zu hoch waren, und begann zu resignieren, als ich bemerkte, daß Elvira zwischen uns beiden Bezugspersonen hin und her gerissen war. So stabilisierte sich unser Zurückziehen auf die jeweils “eigene” Kindergruppe, und wir besprachen nur mehr die allernötigsten Schritte unserer weiteren Arbeit miteinander.
Eines Tages zeigte mir meine Kollegin eine Videoaufzeichnung über ihre Arbeit in der Gruppe der behinderten Kinder. Ich wußte weder, daß ein Onkel von Elvira zu Besuch da gewesen war, noch wußte ich von der geplanten Videoaufnahme durch diesen Verwandten. Allein diese Tatsache zeigt, wie weit wir uns voneinander entfernt hatten bzw. wie wenig wir voneinander und über unsere Arbeit wußten. Ich spürte nur immer deutlicher, daß all meine Hoffnungen, Integration verwirklichen zu können, mehr und mehr schrumpften. Das Gefühl der Ausweglosigkeit wurde noch dadurch gefestigt, daß es keine “Anlaufstelle” für meine Sorgen gab.
Aus meinen Protokollaufzeichnungen: