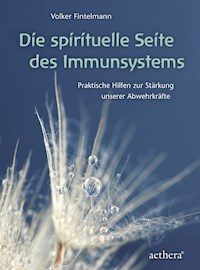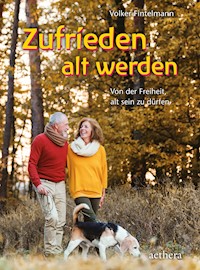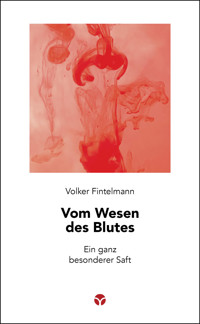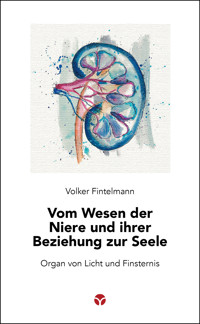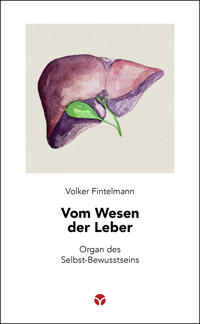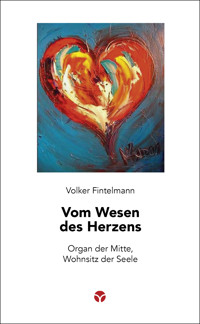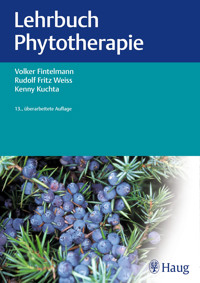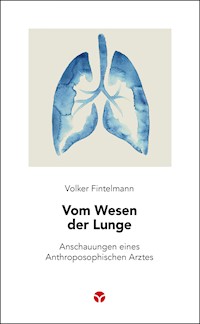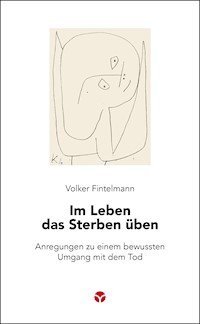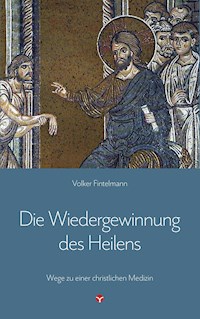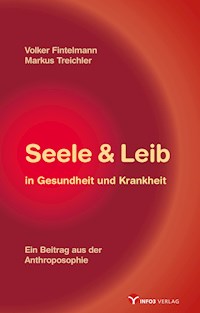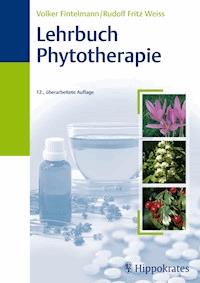84,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hippokrates
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
„Intuitive Medizin“ ist das richtige Buch für Ihren Einstieg in die anthroposophische Medizin, wenn Sie ergänzend zur schulmedizinischen Therapie anthroposophisch arbeiten wollen.
Sie erhalten ganz konkrete Therapiekonzepte bei bewährten Indikationen u. a. bei Sklerose Krankheiten, Depression oder allergischen Krankheiten. Die Darstellung der Inhalte ist vor allem für Therapeuten leicht verständlich, die noch keine oder wenig Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Nach der Lektüre verstehen Sie die wesentlichen Charakteristika der anthroposophischen Heilmittel und können so die Wirkmechanismen besser nachvollziehen.
Neu in der 6. Auflage: Im allgemeinen Teil: Aktualisierung des Kapitels "Schmerz" und Erweiterung um die "Psychosomatik der Organe". Im speziellen Teil wurden einige Krankheitsbilder hinzugefügt wie z.B. Leukämien, und den jeweiligen zugehörigen Arzneimitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Intuitive Medizin
Theorie und Praxis der Anthroposophischen Medizin
Volker Fintelmann
6., aktualisierte und erweiterte Auflage
11 Abbildungen
Vorwort zur 6. Auflage
Die Intuitive Medizin wird mit Erscheinen ihrer 6. Auflage 30 Jahre alt, nimmt man die Zeit ihrer Ausarbeitung hinzu. Mein Vorwort zur 1. Auflage stammt von Ostern 1986. Ich kann für diese Auflage nur wiederholen, was ich auch der vorigen voranstellte: Mich erfüllt ein tiefer Dank, dass dieses Buch und seine Inhalte so angenommen wurden, dass es über diese lange Zeit immer neue Leser gefunden hat und dass es mittlerweile auch in vier weiteren europäischen Sprachen als Übersetzung erschien.
Es ist für mich ein bewegender Gedanke, dass letztlich jeden Tag mindestens ein Mensch die Intuitive Medizin kaufte, rechnet man die verkauften Exemplare auf die Tage von 20 Jahren um. Ich bekam zahlreiche Rückmeldungen. Viele Ärzte, Pflegende und Therapeuten fanden in dem Buch eine Beschreibung genau der Medizin, die sie sich bei ihrer Berufswahl erhofften oder vorstellten: Eine Medizin, für die das Einzelschicksal eines Erkrankten den Ausgangspunkt allen Handelns bedeutet. Eben diese Art einer therapeutischen Haltung ging im modernen Medizinbetrieb immer mehr verloren. „Die verlorene Kunst des Heilens“ hat der bekannte Kardiologe Bernard Lown dieses Zeitgeschehen in seinem Alterswerk genannt.
Es erstaunt mich immer wieder, wie gerne ich selber in dem Buch lese oder eine Frage aufsuche. Das bestätigt mir, was ich bereits im Vorwort der 1. Auflage aussprach: In Wirklichkeit haben es meine vielen Patienten, die sich mir in meinem nun langen Arztleben anvertrauten, verfasst. Ich habe nur formuliert und zum Ausdruck gebracht, was sie mich lehrten. Der Inhalt ist immer erlebte Anschauung, nirgendwo Theorie oder Spekulation. Das mag gegenüber einer medizinischen Wissenschaft, die ihre Paradigmen regelmäßig korrigiert oder völlig neu formuliert, anmaßend klingen, ist aber ganz bescheiden gemeint, um die Methode zu charakterisieren, die dem dargestellten Inhalt zugrunde liegt. Wie Goethe sich von den Pflanzen über ihr Wesen belehren ließ, so habe ich von den Menschen, den gesunden wie den erkrankten, das Wesen der Krankheiten ablesen gelernt. Meine Hauptaufgaben waren, das mir Vermittelte in eine medizinische Ausdrucksform zu übersetzen und das jeweils Typische und damit Gemeinsame in dem Individuellen des einzelnen Erkrankten zu entdecken. Darin sehe ich die Aufgabe einer Intuitiven Medizin, die – mit dem Physiologen und Sozialmediziner Hans Schäfer gesprochen – kein Gegensatz einer Wissenschaftsmedizin ist, sondern ihre notwendige Ergänzung. Schäfer forderte die Ärzte auf, diese Verbindung zu entdecken und den tradierten Gegensatz zu überwinden. Das ist mein Anliegen seit mehr als 40 Jahren.
Und es ist so dringend wie je zuvor, weil der Mensch als Ganzes aus dem medizinischen Denken und Handeln mehr und mehr verschwindet. Heute dominieren molekularbiologische oder genetische Vorstellungen und Detailkenntnisse. Dadurch jedoch wendet sich die naturwissenschaftliche Medizin ganz von ihrer Ausgangsposition ab. Denn ursprünglich sollte in ihr ausschließlich das als Wissenschaft gelten, was sich sinnlich beobachten lässt. Längst arbeitet die Medizin mit Fakten, denen keinerlei Beobachtung mehr zugrunde liegt. Apparative Messergebnisse sind an ihre Stelle getreten, Deutungen dieser Ergebnisse, Hypothesen. Diese werden nicht mehr an der menschlichen Realität geprüft, sondern es wird umgekehrt die Auffassung vom Menschen von solchen Ergebnissen gebildet. Gelingt eine Übereinstimmung nicht, versucht man, die menschliche Realität entsprechend zu manipulieren. Hier liegt die größte Gefährdung der Genforschung, weil sie Grundlage dafür werden kann, den Menschen solchen theoretisch formulierten Vorstellungen entsprechend zu verändern, ihn theoriegerecht neu zu gestalten.
In dieser Auflage des Buches sind wieder einige Kapitel neu hinzugekommen, sowohl im Allgemeinen als auch im Speziellen Teil. Das besondere Organverständnis und der spirituelle Aspekt vom Schlaf und seinem Gestörtsein sind so oft in meinen Seminaren, Vortägen und Kolloquien angesprochen und befragt worden, dass es mir richtig erschien, diese Fragestellungen in die neue Auflage einzuarbeiten. Das gilt auch für den Blick auf das Heilen, das als Heilkunst wieder Grundlage einer menschengerechten Medizin werden muss. Und ganz am Schluss habe ich ein Kapitel „Wege zu einer Christlichen Medizin“ als sehr persönliches Bekenntnis hinzugefügt.
Alle praktischen Hinweise, besonders für empfohlene Arzneimittel, wurden aktualisiert, was nicht einfach ist, weil hier von den Arzneimittelherstellern immer kurzfristigere Änderungen erfolgen. Dieser Trend, der überwiegend marktbestimmt ist, hat auch vor den anthroposophischen Arzneimittelherstellern nicht Halt gemacht. So kann es sein, dass manche Arznei bald schon nicht mehr in der genannten Arzneiform oder der Potenzierungsstufe erhältlich ist. In diesen Fällen wird der Leser nach Alternativen suchen müssen. Auch wurde die Literatur aktualisiert.
Mein Dank gilt dem Verlag, der nun Haug heißen wird, aber doch weiterhin Teil der großen Verlagsfamilie Georg Thieme Stuttgart ist. Frau Stefanie Westphal und Frau Ulrike Marquardt haben diese Auflage begleitet, wobei sich durch die modernere Form, alle Änderungen und Ergänzungen eigenständig in die zur Verfügung gestellte elektronische Datei einzuarbeiten, Kommunikation und Zusammenwirken deutlich reduzierten. Ein großer Dank gilt meiner Frau Alexandra, die nicht nur alle technischen Einarbeitungen durchführte, sondern wie immer liebevoll-kritischer erster Leser war.
Möge die Intuitive Medizin auch weiterhin den Weg zu vielen Lesern finden und sie anregen, ihre Praxis der Medizin um die Gesichtspunkte zu ergänzen, die als Ergänzung oder auch zur Modifizierung der an den Medizinischen Fakultäten gelehrten Medizin dienen können. Möge sie den Leser in seinem Verständnis von Krankheit und individuellem Kranksein weiterführen und in seinem therapeutischen Handeln stärken. Dann ist mein Anliegen, das mich die Intuitive Medizin schreiben und wieder herausgeben ließ, erfüllt.
Hamburg, im Juli 2016
Prof. Dr. med. Volker Fintelmann
Vorwort zur 1. Auflage
Bisher war ich der Überzeugung, dass es nicht meine Aufgabe sei, ein Buch zu schreiben, da sich meine Fortbildungstätigkeit ganz in der direkten Begegnung mit Menschen durch Vorträge und Seminare vollzog. Seit mehr als 15 Jahren bin ich in dieser Hinsicht tätig, einmal in der speziellen Ausrichtung der Hepatologie, zum anderen aber zunehmend in der Darstellung einer durch die Anthroposophie ergänzten naturwissenschaftlich orientierten Medizin. Als dann Frau Dorothee Seiz vom Hippokrates-Verlag bei mir anfragte, ob ich nicht ein Buch über die anthroposophisch ergänzte Medizin für den Verlag schreiben wollte, war es die Art ihrer Fragestellung, die meinen bisherigen Entschluss ins Wanken brachte. In einem Vortrag von mir hatte sie die Erfahrung gemacht, dass es offenbar möglich ist, die schwierigen Inhalte der anthroposophischen Menschenkunde auch einem Zuhörer ohne jegliche Vorkenntnis zugänglich zu machen, ohne an seinen blinden Glauben zu appellieren, da die anthroposophische Medizin in dem letzten Jahrzehnt immer bekannter und z.T. auch populärer geworden war, immer häufiger über sie berichtet und vorgetragen wurde (wobei sie allerdings immer eine Alternative zu der etablierten Medizin genannt wurde), und außerdem für mich selbst das zunehmende Bedürfnis meiner Zuhörer erkennbar wurde, das ihnen Vorgetragene in schriftlicher Form nacharbeiten zu können, führten dann die nachfolgenden Gespräche mit Frau Seiz und dem Hippokrates-Verlag zu dem nun hier vorgelegten Buch. Es will als eine Einführung in eine anthroposophisch ergänzte Medizin verstanden werden; es ist ganz sicher kein Lehrbuch einer solchen. Diese Einführung kann somit auch nur ein Aspekt einer umfassenden Erweiterungsmöglichkeit der Medizin sein; ein Aspekt von vielen, die als Forschungsresultate Rudolf Steiners vorhanden sind. Viele solcher weiteren Aspekte müssen unberücksichtigt bleiben, an keiner Stelle wird Vollständigkeit erreicht. Auch handelt es sich um eine ganz persönliche Darstellung, die keiner Lehrmeinung entspricht und auf keinen Fall irgend einen neuen wissenschaftlichen Dogmatismus begründen will. Für alles, was in diesem Buch dargestellt wurde, übernehme ich die ganz persönliche Verantwortung, einerseits gegenüber dem Leser, andererseits auch gegenüber Rudolf Steiner, als dessen Schüler ich mich bezeichnen darf und muss. Ohne diese Schülerschaft hätte dieses Buch überhaupt nicht entstehen können, doch will es eben nicht ein Nachdruck der Darstellungen Rudolf Steiners sein, sondern die Darstellung, wie sich seine Forschungsresultate in einem Arzt unserer Zeit ausgestalten können. Dabei spielt immer das Bemühen eine Rolle, die Brücke zwischen naturwissenschaftlich-anthropologischer und geisteswissenschaftlich-anthroposophischer Forschung zu schlagen. Denn überall dort, wo die naturwissenschaftliche Methode in der Medizin Tatsachen beschreibt, stehen diese in keinerlei Widerspruch zu den geisteswissenschaftlichen Forschungsaussagen. Die Widersprüche auf beiden Seiten treten erst dann auf, wenn Tatsachen durch Hypothesen oder Spekulationen ersetzt werden.
Der Physiologe und kritische Betrachter der modernen Medizin Hans Schäfer hat einmal formuliert: „Intuition und Wissenschaft sind keine Gegensätze. Ein Teil der ärztlichen Diagnostik und Therapie, der Einfühlungsvermögen benutzt und Anteilnahme (Sympathie mit dem Kranken) voraussetzt, ist intuitiv. Unsere gegenwärtige Medizin ist intuitionsfeindlich. Sie ist das zum Schaden aller. Die Ärzte sollten das wissen – und ändern.“ Diese Sätze haben mich, als ich sie das erste Mal las, tief befriedigt, entsprachen sie doch der eigenen ärztlichen Erfahrung. Bereits 1920 formulierte Rudolf Steiner in einem öffentlichen Vortrag in Basel (6. Januar 1920), dass der modernen naturwissenschaftlichen Medizin eine Befruchtung durch Geisteswissenschaft not täte, da sie sonst die Wirklichkeit des ganzen Menschen verlieren werde. Aus den Forschungsergebnissen der anthroposophischen Erkenntnismethode biete sich die Möglichkeit, die naturwissenschaftliche Seite der Medizin um eine geisteswissenschaftliche zu ergänzen und sie damit wieder zu einer Ganzheit werden zu lassen. Diese Möglichkeit einer zukünftigen Medizin, die auf das Bestehende aufbaut, nannte Steiner „intuitive Medizin“.
In der Tat hat die Entwicklung der Medizin seit 1920 gezeigt, dass die ausschließliche Anwendung der Naturwissenschaft in eine Sackgasse führt, die heute allgemein als „Krise der Medizin“ bezeichnet wird. Da ist die Rede von dem Verlust des Menschen, der Dominanz der Technik über den Menschen, der Inhumanität; aber die Medizin wird auch bestimmt durch Kostenexplosion und Kostendämpfung, politische und soziologische Einflussnahmen und schließlich eine vom Pharmazeuten (und damit der Pharmaindustrie) betriebene Heilmittelforschung, aus deren Verantwortung der praktizierende Arzt längst entlassen wurde.
An vielen Stellen treten heute fundierte oder auch die Gunst der Stunde nutzende Kritiker auf, die alle Schwächen der modernen Medizin schonungslos aufdecken. Dagegen finden sich nur ganz vereinzelt Ansätze eines Angebots, wie denn diese Medizin sich wandeln könne oder müsse, um wieder ein Tätigkeits- und Wissenschaftsfeld zu werden, auf das die Menschen mit Dankbarkeit und Zufriedenheit blicken können. Die eigene 25-jährige praktische und wissenschaftliche Auseinandersetzung und Erfahrung mit diesen Fragen und die Überzeugung, dass nur eine Synthese von naturwissenschaftlich-anthropologischer und geisteswissenschaftlich-anthroposophischer Methode in der Medizin eine neue Menschlichkeit derselben ermöglichen wird, sind die persönlichen Voraussetzungen für dieses Buch. So soll es einerseits eine Einführung in die anthroposophische Heilmethode sein, zugleich aber auch Auseinandersetzung mit der Einengung durch die reduktionistisch-positivistische Betrachtungsweise in der modernen Medizin. Es ist – wie gesagt – aus persönlicher Sicht geschrieben und will zum Nach- und Mitdenken anregen; es ist mehr Studien- als Lesebuch und mit Sicherheit zeitgebunden. Denn die Medizin ist eine lebendige Wissenschaft, in der Wachstum, Fortschritt, Veränderung prägende Faktoren sind. Und dennoch will das Buch auch Allgemeingültigkeit beanspruchen, insofern es auf menschenkundliche Gesetzmäßigkeiten zurückgreift, die entsprechend naturwissenschaftlichen Gesetzen in der Evolution lange gültig sein werden, wenn auch nicht ewig. Denn dass sich auch in der Evolution revolutionierende Veränderungen vollziehen und alles – Mensch wie Natur und Kosmos – in ständiger Wandlung begriffen ist, ist eine aus der Anthroposophie gewonnene Einsicht. Möge das Buch in diesem Sinne einen Beitrag für Zukunftsaspekte der Medizin leisten und dem Leser Anregung für eigenes Studium und möglicherweise auch für seinen Weg zu Rudolf Steiner sein. Mein Dank gehört vor allem Frau Seiz, ohne die dieses Buch gar nicht entstanden wäre. Sie hat die ganze Entstehung desselben begleitet und sich als erster „vorurteilsfreier“ Leser erwiesen. Manches konnte dadurch gegenüber einem ersten Entwurf noch verbessert, anschaulicher gemacht oder präzisiert werden. Dank gilt auch meinem Bruder Dr. Klaus Fintelmann für seine kritische Mitarbeit bei den erkenntnistheoretischen Erörterungen.
Dank gilt aber vor allem den vielen Mitarbeitern, die meinen ganzen beruflichen Weg prägten. Alles, was ich mir an Erkenntnissen gestaltete, ist nur möglich geworden aus der Zusammenarbeit mit vielen anderen Menschen, die mit mir zusammen für unsere Patienten wirkten. Stellvertretend für alle anderen sei Frau Dr. Ursula Schad genannt, die in besonders enger Weise die diesem Buch anvertrauten Inhalte mit mir durchlebte. Und schließlich sei den nicht mehr zu zählenden und doch tief im Gedächtnis bewahrten Patienten gedankt, die sich mir anvertrauten und mir Lehr- und Wanderjahre ermöglichten, deren Erfahrungen nun in diesem Buche ihren Niederschlag finden.
Hamburg, Ostern 1986
Prof. Dr. med. Volker Fintelmann
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 6. Auflage
Vorwort zur 1. Auflage
Teil I Allgemeiner Teil
1 Medizin in der Sackgasse – ihre Krise als Herausforderung
1.1 Historischer Rückblick
1.2 Mechanistischer Standpunkt und Fortschritt der Medizin
1.3 Statistik und der Durchschnittsmensch: zur Frage der Diagnostik
1.4 Der bestimmte Mensch (Genetik): Krise ärztlicher Verantwortung
1.5 Krise der Medizin
1.6 Literatur
2 Erkenntnistheoretische Erwägungen
2.1 Der Prozess des Erkennens: Forschung und Wissenschaft
2.2 Stufen des Erkennens: Was ist Intuition?
2.3 Medizin als Freiheitswissenschaft
2.4 Literatur
3 Allgemeine Menschenkunde (Physiologie)
3.1 Einheit von Leib, Seele und Geist
3.1.1 Leib
3.1.2 Seele und Geist
3.1.3 Literatur
3.2 Dreigliedriger leiblicher Organismus
3.2.1 Nerven-Sinnes-System
3.2.2 Stoffwechsel-Gliedmaßen-System
3.2.3 Rhythmisches System
3.2.4 Literatur
3.3 Sinneslehre
3.3.1 Sinneswahrnehmung
3.3.2 Zwölf Sinne
3.3.3 Zusammenwirken der Sinne
3.3.4 Literatur
3.4 Organe und Organismus
3.4.1 Leber und Gallesystem
3.4.2 Nierensystem
3.4.3 Wahre Psychosomatik
3.4.4 Literatur
3.5 Was ist Gesundheit?
3.5.1 Literatur
4 Allgemeine Krankheitslehre (Pathologie)
4.1 Was ist Krankheit?
4.1.1 Ursache der Krankheit im Menschen
4.1.2 Krankheiten als verlagerte normale Prozesse
4.1.3 Krankheit und Biografie
4.2 Vier Krankheitstypen
4.2.1 Sklerose und Sklerosekrankheiten
4.2.2 Geschwulst und Geschwulstkrankheiten
4.2.3 Allergie und Allergiekrankheiten
4.2.4 Entzündung und Entzündungskrankheiten
4.2.5 Literatur
4.3 Schmerz
4.3.1 Schmerzarten
4.3.2 Schmerztherapie
4.3.3 Literatur
4.4 Schlaf und Schlafstörungen
4.4.1 Schlafhygiene
4.4.2 Einschlafstörungen
4.4.3 Durchschlafstörungen
4.4.4 Literatur
Teil II Spezieller Teil
5 Vorbemerkungen
6 Sklerosekrankheiten
6.1 Koronare Herzkrankheit
6.1.1 Therapeutische Hinweise
6.2 Rheumatische Erkrankungen
6.2.1 Therapeutische Hinweise
6.3 Primäre Osteoporosen
6.3.1 Therapeutische Hinweise
6.4 Diabetes mellitus
6.4.1 Therapeutische Hinweise
6.5 Colitis ulcerosa und Enterocolitis Crohn
6.5.1 Therapeutische Hinweise
6.6 Morbus Parkinson
6.6.1 Therapeutische Hinweise
6.7 Multiple Sklerose
6.7.1 Entzündungs- oder Sklerosekrankheit?
6.7.2 Empfindungsleib und Empfindungsseele
6.7.3 Ätiologie und Pathogenese
6.7.4 Symptomatik
6.7.5 Therapeutische Hinweise
6.7.6 Literatur
6.8 Chronische Harnwegsinfekte
6.8.1 Therapeutische Hinweise
6.9 Lungenemphysem und chronische Bronchitis
6.9.1 Therapeutische Hinweise
6.10 Demenz
6.10.1 Der Spiegel wird stumpf
6.10.2 Früherkennung tut not
6.10.3 Ist Alzheimer-Demenz eine Zeitkrankheit?
6.10.4 Prävention und Therapie
6.10.5 Literatur
7 Geschwulstkrankheiten
7.1 Therapeutische Hinweise
7.1.1 Typische Arzneimittel
7.2 Fragen einer Prävention
7.2.1 Typische Arzneimittel der Prävention
8 Depression und depressive Verstimmungen
8.1 Therapeutische Hinweise
8.1.1 Typische Arzneimittel
9 Allergische Krankheiten
9.1 Heuschnupfen (Rhinitis vasomotoria)
9.1.1 Therapeutische Hinweise
9.2 Hypertonie und Hypotonie
9.2.1 Duale Ordnung allergischer Regulation
9.2.2 Arterielle Hypertonie
9.2.3 Konstitutionelle Hypotonie
9.2.4 Literatur
9.3 Migräne
9.3.1 Therapeutische Hinweise
9.3.2 Literatur
9.4 Asthma bronchiale
9.4.1 Therapeutische Hinweise
9.5 Atopische Dermatitis (Neurodermitis)
9.5.1 Therapeutische Hinweise
10 Zur Frage der Autoaggressionskrankheiten
10.1 Übergreifende Aspekte
10.2 Therapeutische Hinweise
10.2.1 Etablierte Therapie
10.2.2 Kurzfristiger Einsatz von Immunsuppressiva
10.2.3 Typische Arzneimittel
10.3 Autoimmunthyreoitiden (Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus Basedow)
10.3.1 Schilddrüse – Organ der Emotionalität
10.3.2 Therapeutische Hinweise
10.4 Systemischer Lupus erythematodes
10.4.1 Physiologie der Nierenorganisation
10.4.2 Immunnephropathie
10.4.3 Therapeutische Hinweise
10.5 Autoimmune Leber- und Galleerkrankungen
10.5.1 Physiologie von Leber und Galle
10.5.2 Autoimmunhepatitis, PBC und PSC
10.5.3 Therapeutische Hinweise
10.6 Literatur
11 Entzündungskrankheiten
11.1 Kinderkrankheiten
11.1.1 Literatur
11.2 Akute Hepatitis
11.2.1 Therapeutische Hinweise
11.2.2 Literatur
11.3 Typhus und Ruhr
11.3.1 Therapeutische Hinweise
11.4 Pneumonie
11.4.1 Therapeutische Hinweise
11.5 Tuberkulose
11.5.1 Therapeutische Hinweise
11.6 Erysipel
11.6.1 Therapeutische Hinweise
12 Krebskrankheit
12.1 Ursachen der Krebskrankheit (Ätiologie)
12.1.1 Symptomatologie
12.2 Pathogenese der Krebskrankheit
12.2.1 Kanzerose
12.2.2 Krebsgeschwulst: Karzinom
12.3 Offene Fragen
12.4 Therapie der Krebskrankheit
12.4.1 Diätetik
12.4.2 Kunst
12.4.3 Pflege
12.4.4 Arznei
12.4.5 Gespräch
12.4.6 Allgemeine Aspekte der Therapie
Teil III Elemente der Therapie
13 Medizin als Heilkunst
13.1 Literatur
14 Arzneimittelwirkung und -anwendung
14.1 Fünf Stufen einer ganzheitlichen Therapie
14.1.1 Diätetik als Katharsis
14.1.2 Kunst als Bewegung
14.1.3 Pflege als Behandlung
14.1.4 Arznei als Begegnung
14.1.5 Gespräch als Kommunion
14.1.6 Literatur
14.2 Arzneimittelwirkung
14.2.1 Substitutive oder „stellvertretende“ Methode
14.2.2 Regelnde oder regulative Methode
14.2.3 Stützende oder begleitende Methode
14.2.4 Arzneimittel als „Modell“ – harmonisierende Methode
14.3 Arzneimittelanwendung
14.3.1 Typische Arzneimittel
14.3.2 Typenmittel
14.4 Therapie mit Metallpräparaten
14.4.1 Blei (Plumbum) und Silber (Argentum)
14.4.2 Zinn (Stannum) und Quecksilber (Mercurius)
14.4.3 Eisen (Ferrum) und Kupfer (Cuprum)
14.4.4 Gold (Aurum)
14.4.5 Antimon (Stibium)
14.4.6 Magnesium
14.4.7 Literatur
14.5 Bittermittel
14.6 Ätherische Öle
14.7 Gifte als Heilmittel
14.7.1 Tiergifte
14.7.2 Pflanzengifte
14.8 Häufig verwandte mineralische Einzelmittel
14.8.1 Arsen
14.8.2 Quarz (Kieselsäure)
14.8.3 Conchae (Calcium carbonicum)
14.8.4 Phosphor
14.8.5 Schwefel (Sulfur)
14.9 Häufig verwandte Heilpflanzen
14.9.1 Arnika
14.9.2 Ringelblume
14.9.3 Schachtelhalm
14.9.4 Lebensbaum
14.9.5 Literatur
14.10 Misteltherapie (Viscum album)
14.10.1 Iscador
14.10.2 Helixor
14.10.3 Abnobaviscum
14.10.4 Iscucin
14.10.5 Welches Präparat bei welcher Indikation?
14.10.6 Praktische Anwendung
14.10.7 Grenzen und Möglichkeiten der Misteltherapie
14.10.8 Wirtsbaumfrage
14.10.9 Literatur
14.11 Heileurythmie und künstlerische Therapien
14.11.1 Heileurythmie
14.11.2 Musiktherapie
14.11.3 Therapeutisches Malen und Plastizieren
14.11.4 Therapeutische Sprachgestaltung (Sprachtherapie)
14.11.5 Literatur
14.12 Diät
Teil IV Ausblick
15 Zukunftsaspekte der Medizin
15.1 Carl Gustav Carus
15.2 Vision einer zukünftigen Medizin
15.2.1 Soziales Menschenverständnis
15.2.2 Gedankenfreiheit
15.2.3 Wahre Geist-Erkenntnis
15.2.4 Literatur
16 Der sichtbare und der unsichtbare Mensch
16.1 Der sichtbare Mensch
16.2 Der unsichtbare Mensch
16.3 Literatur
17 Anregungen zu einer Schulung des Arztes
17.1 Wesentliche Inhalte für das Studium
17.1.1 Staunen
17.1.2 Verehrung
17.1.3 Einklang mit den Weltgesetzen
17.1.4 Ergebung in den Weltenlauf
17.1.5 Literatur
18 Wege zu einer christlichen Medizin
18.1 Christliches Menschbild
18.1.1 Christliche Ethik
18.1.2 Vom Heilen
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Allgemeiner Teil
1 Medizin in der Sackgasse – ihre Krise als Herausforderung
2 Erkenntnistheoretische Erwägungen
3 Allgemeine Menschenkunde (Physiologie)
4 Allgemeine Krankheitslehre (Pathologie)
1 Medizin in der Sackgasse – ihre Krise als Herausforderung
1.1 Historischer Rückblick
Geburtsstunde der modernen Medizin Sucht man nach der eigentlichen Geburtsstunde der modernen Medizin, die sich selber naturwissenschaftlich begründet sieht, so wird man diese in das Jahr 1858 legen können. In diesem Jahr veröffentlichte Rudolf Virchow in Berlin seine Cellularpathologie▶ [11]. Ihr lagen 20 Vorlesungen zugrunde, die er vor Berliner Ärzten zu diesem Thema gehalten hatte und die dann als Buch veröffentlicht wurden.
Der damit vollzogene Akt kann wohl zu Recht verglichen werden mit Martin Luthers Anschlag der 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirche 1517, die zur Reformation und damit Begründung der Evangelischen Kirche führten. Alles bisher in der Medizin Gültige wurde durch Virchows Thesen für ungültig erklärt, insbesondere die bis dahin noch vertretene Humoralpathologie (Rokitanski), die in letzter, schon dekadenter Weise die alte hippokratische Medizin in ihrer Säftelehre vertrat. Man muss mit Blick auf die Humoralpathologie von Dekadenz sprechen, da sie in der ursprünglichen Begründung ihre Wurzel in der griechischen Mysterienmedizin hatte, für die der Name Hippokrates wie stellvertretend für eine ganze medizinische Bewegung stand. Was davon im 19. Jahrhundert noch gelehrt wurde, war reine Abstraktion. So war es ohne Zweifel an der Zeit, dass mit einer solchen dekadenten Anschauung in der Medizin endgültig Schluss gemacht wurde. Dies geschah auf radikale Weise und unter Berufung auf die in diesem Jahrhundert so stark aufkommende Naturwissenschaft.
Vorbereitende Entwicklung der modernen Medizin Natürlich hat eine solche Geburtsstunde, die wir jetzt in das Jahr 1858 verlegen, auch ihre „vorgeburtliche“ Entwicklungszeit. Man kann auf Giovanni Battista Morgagni als den eigentlichen Begründer der pathologischen Anatomie verweisen, auch auf Friedrich Th. Schwann, der bereits 1839 den Nachweis führte, dass die Organismen von Tier und Pflanze auf dem Bauelement der Zelle beruhen. Man kann auf die Entwicklung des Mikroskops, dessen erste Wurzeln um das Jahr 1590 vermutet werden, ebenso blicken wie auf die revolutionierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse der Physik oder der Biochemie.
Zweidimensionalität des Menschen: Man wird für die vorbereitende Entwicklung der modernen Medizin im geschichtlichen Rückblick sogar noch auf ein viel weiter zurückliegendes, für die moderne Bewusstseinsentwicklung bedeutungsvolles Datum verwiesen. Im Jahr 869 n. Chr. fand in Konstantinopel ein Konzil der Kirchenväter statt, dessen Resultat in kürzester Form dahingehend zusammengefasst werden kann, dass dem Menschen die Existenz eines selbstständigen Geistes abgesprochen wurde. Bis dahin war es gültige Vorstellung, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist bestünde. Die Berechtigung dieser sog. Trichotomie wurde nun in der Diskussion der Kirchenväter auf dem Konzil von Konstantinopel angezweifelt. Als Ergebnis wurde dogmatisch festgelegt, dass der Mensch nur ein zweigliedriges Wesen sei, bestehend aus Leib und Seele, und dass der Seele lediglich einige geistige Eigenschaften zugesprochen werden könnten. Hatte die Menschheit bis dahin das Wirken des Geistes im Menschen, aber auch im Kosmos, unmittelbar wesenhaft erlebt, so schottet sich dieses Erlebnis immer stärker ab und führt schließlich zum völligen Verlust jeglichen Wissens geistiger Zusammenhänge von Mensch und Natur bzw. Kosmos, sodass diese immer stärker voneinander getrennt erlebt und wissenschaftlich untersucht wurden.
Nur ganz sporadisch treten in einzelnen Persönlichkeiten noch Erkenntnisse solcher Zusammenhänge auf, wobei für die Medizin als leuchtendes Beispiel Paracelsus gelten kann. Doch wurde dieser bereits von seiner Zeit nicht mehr verstanden und in seinen wesentlichen Aussagen eher verfolgt als anerkannt. Das naturwissenschaftliche Zeitalter wurde eingeläutet, und in der Medizin fanden sich nun als erste Auswirkungen die Beschäftigungen mit dem menschlichen Leichnam als Anatomie und anatomische Pathologie. In diese von Mitteleuropa ausgehende neue, sich der Naturwissenschaft zuwendende Medizin gingen starke Einflüsse der arabischen Medizin ein, die schon viel früher auf einem hohen, z.T. technischen und vor allem wissenschaftlichen Niveau stand und deren Inhalte uns heute noch verblüffen können, begreift man, dass diese Medizin nun mehr als tausend Jahre zurückliegt.
Eindimensionalität des Menschen: Alles, was seit dem Jahr 869 n. Chr. an neuen Entdeckungen, Erkenntnissen und wissenschaftlichen Methoden erforscht und dargestellt wird, kulminiert in dem Jahr 1858, das von uns als die eigentliche Geburtsstunde der modernen Medizin bezeichnet wird und die unauslöschlich mit dem Namen und der Person Rudolf Virchows verbunden ist. Seine Anschauung macht den Menschen zu einem eindimensionalen Wesen, d.h. reduziert seine Wirklichkeit auf den Leib, in dem nun auch keine selbstständige Seele mehr wirksam gedacht wird, sondern lediglich seelische Eigenschaften als Ausdruck der leiblichen Wirklichkeit. So wie 869 dem Menschen die Wirklichkeit jeglichen selbstständigen Geistes abgesprochen wurde, verliert er mit diesem Schritt auch die Wirklichkeit einer selbstständigen Seele.
Zelle als elementare Wirklichkeit des Menschen Die elementare Wirklichkeit des Menschen ist nach Virchow die Zelle. Sie enthält praktisch den ganzen Menschen in sich und der ganze komplizierte Aufbau des Menschen als Organismus ist nichts anderes als die Differenzierung und Variation des Prinzips der einheitlichen Zelle. Wörtlich heißt das bei Rudolf Virchow ▶ [11] so:
„Besondere Schwierigkeiten hat die Beantwortung der Frage gemacht, von welchen Teilen des Körpers eigentlich die Aktion ausgeht, welcher Teil tätig, welcher leidend ist; doch ist ein Abschluss darüber schon jetzt in der Tat vollständig möglich, selbst bei solchen Teilen, über deren Struktur noch gestritten wird. Es handelt sich bei dieser Anwendung der Histologie auf Physiologie und Pathologie zunächst um die Anerkennung, dass die Zelle wirklich das letzte eigentliche Formelement aller lebendigen Erscheinungen sei, und dass wir die eigentliche Aktion nicht über die Zelle hinaus verlegen dürfen.“
Er führt dann weiter aus, wie jede Zelle eigentlich einen ganz gleichartigen Aufbau mit den gleichen Strukturelementen erkennen lässt und der ganze komplizierte Aufbau eines Organismus lediglich Spezialisierung und Differenzierung des immer Gleichen ist:
„So gewinnt man ein einfaches, gleichartiges, äußerst monotones Gebilde, welches sich mit außerordentlicher Konstanz in den lebendigen Organismen wiederholt. Aber gerade diese Konstanz ist das beste Kriterium dafür, dass wir in ihm das eigentlich Elementare haben, welches alles Lebendige charakterisiert, ohne dessen Präexistenz keine lebendigen Formen entstehen, und an welches der eigentliche Fortgang, die Erhaltung des Lebens gebunden ist. Erst seitdem der Begriff der Zelle diese strenge Form angenommen hat, und ich bilde mir etwas darauf ein, trotz des Vorwurfes der Pedanterie stets daran festgehalten zu haben, erst seit dieser Zeit kann man sagen, dass eine einfache Form gewonnen ist, die wir überall wieder aufsuchen können, und die, wenn auch in Größe und äußerer Gestaltung verschieden, doch in ihren wesentlichen Bestandteilen immer gleichartig ist.“
Und später:
„Wenn eine bestimmte Übereinstimmung der elementaren Form durch die ganze Reihe alles Lebendigen hindurchgeht, und wenn man vergeblich in dieser Reihe nach irgend etwas anderem sucht, was an die Stelle der Zelle gesetzt werden könnte, so muss man notwendig auch jede höhere Ausbildung, sei es einer Pflanze und eines Tieres, zunächst betrachten als eine progressive Summierung einer größeren oder kleineren Zahl gleichartiger oder ungleicher Zellen. Jedes Tier scheint als eine Summe vitaler Einheiten, von denen jede den vollen Charakter des Lebens an sich trägt. Der Charakter und die Einheit des Lebens kann nicht an einem bestimmten Punkt der höheren Organisation gefunden werden, z.B. im Gehirn des Menschen, sondern nur in der bestimmten, konstant wiederkehrenden Einrichtung, welche jedes einzelne Element an sich trägt. Daraus geht hervor, dass die Zusammensetzung eines größeren Körpers immer auf eine Art von gesellschaftlicher Einrichtung herauskommt, einer Einrichtung sozialer Art, wo eine Masse von einzelnen Existenzen aufeinander angewiesen ist, aber so, dass jedes Element für sich eine besondere Tätigkeit hat, und dass jedes, wenn es auch die Anregung zu einer Tätigkeit von anderen Teilen her empfängt, doch die eigentliche Leistung von sich ausgehen lässt.“
Mechanische Gesetze des Lebens Die Zelle ist also das eigentliche Grundelement, die einfachste Einheit, sie beinhaltet alles Leben, sie wahrt die Kontinuität. Alle Lebewesen, auch der Mensch, sind nur vorstellbar als zusammengesetzt aus vielen solcher Zellen. Es ist ganz gleich, ob Pflanze, Tier oder Mensch, der Unterschied liegt mehr in der Art der Zellzusammensetzung, in ihrer Differenziertheit. Es handelt sich um eine ganz atomistische Betrachtung, um eine Betrachtung kleinster einzelner Teile, um von diesen her auf ein Ganzes zu schließen.
Merke
Das Besondere daran ist, dass sich dieses Studium ganz an totem Material abspielt, dass das Lebendige ganz in diesem Toten der präparierten Zellen eingeschlossen gedacht wird und es so notwendigerweise zum Schluss Virchows kommt, dass alles Leben auch mechanischen, also dem Toten unterliegenden Gesetzen folgt.
Dementsprechend hält Rudolf Virchow 1858 einen Vortrag auf einer Sitzung der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin, dessen Thema „Über die mechanische Auffassung des Lebens“ lautet. In diesem Vortrag erweist sich Virchow einmal mehr als der eigentliche Begründer der mechanistisch-materialistischen Medizin, die wir als die moderne Medizin bezeichnen und die im Anschluss an Virchow eine immer konsequentere Ausgestaltung gefunden hat. In dem zitierten Vortrag vertritt Virchow ▶ [11] noch einmal in geschliffenen Sätzen seine These:
„Der Gedanke von der Einheit des Lebens in allem Lebendigen findet in der Zelle seine leibliche Darstellung. Was man bloß in der Idee gesucht hatte, das hat man endlich in der Wirklichkeit gefunden; was vielen ein Traum erschien, das hat einen sichtbaren Leib gewonnen, es steht wahrhaftig vor unserem Auge da.“
Und später:
„Und so führt uns die Analyse aufwärts bis zu der feinen Einrichtung des Nervenapparates, wo die höchsten Eigentümlichkeiten des tierischen Lebens, Empfindung, Bewegungseinfluss, Denken, an bestimmten Gruppen zelliger Gebilde haften. Das Leben ist die Tätigkeit der Zelle, seine Besonderheit ist die Besonderheit der Zelle ... Ihre Tätigkeit wechselt mit dem Stoff, der sie bildet und den sie enthält; ihre Funktion ändert sich, wächst und sinkt, entsteht und verschwindet mit der Veränderung, der Anhäufung und der Abnahme dieses Stoffes. Aber dieser Stoff ist in seinen Elementen nicht verschieden von dem Stoff der unorganischen, der unbelebten Welt, aus dem er sich vielmehr fort und fort ergänzt und in den er wieder zurücksinkt, nachdem er seine besonderen Zwecke erfüllt hat. Eigentümlich ist nur die Art seiner Zusammenordnung, die besondere Gruppierung der kleinsten Stoffteilchen, und doch ist sie wiederum nicht so eigentümlich, dass sie einen Gegensatz bildet zu der Art der Zusammenordnung oder -gruppierung, wie sie die Chemie der unorganischen Körper lehrt. Eigentümlich erscheint uns die Art der Tätigkeit, die besondere Verrichtung des organischen Stoffes, aber doch geschieht sie nicht anders als die Tätigkeit und Verrichtung, welche die Physik in der unbelebten Natur kennt. Die ganze Eigentümlichkeit beschränkt sich darauf, dass in dem kleinsten Raum die größte Mannigfaltigkeit der Stoffkombinationen zusammengedrängt wird, dass jede Zelle in sich einen Herd der allerinnigsten Bewirkungen der allermannigfaltigsten Stoffkombinationen durcheinander darstellt, und dass daher Erfolge erzielt werden, welche sonst nirgend wieder in der Natur vorkommen, da nirgend sonst eine ähnliche Innigkeit der Bewirkungen bekannt ist. So besonders und eigentümlich, so sehr innerlich daher auch das Leben ist, so wenig ist es der Herrschaft der chemischen und physikalischen Gesetze entzogen. Vielmehr führt jeder neue Schritt auf der Bahn der Erkenntnis uns dem Verständnis der chemischen und physikalischen Vorgänge näher, auf deren Ablauf das Leben selbst beruht. Jede Besonderheit des Lebens findet ihre Erklärung in besonderen Einrichtungen anatomischer oder chemischer Art, in besonderen Anordnungen des Stoffes, der in dieser Anordnung seine ihm überall anhaftenden Eigenschaften, seine Kräfte äußert, jedoch scheinbar ganz anders als in der unorganischen Welt. Aber es scheint eben nur anders, denn der elektrische Vorgang im Nervensystem ist nicht von anderer Art, als der in dem Draht des Telegraphen oder in der Wolke des Gewitters; der lebendige Körper erzeugt seine Wärme durch Verbrennung, wie sie im Ofen erzeugt wird; Stärke wird in der Pflanze und im Tier in Zucker umgesetzt, wie in einer Fabrik, hier ist kein Gegensatz, sondern nur Besonderheit.“
Entsprechend der Vorstellungsweise der klassischen Physik, alle physikalischen und auch chemischen Erscheinungen auf mechanische Vorgänge zurückzuführen, kann Virchow die Lebenserscheinungen nur mechanistisch deuten:
„Diese Tätigkeit kann keine andere als eine mechanische sein. Vergeblich bemüht man sich, zwischen Leben und Mechanik einen Gegensatz zu finden.“
Reduktion des Lebendigen auf mechanisches Geschehen Im Weiteren führt Rudolf Virchow ▶ [11] aus, dass der menschliche Geist auch nicht in der Lage sei, das Leben in einer anderen Art als mechanisch zu erfassen, und er wehrt sich dagegen, dass der naturwissenschaftliche Forscher als Feind des Idealismus hingestellt werde, denn „wo hätte es jemals eine Philosophie gegeben, die mehr idealistisch gewesen wäre als die heutige Naturwissenschaft?“. Für ihn ist klar, dass solche Vorwürfe von mangelndem Idealismus lediglich aus dem Lager der Spiritualisten kommen können, egal ob diese ihn nun offen oder verkappt vertreten würden.
„Es ist ganz gleichgültig, ob man das organische oder das unorganische Schaffen betrachtet. Es ist kein Spiritus rector, kein Lebens-, Wasser- oder Feuergeist darin zu erkennen. Überall nur mechanisches Geschehen in ununterbrochener Notwendigkeit der Verursachung und Bewirkung.“
Dieser hier von Virchow vertretene Standpunkt wurde allgemeingültig. Es war die feste Überzeugung der Naturwissenschaftler im ausgehenden 19. Jahrhundert, dass auch alle Lebensfunktionen in Organismen rein mechanischen oder – damit identisch gemeint – physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten folgen würden. Alle bis in das 19. Jahrhundert vorgestellte Selbstständigkeit von Lebenstätigkeiten oder -vorgängen, die gegenüber der unorganischen Welt eigenen Gesetzen folgen, wurden abgestritten und als Mystifizierung einer nebulösen allgemeinen Lebenskraft bekämpft. Zwar relativierten große Vertreter der modernen Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts diesen absoluten Standpunkt; so verwies z.B. Adolf Butenandt darauf, dass sich das eigentliche Prinzip des Lebens der bisherigen naturwissenschaftlichen Methode entziehen müsse, da diese nur auf das Unorganische gerichtet sei. In der Praxis der Medizin jedoch setzte sich eindeutig der mechanistisch-materialistische Standpunkt durch.
Krise der modernen Medizin Natürlich wird man sagen, dass die radikalen Anschauungen Virchows heute bereits weitgehend überwunden seien und einer viel stärkeren funktionalen Betrachtungsweise Platz gemacht hätten. Doch zeigt gerade die Praxis unserer modernen Medizin, dass die radikale Reduzierung der Wirklichkeit Mensch auf einen komplizierten Leib mit physikalischen und chemischen Reaktionen, alles beruhend auf der Grundeinheit Zelle, nach wie vor das medizinische Denken und Handeln bestimmt. Wir werden das im Weiteren an der Dominanz des mechanistischen Standpunkts und dem dadurch bewirkten nur partiellen Fortschritt unserer derzeitigen Medizin am Beispiel der modernen Diagnostik und an der Krise ärztlicher Verantwortung verdeutlichen.
Inzwischen ist die naturwissenschaftliche Methode in der Medizin wesentlich um molekularbiologische und genetische Forschung erweitert worden. Beide sind heute beherrschende Forschungsfelder und werden die Zukunft medizinischer Entwicklung stark bestimmen. Das ändert jedoch nicht die grundsätzlich mechanistische Auffassung, welche die Medizin vom Menschen und seiner Physiologie hat. Er bleibt ein naturwissenschaftlich erklärbares, wenn auch komplexes Modell, das aus sich selbst steuernden chemisch-physikalischen Vorgängen als Automat funktioniert.
Diese Auffassung vom Menschen und die daraus abgeleitete Praxis hat die Medizin in eine seit Jahrzehnten andauernde Krisis geführt, aus der sie sich – ähnlich übrigens wie das Gesundheitswesen – nicht befreien kann. Sie baut immer neue Verteidigungsstrategien auf, um Kritik abzuwehren und Veränderungen zu verhindern. Im Denken und Handeln ist sie letztlich ganz dogmatisch geworden. Was Wissenschaft in der Medizin ist, wird von einer kleinen Anzahl sog. Experten bestimmt. Eine evidenzbasierte Medizin ist dafür typisches Beispiel.
Diese Krise oder auch Sackgasse wird überwunden werden können, wenn das von Virchow kühn Begonnene einer wissenschaftlich fundierten Medizin auf die Wirklichkeit oder Ganzheit Mensch Anwendung findet.
Leibliche, seelische und geistige Wirklichkeit des Menschen
Merke
Diese wissenschaftlich zu erfassende ganze Wirklichkeit des Menschen präsentiert sich uns – wie wir im Weiteren darlegen werden – in der Polarität zwischen einem individuellen Geist und einem aus dem Erbstrom gebildeten Leib sowie einer Seele, die in dieser Polarität ständig Mittlerin ist.
Was wir von dieser Wirklichkeit wissenschaftlich erfassen können, ist aber abhängig von der angewandten Methode. Wenn Virchow in seinen Forschungen das seelische und geistige Sein des Menschen nicht erkannte, wenn er sogar die Lebensprozesse auf ihre physikalischen und chemischen Manifestationen beschränkte, so lag das an der von ihm angewandten Wissenschaftsmethode. Wir wollen diese Methode die anorganische nennen, weil sie exakt nur die Vorgänge und Gesetzmäßigkeiten der unbelebten Natur erfasst. Soweit versucht wird, mit ihr auch die lebendige, seelische und geistige Wirklichkeit des Menschen zu erfassen, wie dieses seit Virchow allenthalben getan wird, so erfährt man lediglich, wie sich diese höheren Wirklichkeiten im physikalischen und chemischen Dasein manifestieren. Man erforscht die Fußspuren, aber nicht das sie im Schreiten bewirkende Wesen selber.
Das Unglück der Forscher des 19. Jahrhunderts war, dass sie die anorganische Methode für die einzige wissenschaftliche Vorgehensweise hielten; eine Entwicklung, die bereits mit Isaac Newton begann und die durch Immanuel Kant eine scheinbare erkenntnistheoretische Rechtfertigung erhielt. Im erkenntnistheoretischen Werk Rudolf Steiners sind – anknüpfend an die naturwissenschaftliche Denkweise Goethes – die von Kant postulierten Erkenntnisgrenzen überwunden worden. Wir werden uns darum auch mit den erkenntnistheoretischen Einsichten befassen müssen, um zu zeigen, wie eine Erweiterung der Naturwissenschaft in die Erkenntnisbereiche der vitalen und der animalischen Wirklichkeit möglich ist und wie mit entsprechenden Methoden durch eine Geisteswissenschaft die Wirklichkeiten der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes erforscht werden können (Kap. ▶ 2).
1.2 Mechanistischer Standpunkt und Fortschritt der Medizin
Scheinbare Gültigkeit der mechanistischen Betrachtungsweise Die Berechtigung zur Anwendung der anorganischen Methode auch in der medizinischen Forschung scheint durch deren Resultate erwiesen zu sein. Denn es haben sich unzählige physikalische und biochemische Vorgänge im menschlichen Organismus methodisch einwandfrei nachweisen, messen und in ihrer Funktion oder Dysfunktion beobachten lassen. Das gilt z.B. für die Erforschung von elektrischen Vorgängen, die in der Diagnostik zur Entwicklung der Elektrokardiographie, Elektroenzephalographie oder Elektromyographie führten. Das gilt auch für die Beobachtung von Ionenbewegungen im extra- und intrazellulären Raum und den damit verbundenen heutigen Vorstellungen, durch die entscheidende energetische, elektrophysiologische Vorgänge von Zell- und Gewebefunktionen verständlich wurden. Oder denken wir an die chemischen Katalysatorfunktionen der Enzyme und die biochemische Vermittlerfunktion der Hormone. Unendliche solcher Beispiele beweisen zunächst die Richtigkeit, physikalische und chemische Gesetzmäßigkeiten auch in der Medizin auf die Funktion und das Verständnis des menschlichen Organismus als Leib anzuwenden.
Mechanistische Sichtweise am Beispiel der Gelenke Besonders gut ausgebildet werden kann der mechanistische Standpunkt am Skelett und an den menschlichen Sinnesorganen wie Auge und Ohr. Die Gelenke scheinen rein mechanisch zu funktionieren, ob als Scharniergelenk im Knie oder als Kugelgelenk in Hüfte und Oberarm. Häufig kann man heute sogar lesen, dass die Gelenke an sich, verglichen mit der modernen Welt der Maschinen, eher als Fehlkonstruktionen bezeichnet werden könnten, da man bei Anwendung rein mechanischer Gesetzmäßigkeiten zu anderen Konstruktionen käme. Diese gedankliche Konsequenz der Anwendung mechanistischer Gesetze auf das Verständnis der Gelenkfunktionen führte zur Nachbildung künstlicher Gelenke und begründete das große Gebiet der Gelenkchirurgie mit dem Austausch verschlissener, degenerierter Gelenke gegen Kunstgelenke.
Dem aufmerksamen Beobachter mag aber eine Fülle von Fragen auftauchen, die gerade mit Bezug auf den Vergleich der Funktion natürlicher Gelenke gegenüber künstlichen erlebbar werden können. Da ist z.B. die auffällige Mittelstellung der meisten menschlichen Gelenke gegenüber der im Allgemeinen viel höheren Spezialisierung im Tierreich zu beachten, die dem Menschen Gelegenheit gibt, gegenüber einseitiger Spezialisierung eine Vielfalt von Funktionsmöglichkeiten praktizieren zu können. Dann kann die erhebliche Schwierigkeit im Bilden künstlicher Gelenke auffallen, wenn wir beispielsweise an das menschliche Ellenbogengelenk denken. Da ist zum anderen die (gegenüber einer solchen scheinbar mangelhaften Konstruktion) erstaunliche „Haltbarkeit“ natürlicher Gelenke. Ist es nicht gegenüber der ganzen technischen Welt unserer Maschinen ein Wunder, dass derart belastete Gelenke, wie z.B. die der unteren Gliedmaßen, im Allgemeinen und bei normaler („natürlicher“) Belastung ein ganzes Menschenleben funktionstüchtig bleiben? Ist demgegenüber die immer mehr verbesserte Haltbarkeit künstlicher Gelenke nicht dennoch deutlich unterlegen?
Mechanistische Sichtweise am Beispiel von Auge und Ohr Als weiterer Bereich konsequenter Anwendung mechanistischer Vorstellungen wurden Sinnesorgane wie Auge und Ohr genannt. In der Tat bieten sich beide Organe sehr stark für eine Charakterisierung als physikalische Apparate an. So wird das Auge im Wesentlichen als Camera obscura verstanden, das Ohr findet im Mikrophon seine technische Nachahmung. Es steht außer Frage, dass in beiden Organen Phänomene zu beobachten sind, welche physikalischen Vorgängen entsprechen. Doch gerade an Auge und Ohr lässt sich wieder vom Standpunkt des aufmerksamen und vorurteilslosen Menschen eine Fülle von Fragen stellen, die die ausschließliche Begrenzung dieser Organe auf physikalische Apparaturen zweifelhaft macht:
Wo liegt denn der Sprung, der ein quasi passiv auf den Augenhintergrund geworfenes Bild zum Erlebnis werden lässt; inwieweit entspricht es nicht überwiegend einer willenhaften Intention, etwas zu sehen oder es eben nicht zu sehen?
Ist es nicht gerade ein Phänomen unserer modernen Zeit, dass die Menschen nur noch so wenig von ihrer Umwelt wahrnehmen, obwohl doch das Auge als physikalischer Apparat sicher nicht schlechter geworden ist?
Wie ist es mit den subjektiven Nuancierungen des Gehörten, sei es im menschlichen Gespräch, sei es im Anhören eines Konzerts?
Solche Fragen sollen nicht als Hinweis verstanden werden, dass der mechanistische Standpunkt falsch sei, sie sollen lediglich die Ausschließlichkeit dieses Anspruchs in Frage stellen und überleiten zu dem Angebot einer Menschenkunde, die neben den physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten im menschlichen Organismus auch die der ihnen übergeordneten Lebensprozesse sowie der seelischen und geistigen Tätigkeit des Menschen beschreibt.
Fortentwicklung der Medizin durch erweiterte Menschenkunde Dass eine solche erweiterte Menschenkunde für die konsequente Fortentwicklung der modernen Medizin unerlässlich ist, wird deutlich, wenn wir uns fragen, worin diese gegenwärtige Medizin fortschrittlich ist. Zweifellos ist sie das auf dem Felde der technischen Medizin, also dem Gebiet, das unmittelbar mit dem mechanistischen Denkansatz korrespondiert:
Wenn die moderne Medizin mit Virchow den elektrischen Vorgang im Nervensystem als von nicht anderer Art als in dem Draht des Telegraphen erlebt, ist der Herzschrittmacher eine logische Konsequenz dieser Vorstellung.
Wenn der Umsatz von Stärke auch in lebendigen Organismen wie in einer Fabrik geschieht, kann bei entsprechender Störung die Insulinpumpe als vernünftige Lösung bezeichnet werden.
Wenn das Herz nichts anderes als eine technisch an sich unzureichende Pumpe ist, ist die Entwicklung eines Kunstherzens praktische Konsequenz.
Gleiches kann aber nicht für die anderen Felder medizinischen Wirkens gesagt werden. So beschränken sich die Fortschritte in der inneren Medizin auf das Gebiet der Akut- und Notfallmedizin, während das Heer der chronischen Krankheiten immer mehr als echte, vor allem therapeutische Crux der Ärzte gelten muss.
Merke
Insgesamt muss der große Widerspruch auffallen, dass trotz aller Fortschritte in der Medizin die Menschheit kaum gesünder geworden ist.
Trotz zunehmender Zahlen niedergelassener Ärzte oder auch von Krankenhausärzten werden die Sprechzimmer und die Krankenhäuser immer voller, wobei eine gravierende Verlagerung von akuten zu chronischen Krankheiten stattgefunden hat und gleichzeitig auch anstelle der früher so gefürchteten Infektionskrankheiten heute eine ähnlich epidemische Entwicklung von Sucht- und Zivilisationskrankheiten beobachtbar ist.
Die größte und tiefgreifendste Problematik müssen wir jedoch darin erkennen, dass die rein mechanistische Auffassung vom Menschen dazu geführt hat, dass die Medizin ihn immer extremer und durchaus bewusst manipuliert.
Bildet er zu viel Magensäure, wird diese chemisch gehemmt. Reagiert das Herz zu stark auf adrenerge Reize, werden sie blockiert. Nie wird gefragt, in welcher Art ein gut reguliertes System durch solche von außen kommenden Eingriffe reagiert, unerwünschte Reaktionen (sog. Nebenwirkungen) werden als unvermeidbar akzeptiert und denkbare Langzeitfolgen erst gar nicht diskutiert. Diese Denkrichtung ist so bestimmend, dass sie inzwischen eher den Menschen verändern will als ihr Vorgehen.
So führte beispielsweise in einem Übersichtsartikel zur aktuellen Lage der Hochdrucktherapie der dort postulierte Anteil von 60 % Non-Respondern zu der Forderung, diese genetisch so zu verändern, dass auch sie zu Respondern mutierten. Nicht die Medikamente waren unvollkommen, sondern der Mensch! Mag dieses auch eine extreme Formulierung sein, so ist sie dennoch ein typischer Ausdruck der charakterisierten mechanistischen Auffassung. Sollte eine Tür zu groß für die montierte Fassung sein, wird man sie ja auch auf die passende Größe stutzen („hobeln“).
1.3 Statistik und der Durchschnittsmensch: zur Frage der Diagnostik
Merke
Als Krone aller Wissenschaften wird heute die Mathematik angesehen und schon Kant sprach aus, dass in jeder einzelnen Wissenschaft nur so viel wirkliche Erkenntnis stecke, als in ihr Mathematik vorhanden sei.
Der mathematisierte Mensch Zunächst mag es abwegig erscheinen, den Menschen zu mathematisieren oder ihn als mathematische Größe und Gleichung beschreiben zu wollen, und so hat es auch relativ lange gedauert, bis die Mathematik in der Medizin Fuß fasste. Sie tat dies in der Form der Statistik, also einer besonderen Ausgestaltung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Resultate statistischer Methoden spiegeln Mittelwerte wider, die durch die Standardabweichungen in ihrer Genauigkeit bezeichnet werden, die aber immer einen Durchschnitt meinen. Der einzelne Mensch findet sich also nur in einem mehr oder minder gespreizten Verteilungsfeld wieder, mathematisch ausgedrückt in einer Gauß-Verteilungskurve. Alle Beurteilung des Menschen bzw. des menschlichen Organismus geht nun von solchen Durchschnittswerten aus, die durch Untersuchungen großer Zahlen ermittelt werden. Diese Durchschnitts- oder Mittelwerte ergeben die Norm, d.h. das Normale.
Bemerkenswert ist dabei die Feststellung, dass in der Medizin diese Normalität über das Feld der rein leiblichen Phänomenologie hinaus auch in das seelische Gebiet Eingang fand und z.B. für die Psychiatrie sog. seelische Normen schuf. Schaut man einmal in ein modernes Lehrbuch der Psychiatrie und sucht dort die Beschreibung des normalen seelischen Lebens der Menschen, so wird wohl jeder von uns die Erfahrung machen, dass er sich in einer solchen Normalität nicht wieder findet. Das kann auch gar nicht sein. Denn eine Normale, die als ein Durchschnittswert gewonnen wird, ergibt nur quantitative Aussagen; alles Qualitative kann mit ihrer Hilfe nicht beurteilt werden.
Merke
Für qualitative Aussagen muss als Normale ein Typus gewonnen werden. Nur wenn die Aussage möglich ist, inwieweit ein Erscheinungsbild, ein Ereignisverlauf typisch ist, können Urteile über Tatsachen im Lebendigen und im Seelisch-Geistigen, also auch diagnostische Urteile, in wissenschaftlich angemessener Weise gefällt werden. Da aber jeder Patient eine Individualität ist, genügt auch das Urteil, inwieweit etwas typisch ist, noch nicht für den ganzen Menschen. Denn als individuelle Person hat jeder Mensch seine eigene Normale. Darum ist – wie später noch näher ausgeführt werden wird – für die medizinische Diagnose fast immer auch ein biografisches Urteil unerlässlich.
Auswirkungen der Statistik Wesentliche Auswirkungen der Statistik finden wir in der Medizin zunächst in der immer größer werdenden Skala messbarer Befunde. An der Spitze steht sicher die gesamte Labordiagnostik, die in unendlicher Fülle messbare Befunde einzelner Organfunktionen untersucht:
Wie differenziert ist heute beispielsweise eine Aussage über die Leber und ihre Funktion anhand der Labordiagnostik zu machen!
Wie viel sicherer ist beispielsweise ein Herzinfarkt durch die Labordiagnostik beweisbar als durch das Elektrokardiogramm!
Welche Differenzierung der verschiedenen Stadien oder Ursachen akuter Hepatitiden bietet die moderne Hepatitisserologie!
Von den einfachen Untersuchungen der Blutsenkung, des Blutbildes oder Harnsediments bis zu hoch komplizierten immunologischen Befunden reicht die Skala solcher Beschreibbarkeiten des Menschen im Detail, wie sie wohl kein Arzt in seiner Diagnostik mehr missen möchte.
Aber nicht nur die Labordiagnostik liefert solche objektiven, messbaren Ergebnisse. Auch die Röntgendiagnostik, die Elektrokardiographie, die Ultraschalldiagnostik, moderne radiologische Verfahren wie Szintigraphie, Computertomographie oder Kernspintomographie kennzeichnen den Weg der modernen Medizin zu der heute möglichen, kaum noch überschaubaren Vielfalt von Erkennbarkeit und Darstellbarkeit normaler oder anormaler Verhältnisse im menschlichen Organismus.
Detaillierte Aussage und Erfassung des gesamten Menschen Jeder praktizierende Arzt weiß aber, wie schwierig es ist, die Fülle dieser detaillierten Aussagen zu einem diagnostischen Urteil zusammenzufassen, und zwar so, dass es dem jeweils besonderen Patienten angemessen ist.
Merke
Es müssen dafür die einzelnen quantitativen Daten in der zuvor angedeuteten Weise unter den qualitativen Bestimmungen des jeweiligen Krankheitstypus und unter den individuell-biografischen Gegebenheiten des besonderen Patienten subsumiert werden, damit ein zusammenfassendes Bild entsteht.
Goethe nannte eine solche Erkenntnisweise „anschauende Urteilskraft“. Wie das Gesicht eines Menschen uns zum Antlitz, zur Physiognomie, wird, indem wir nicht an allen Einzelheiten hängen bleiben, sondern sie zu einem Bild zusammenschauen, wird uns in diesem Begriff anschaulich. Wovon dieses Antlitz spricht – Alter, Geschlecht, Charakter, besondere seelische Gestimmtheit usw. – erleben wir als Einheit, nicht als addierte Summe von Einzelheiten. Entsprechend müssen wir die Vielzahl diagnostischer Daten physiognomisch zusammenschauen, um in diesem Bilde den sich darin aussprechenden Krankheitstypus und seine individuelle Ausprägung zu erkennen. Wie die Befähigung zu einer solchen physiognomischen Methode als Grundlage einer ganzheitlichen Diagnostik erübt werden kann, wird uns später beschäftigen. Sie hat – das wird schon jetzt erkennbar geworden sein – auf jeden Fall eine medizinische Menschenkunde zur Voraussetzung, die auf die Erfassung des ganzen Menschen gerichtet ist.
Objektiver Befund und subjektives Leiden Als erkenntnistheoretisches Ergebnis wird heute in der Medizin der „objektive Befund“ postuliert und deutlich von allen subjektiven Befindensäußerungen abgesetzt. Hier zeigt sich wieder das Problemfeld der Einseitigkeit: Achtet man in der Betroffenheit der unmittelbaren Begegnung von Arzt und Patient auf die Stellung des subjektiven Leidens im Verhältnis zu den sog. objektiven Befunden, so wird man kaum anders entscheiden können, als ersteren den höheren Stellenwert im Rahmen der menschlichen Existenz zuordnen zu müssen. Es ist ganz selbstverständlich, dass der leidende Mensch größeren Wert darauf legen wird, eine Änderung seiner „subjektiv“ empfundenen Befindensstörung zu erfahren, als bei Fortbestehen derselben den dann kaum tröstenden Hinweis auf Besserung objektiver Befunde zu hören. Und die oft erstaunliche Diskrepanz subjektiver Befindensstörungen und objektiver Befunde ist allgemein bekannt. So erleben wir als Folge der Überbetonung des Wertes objektiver Befunde eine starke Verminderung der Gewichtigkeit des subjektiven Befindens und bemühen einmal mehr den heute viel zu findenden Kritikpunkt, die moderne Medizin sei unmenschlich.
Beurteilung von Arzneimittelwirkungen Ganz extrem erlebbar wird diese einseitige Bewertung objektiver Befunde in der Beurteilung von Wirksamkeit und Unwirksamkeit von Therapien. Immer noch gilt für eine große Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern lediglich der kontrollierte, möglichst doppelblinde Versuch als wissenschaftlich aussagefähig für die Beurteilung einer Therapie, während eine Aussage am einzelnen Patienten wissenschaftlich völlig unhaltbar erscheint.
Merke
Auch hier begegnen wir alltäglich einer erstaunlichen Diskrepanz, insofern beispielsweise sog. unerwünschte Arzneimittelwirkungen oder -nebenwirkungen über den Einzelfall erfasst und auch zentral gemeldet werden sollen, während solches Vorgehen für die „positive“ oder gewünschte Arzneimittelwirkung keinerlei Anerkennung findet.
Auch wird im Rückschluss der methodischen Forderungen einer streng naturwissenschaftlichen Medizin eine solche über den Einzelfall beobachtete Nebenwirkung keineswegs über eine groß angelegte kontrollierte Studie bestätigt, wobei natürlich klar ist, dass ein solches Vorgehen moralisch-ethisch nie vertretbar wäre. Muss man dann aber nicht zu dem Eingeständnis kommen, dass unerwünschte Arzneimittelwirkungen mit diesem methodischen Ansatz nie erfassbar werden, da auf sie eben der kontrollierte, doppelblinde Versuch nicht anwendbar ist? Sind dann die mit dieser Methode gewonnenen Aussagen über die gewünschte Arzneimittelwirkung nicht ebenfalls infrage zu stellen?
Für den praktizierenden Arzt ist es ein alltägliches Erlebnis, dass die solcherart gewonnenen Therapieergebnisse auf den einzelnen „wirklichen“ Patienten nur mit einer durch das Signifikanzniveau definierten Wahrscheinlichkeit übertragbar sind. Deshalb sprach Ivan Illich auch davon, dass in der naturwissenschaftlich orientierten Medizin jede konkrete Therapie ein immer neues Experiment darstelle. Und Zyniker haben den Satz formuliert, dass in der statistisch bewerteten „evidenten“ Medizin „die Ärzte immer dann besonders genau zu sehen glauben, wenn sie doppelblind untersuchen“.
Falsifizieren und Verifizieren Das methodische Ziel dieser Wissenschaftsform ist das Falsifizieren und nicht das Verifizieren. Das Verwerfen einer Null-Hypothese, nicht aber der Wirklichkeitsbeweis einer Idee ist methodisches Prinzip. Insofern wird als Ergebnis immer nur eine prozentual beschriebene Wahrscheinlichkeit stehen, die Wirklichkeit oder Wahrheit ist dagegen nicht erfassbar. Diese wird auch nicht gesucht. Das Ziel ist es, „den Irrtum so weit als möglich zu vermeiden“ ▶ [4]. Auch hier zeigt sich wieder die Philosophie des Materialismus, wie sie von Kant ihren Ausgang nimmt, durch Popper eine moderne Fortsetzung und in der Behauptung von den Grenzen menschlicher Erkenntnis ihr Postulat fand. Wir sagten bereits, dass diese erkenntnistheoretische Überzeugung einen starken Einfluss auf die Medizin genommen und ganz wesentlich dazu beigetragen hat, die Virchow’sche Denkungsart in der Medizin als gültige Anschauung zu verankern.
Wie schon im vorangegangenen Kapitel müssen wir uns auch hier bewusst machen, dass eine immer größere Vernetzung existiert, sich den Menschen entsprechend den postulierten Normvorstellungen zurechtzuschneiden. Das heißt im Klartext, sich einen Normmenschen zu schaffen, einen Homunculus, der sich in einer Vielzahl identisch verhält. Alle Klonisierungsforschung läuft in diese Richtung, wenn auch noch nicht so eindeutig ausgesprochen. Gehen bestimmte Tierexperimente nicht in der gewünschten Richtung voran, schafft man sich ein genetisch mutiertes Tier, das dann entsprechend reagiert („Gen-Maus“). Existieren noch ethische Hemmungen, beim Menschen ebenso zu handeln? Ist nicht das Beispiel der Unzufriedenheit mit der etablierten ▶ Hochdrucktherapie hierfür warnendes Beispiel?
Das Wissenschaftsgebiet der Immunologie beweist, dass der natürlich existierende Mensch individuell geprägt ist, bis in seine Stofflichkeit der Gewebe hinein. Der schwedische Immunologe Hans Wigzell, Professor für Immunologie am Karolinska Institut Stockholm, formulierte das auf einem Kongress in Järna 1994 ganz präzise: „Alle Fakten der Immunologie zeigen, dass jeder Mensch ein einzigartiges Immunsystem hat, von dem es keine Kopie gibt!“ Das beweist (ungewollt) auch die Organtransplantationsmedizin.
Merke
Woher nimmt die Medizin das Recht, die Individualität durch eine Norm zu verdrängen?
Und müssen nicht die praktizierenden, dem Menschen täglich begegnenden Ärzte hier einer Wissenschaft Einhalt gebieten, welche mit großer Wahrscheinlichkeit eines späteren Tages genauso wie die Forschung der Atomenergie sagen muss: „Wir wussten nicht, welche Konsequenzen unsere ‚reine‘ Forschung für die Menschheit haben wird“?
1.4 Der bestimmte Mensch (Genetik): Krise ärztlicher Verantwortung
Der Mensch, ein Produkt von Natur- und Erbgesetzen? Folgt man konsequent Virchows Vorstellung von der Zelle als Einheit, in der alles bereits enthalten ist, so muss man in ihr auch die gesamte Bestimmung des einzelnen Menschen finden. Das ist anscheinend auch durch die Entdeckung der Erbgesetze und damit der Begründung der Genetik gelungen. Denn durch die Anordnung der Chromosomen und vor allem der einzelnen Gene ist jeder Mensch „bestimmt“; der Mensch scheint also eine zufällige Kombination aus den genetischen Merkmalen seiner Vorfahren, ein Produkt von Natur- oder Erbgesetzen zu sein.
In Bestätigung einer solchen Anschauung hat man eine ganze Reihe von Erbkrankheiten zum Beispiel als Folgen von Chromosomenaberrationen gefunden, wie die Bluterkrankheit, das Down-Syndrom oder andere. Man glaubt, eine Fülle von Hinweisen auf Erbanlagen für die Disposition zu bestimmten Krankheiten entdeckt zu haben und hat als moderne Variante dieser wissenschaftlichen Anschauung z.B. die HLA-Typisierung entwickelt. Man kann ohne jede Einschränkung sagen, dass die moderne Genetik heute eine wesentliche Forschungsrichtung für die Ursachen von Krankheiten geworden ist oder dass genetische Ursachen bei einer Fülle von Krankheiten, deren eigentliche Ursachen bisher noch unbekannt sind, diskutiert werden.
Naturwissenschaft versus Freiheit Mit gleicher Konsequenz, mit der sich aus der von Virchow praktizierten Denkungsart die Fragen der Genetik ergaben, folgt aus ihr auch, warum der Mensch in der modernen Medizin nur noch als Objekt erfasst werden kann, warum jede Sicht auf den Menschen als Individualität verloren gehen musste. Es war ganz besonders der französische Biologe und Philosoph Jacques Monod, der sich genötigt sah, Zufall und Notwendigkeit zu den eigentlichen Bestimmungsgrößen des Menschen zu erklären; denn in einer genetischen Auffassung vom Menschen ist kein Raum für Individualität und Freiheit.
Schäfer hat das einmal so formuliert:
„Die Misere der Krankenhausmedizin, ihr Unvermögen, den Patienten in seiner Einmaligkeit zu erfassen und ihm dadurch raten und helfen zu können, ist das notwendige Ergebnis ihrer rein naturwissenschaftlichen Fundierung.“ ▶ [9]
Oder Alexander Mitscherlich:
„Wer sich heute in ein Krankenhaus begibt, darf seine Persönlichkeit nicht mitnehmen, fast so wenig, wie wenn er in die Kaserne einrückt oder ins Gefängnis verbracht wird. Allen ist die Angst vor der Heilorganisation, die sie verschlucken will, ins Gesicht geschrieben.“ ▶ [6]
Wahrscheinlich sind viele Menschen, die als Ärzte, Pfleger, Therapeuten oder in anderen Aufgabenbereichen der Medizin arbeiten, sich einer Diskrepanz unserer Zeit gar nicht bewusst. Auf der einen Seite wird ein immer stärkerer Freiheitsdrang in jedem einzelnen Menschen mit allen seinen problematischen sozialen Folgen erlebbar, und andererseits muss die Naturwissenschaft in Bezug auf den Menschen eine solche Möglichkeit zur Freiheit völlig leugnen.
Genetik und Ethik Der Angriff auf die menschliche Individualität und ihre Selbstbestimmung geht aber noch viel weiter. Schon 1964 verwies Richard Kaufmann in seinem Buch Die Menschenmacher. Die Zukunft des Menschen in einer biologisch gesteuerten Welt auf die brennende Thematik, inwieweit der Mensch bei Anwendung der genetischen Gesetzmäßigkeiten manipuliert werden könne.
Merke
Heute steht die Genetik vor der gleichen Problematik wie vor dem Zweiten Weltkrieg die Atomphysik, indem nämlich Wissenschaft in einem scheinbar moralfreien Raum stattfindet und sich nicht bewusst sein will, wie leicht solche Forschungsergebnisse dann in praktischen und vor allem politischen Lebensbereichen Anwendung finden können.
Werden auch die genetischen Forscher eines Tages zu der Aussage kommen müssen: „Das haben wir nicht gewollt!“? Heute steht die Genetik insbesondere an dem menschlichen Grenzbereich der Geburt und trifft bereits Entscheidungen, die wahrscheinlich nur durch den mechanistischen Standpunkt der Naturwissenschaft erklärbar oder verstehbar sind. Ist man sich denn bewusst, wie nahe man heute mit der Möglichkeit, Erbstörungen oder Missbildungen bereits embryonal diagnostizieren und damit das Geborenwerden solcher Menschen verhindern zu können, dem medizinischen Tätigkeitsfeld ist, das während des Nationalsozialismus in Deutschland „unwertes Leben“ beseitigte? Auch diese Frage soll nicht als persönliche Kritik an den Wissenschaftlern verstanden werden, sondern lediglich als das Aufwerfen und Bewusstmachen einer speziell in der Medizin unserer Zeit brennenden Erkenntnisfrage.
Körperliche oder seelische Behinderung Vor allem müssen wir auf den möglichen Sinn einer körperlichen oder seelischen Behinderung im Leben eines Menschen ganz neu achten. Existiert nur die Anschauung eines behinderten Menschen als defekter Leib, kann man diesen konsequenterweise austauschen oder entwerten. Findet man aber Zugang zu einer Sicht des Menschen als einer sich in einem Leibe verwirklichenden geistigen Individualität, so wird man zu ganz anderen Konsequenzen kommen müssen.
Merke
Ist – vielleicht zunächst als Arbeitshypothese – der Gedanke unmöglich, dass sich eine Individualität den Widerstand einer Behinderung sucht, um daran ganz besondere Kräfte gewinnen zu können, die sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in einem späteren neuen Leben, zum Nutzen aller Menschen einbringen kann? Nehmen wir vielleicht der Menschheit aus Unkenntnis wichtige, für ihre Entwicklung unverzichtbare Zukunftskräfte, wenn wir die Behinderungen ausmerzen? Ist dieser vermeintliche Segen in Wirklichkeit ein Fluch für die Menschheit?
Gesetze des individuellen menschlichen Geistes Es ist ja heute darstellbar, wie gering eigentlich die Unterschiede tierischer von dem menschlichem Genom sind. Kann aber ernsthaft auch nur ansatzweise übersehen werden, wie gewaltig die Unterschiede zwischen dem Mensch als Homo sapiens und selbst hoch entwickelten Säugetieren sind? Und kann ebenso übersehen werden, wie groß die Unterschiede interindividuell sind, z.B. bei den Geschwistern einer gemeinsamen genetischen Voraussetzung durch Mutter und Vater? Der Gedanke liegt doch viel näher, dass das Genom eine Fülle von möglichen Voraussetzungen schafft, durch die sich die Individualität Mensch, die hier geistiger Natur gedacht wird, ihre Verwirklichungen bildet, vergleichbar dem Instrument und dem darauf musizierenden Virtuosen. Das erklärt doch auch genetische Mutationen (= Veränderungen) viel besser, als nur dem Zufall alles zu überlassen.
In welcher Weise und Verantwortlichkeit hier durch die Medizin manipulierend eingegriffen werden darf, ist eine Frage einer gemeinsam entwickelten und verbindlichen Ethik und damit auch des Gewissens. Das Gewissen ist in seiner Wirksamkeit aber vom Wissen abhängig. Darum konnte Jesus Christus vom Kreuze sprechen: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Wir aber können heute wissen, wir können mit gleicher Klarheit und Konsequenz, mit der wir die anorganische Natur des Menschen erforschen, mit der wir die genetischen Gesetzmäßigkeiten zu erfassen suchen, auch danach streben, die Gesetze des individuellen menschlichen Geistes zu erkennen. Gerade eine medizinische Menschenkunde muss sich fragen,
ob der einzelne Mensch sein eigenes inneres Gesetz (Schicksal) hat,
ob es für ihn eine geistige (göttliche) Führung gibt und
wie diese sich im Lebensverlauf, in seiner Biografie, manifestieren.
Hier leuchten die beiden Gesetzmäßigkeiten auf, die durch die Anthroposophie gegenüber alten Geisteswissenschaften für unsere Zeit neu formuliert wurden:
das Gesetz der wiederholten Erdenleben (Reinkarnation) und
das Schicksalsgesetz (Karma).
Beide Gesetze sind zentrale Aussagen der Anthroposophie und auch für eine Ergänzung unserer modernen Medizin unverzichtbar, wenn sie wieder zu einer Erfassung der Einmaligkeit jedes Menschen und seiner Biografie und zu einer moralischen Verantwortung für den Menschen und die Menschheit kommen will.
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, die anthroposophische Begründung dieser beiden Gesetzmäßigkeiten darzustellen. Sie werden nur in manchen Kapiteln anklingen, liegen aber als Anschauung der ganzen Darstellung zugrunde. Der Leser mag sich durch die angegebene ▶ Literatur mit diesem Thema ausführlicher beschäftigen.
Krankheit als innere Herausforderung Das Einbeziehen solcher Anschauungen wird jedoch eine ganz neue Qualität des medizinischen Gewissens herbeiführen, wird bewirken, dass manches, was heute getan werden kann, aus innerer Notwendigkeit unterbleibt oder anders getan wird.
Merke
Ihre ganze Wirksamkeit wird diese neue Qualität ärztlicher Verantwortung erst erlangen, wenn in der unserer Zeit angemessenen Klarheit neu erkannt wird, was ein altes Wissen war: dass der Mensch ein Werdender ist und dass der innere Antrieb für dieses lebenslange Werden in der Natur seines individuellen Geistes begründet liegt. Rudolf Steiner formulierte: „Man wird den Menschen nicht verstehen, wenn man ihn nicht als Werdenden sieht.“
Aristoteles nannte darum diesen menschlichen Geist Entelechie, d.h., das uranfänglich und fortdauernd zur Vollendung Strebende. So gesehen sind alle Schicksalsschläge für den Menschen Herausforderungen, sind Hilfen zur Weiterentwicklung. So sind Krankheiten nicht nur Last und Übel, sondern auch Aufgaben. Der Arzt wird die Therapie so einrichten müssen, dass der Patient nicht nur körperlich geheilt wird, sondern dass es ihm auch gelingt, die in seiner Erkrankung gelegene innere Herausforderung anzunehmen und zu bestehen.
1.5 Krise der Medizin
Die Charakterisierung der Konsequenzen der wissenschaftlichen Denkungsart Virchows in der Medizin soll mit zwei Zitaten eines modernen Physikers abgerundet werden, die zu diesem Kapitel über die Krise der modernen Medizin überleiten und den Blick auf eine mögliche Lösung der Krise durch die Anthroposophie öffnen. Klaus Müller, Physikprofessor in Braunschweig, schreibt in dem Kapitel „Die Aporien der Physik und die Krise der Medizin“ in seinem Buch Wende der Wahrnehmung▶ [8] folgende Einleitung und Ausleitung:
„Die Behauptung, dass sich die Medizin in einer Krise befinde, wird vielleicht nicht unwidersprochen bleiben. Den in ihr Tätigen mag der offensichtliche Fortschritt in den Techniken und Inhalten von Diagnose und Therapie als zureichendes Indiz erscheinen, dass man es hier mit einem Bereich vitaler Entfaltung zu tun habe, für den eine Krise zu diagnostizieren schwer falle. Wer so reagiert, der denkt zunächst einmal an die naturwissenschaftliche Medizin: und in der Tat begegnet uns hier bereits ein erstes Mal der Umstand, dass die Medizin in ihrer naturwissenschaftlichen Fassung für ihr Schicksal insgesamt bestimmend geworden ist und derzeit noch immer bleibt. Dieser Umstand erschwert es wahrzunehmen, dass sich die Medizin in der Tat in einer fundamentalen Krise befindet, deren Symptome immer deutlicher bis in die konkrete Situation des Patienten durchschlagen. Diese Krise – das ist meine erste These – wird nicht von dem weiten Feld der Medizin als Heilkunst schlechthin genährt, sondern von der Verbindung dieser älteren Heilkunde und dem naturwissenschaftlichen Ansatz der Neuzeit; sie ist also eine Krise eben dieses so vital erscheinenden Bereiches des naturwissenschaftlichen Denkens in der Medizin.“
„Lassen Sie mich zum Abschluss dieses Durchganges durch einige medizinische Problemfelder das Gesagte noch einmal durch einen Hinweis auf die Grundlagenkrise in der Physik zusammenfassen: Es war Niels Bohr, der die von Gasen ausgesandten diskreten Spektrallinien ernst nahm und es wagte, demgegenüber die Physik seiner Zeit für falsch zu halten; damit leitete er wie kein zweiter den geistigen Umbruch der Quantentheorie ein. Heute müssen wir alle beginnen, den leidenden Menschen in der Ganzheit seiner Lebensbeziehung ernst zu nehmen und es wagen, die bisherige Medizin, die schon im voraus zu wissen meint, was sein und was nicht sein kann, für falsch zu halten. Erst mit diesem Wagnis nehmen wir die Herausforderung, wie sie durch den Umbruch der Physik nach wie vor gegeben ist, auch dort an, wo nicht allein unsere Erkenntnis, sondern die Zukunft der Lebenswelt auf dem Spiel steht.“
Kritische Stellungnahmen zur modernen Medizin In Deutschland haben insbesondere Schäfer und Mitscherlich viele kritische Stellungnahmen zur Entwicklung der modernen Medizin und ihrer Einseitigkeit abgegeben, für die kurze Zitate schon beispielhaft angeführt wurden (Kap. ▶ 1.4). Die berühmteste und sicher am meisten auch populär gelesene Kritik an der modernen Medizin stammt aber unverändert von dem Soziologen Ivan Illich, der sie 1975 unter dem Titel Medical Nemesis veröffentlichte. In der deutschen Übersetzung hieß der Titel Die Enteignung der Gesundheit ▶ [1]. In außerordentlich scharfen Worten setzt sich Illich mit der Entwicklung der modernen Medizin auseinander und als Charakteristikum mag der Titel des ersten Unterkapitels seines Buches gelten: „Die Pestilenz der modernen Medizin“! Ein entscheidendes Manko steckt allerdings in dieser Darstellung. Sie zeigt zwar eine Fülle von angreifbaren Entwicklungen in der Medizin auf, ohne an irgendeiner Stelle eine überzeugende Änderung oder gar Lösung anzubieten. Und doch bleibt das Buch von Illich Pflichtlektüre jedes mündigen Menschen, ob er als beruflich Tätiger in der Medizin agiert oder sich als Leidender ihr anheim gibt. Man kann erstaunt sein, wie wenig letzten Endes diese einerseits brillante und andererseits auch fast zynische Kritik an der modernen Medizin in ihr selber bewirkt hat.
Notwendigkeit einer erweiterten Sichtweise Mit dem bereits Dargestellten wurde versucht, die tieferen Ursachen dieser Medizinkrise herauszuarbeiten. Wir haben auf die Entstehung und die Geburtsstunde der modernen Medizin geblickt, weil es uns wichtig erscheint, dass das Geschehen als Entwicklungskrise verstanden wird: Eine kühn begonnene Entwicklung ist stecken geblieben und droht sich in ihr Gegenteil zu verkehren.
Merke
Sie wird nur dann heilsam fortschreiten, wenn mit dem gleichen Mut und der gleichen Entschlossenheit, mit der seinerzeit Virchow begann, ein neuer Schritt getan wird.
Nach allem, was bisher gesagt wurde, muss dieser neue Schritt dadurch erfolgen,
dass das reduzierte Menschenbild überwunden wird und
die Erkenntnis der ganzen Wirklichkeit des Menschen, seines leiblichen, seelischen und geistigen Seins, zur Grundlage medizinischen Handelns wird.
Naturwissenschaftliche Anthropologie muss von geisteswissenschaftlicher Anthroposophie ergänzt werden. Welche Fortentwicklung der modernen Medizin durch Anthroposophie möglich ist, soll im Weiteren einleitend dargestellt werden.
Wissenschaftsdogmatismus