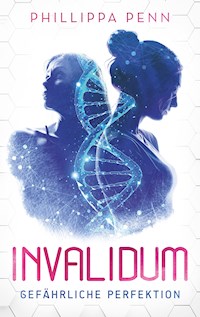
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Eugenica-Reihe
- Sprache: Deutsch
Linn und Runa leben in einer Zukunft, in der alles optimiert wurde. Auch die Menschen. Ausgefeiltes Gen-Design sorgt dafür, dass jedes Baby perfekt ist. Doch was, wenn etwas schiefgeht? Linn liebt es als Geburtshelferin die Neugeborenen zu versorgen. Doch dann muss die 17-Jährige erfahren, welches Schicksal einem Kind droht, das nicht der Norm entspricht... Runa steht vor einer großen Herausforderung: der Aufnahme in die renommierte Lamarck-Akademie. Doch die Prüfung, die sie dafür bestehen muss, ist nicht, was die junge Studienanwärterin erwartet hätte... Beide blicken hinter die Maske ihrer scheinbar makellosen Welt und entdecken ein Geheimnis, das alles verändert. »Invalidum - Gefährliche Perfektion« ist der Auftakt einer neuen, dystopischen Jugendbuchreihe. Leseempfehlung ab 14 Jahren. Aufgrund des Genres und des Settings werden in der Geschichte ernste Themen angeschnitten. Falls du bestimmte Themen beim Lesen vermeiden möchtest, weil du persönlich betroffen bist und/oder sie für dich Auslösereize darstellen, wirf bitte einen Blick auf die Triggerwarnungen unter: phillippapenn.de/invalidum1/trigger
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÜBER DIE AUTORIN
Phillippa Penn ist eine unabhängige, deutsche Autorin.
Sie liebt und lebt Gegensätze. Ihr Zuhause ist ein idyllisches Dörfchen, in ihren Geschichten träumt sich Phillippa aber mit Vorliebe in dystopische Zukunftsszenarien. Telefonieren macht ihr überhaupt keinen Spaß, obwohl sie es liebt lange Gespräche zu führen. Ihre Fantasie hegt und pflegt Phillippa am liebsten beim Lesen von Jugendbüchern, auch wenn sie schon lange über ihre Teenager-Jahre hinaus ist.
»Invalidum – Gefährliche Perfektion« ist das Erstlingswerk von Phillippa Penn und der Auftakt einer neuen Young-Adult-Reihe.
MEHR AUF: WWW.PHILLIPPAPENN.DE
für Markus, der mich mehr liebt als ich es verdient habe
für Johanna, die mich ermutigt hat zu tun, was ich liebe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Linn
Kapitel 2: Runa
Kapitel 3: Linn
Kapitel 4: Runa
Kapitel 5: Linn
Kapitel 6: Runa
Kapitel 7: Linn
Kapitel 8: Runa
Kapitel 9: Linn
Kapitel 10: Runa
Kapitel 11: Linn
Kapitel 12: Runa
Kapitel 13: Linn
Kapitel 14: Runa
Kapitel 15: Linn
Kapitel 16: Runa
Kapitel 17: Linn
Kapitel 18: Runa
Kapitel 19: Linn
Kapitel 20: Runa
Kapitel 21: Linn
Kapitel 22: Runa
Kapitel 23: Linn
Kapitel 24: Runa
Kapitel 25: Linn
Kapitel 26: Runa
Kapitel 27: Linn
Kapitel 28: Runa
Kapitel 29: Linn
Kapitel 30: Runa
Kapitel 31: Linn
Kapitel 32: Runa
Kapitel 33: Linn
Kapitel 34: Runa
Kapitel 35: Linn
Kapitel 36: Runa
Kapitel 37: Linn
Kapitel 38: Runa
Kapitel 39: Linn
Kapitel 40: Runa
Kapitel 41: Linn
Kapitel 42: Runa
Kapitel 43: Linn
Kapitel 44: Runa
Kapitel 45: Linn
Kapitel 46: Runa
Kapitel 47: Linn
Kapitel 48: Runa
Kapitel 49: Linn
Kapitel 50: Runa
Kapitel 51: Linn
Kapitel 52: Runa
Kapitel 53: Linn
Kapitel 54: Runa
Kapitel 55: Linn
Kapitel 56: Runa
Epilog: Kai
KAPITEL 1
Linn ging zügig den hell erleuchteten Gang entlang. Ihre Schritte waren leise, beinahe lautlos, auf dem penibel sauberen weißen Vinylboden. Sie war in ihrem ersten Jahr als Geburtshelferin im St. Hilaire Krankenhaus und auf dem Weg in den Kreißsaal. Dieses Mal war sie zu einer ungewöhnlichen Geburt gerufen worden, zu einer nicht geplanten Geburt.
Linn war noch nie bei einer spontanen Geburt dabei gewesen. Schon die Vorstellung, dass sie gleich erleben würde, wie eine Frau ein Baby aus sich herausdrückte, kam ihr grotesk und altertümlich vor. In Eugenica wurden Babys nicht von der Mutter geboren, sie wurden von einem Roboter, dem PeperiBot, entbunden. Das war die sicherste Methode, die sauberste Methode, die beste Methode.
Urplötzlich hörte Linn einen Schrei und erschrak. Um ein Haar hätte sie das sorgsam verpackte Operationsbesteck, das sie in den Händen hielt, fallen lassen.
Sie blieb wie angewurzelt auf dem Flur stehen und dann geschah es wieder: Ein Schrei, ein zweiter Schrei, ein Wimmern.
Was hatte das nur zu bedeuten?
Das Klagen schien aus dem Kreißsaal zu kommen, und Linn meinte zu erkennen, dass es eine Frau war, die da schrie. Sie zögerte einen Moment, bevor sie sich ein Herz fasste und weiterlief.
Als ein weiterer markerschütternder Schrei aus dem Raum drang, lief es Linn eiskalt den Rücken hinunter. Mit zittrigen Händen drückte sie die Tür zum Kreißsaal auf und erstarrte.
In der Mitte des Kreißsaals lag eine junge Frau, kaum älter als Linn selbst, auf dem Operationstisch. Andere Mütter schliefen friedlich, während der PeperiBot mit schnellen, exakten Schnitten ihr Kind aus ihnen herausoperierte, doch bei dieser Frau war alles anders. Sie war wach und ihr hochrotes Gesicht verriet, wie angestrengt sie war. Den Oberkörper auf ihre Ellenbogen gestützt, die Beine angewinkelt und weit gespreizt, presste sie mit aller Kraft.
Am Fußende des Operationstisches stand eine Geburtshelferin. Linn erkannte Inga, die ein Lehrjahr über ihr in der Geburtshelferausbildung war.
Geschockt bemerkte sie, dass Ingas behandschuhte Hände blutig waren.
Hatte sie etwa in die Mutter hineingefasst?!
Um den Operationstisch herum standen in beinahe stoischer Gelassenheit, so als könnten sie die vor Schmerzen schreiende Frau und die überforderte Geburtshelferin vor sich gar nicht sehen, zwei Ärzte.
Dr. Morten, der Leiter der Geburtsstation, und Dr. Kjellgren, die neue Gynäkologin, die gerade von der Lamarck-Akademie an das Krankenhaus gewechselt war, machten sich Notizen auf ihren MediPads.
Über ihren Köpfen hing der PeperiBot an seiner Führungsschiene von der Decke. Gleich einer großen Spinne hatte er seine Operationsarme angezogen und beobachtete regungslos das Chaos unter sich.
Dr. Kjellgren bemerkte schließlich Linn und blickte auf. »Geburtshelferin 823?«
Linn nickte zögerlich, als die Ärztin sie mit ihrem Dienstnamen ansprach.
»Haben Sie das sterile Besteck dabei?«
Wiederum nickte Linn, sie brachte kein Wort heraus.
Dr. Kjellgren hob eine Augenbraue. »Nun, wären Sie so freundlich, es mir zu bringen?«
Linn machte einen Schritt nach vorne und stolperte beinahe über ihre eigenen Füße. Hastig lief sie zu Dr. Kjellgren und hielt ihr das Besteck hin.
»Was soll ich damit?« Die Gynäkologin rollte die Augen. »Holen Sie ein steriles Tablett. Packen Sie es aus!« An Dr. Morten gewandt sagte sie: »Waren diese Dummerchen noch nie bei einer Operation anwesend?«
Dr. Morten antwortete, ohne von seinem MediPad aufzusehen: »Am St. Hilaire operieren wir ausschließlich mit MediBots«, sagte er in einem gelangweilten Tonfall. »Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt ein Set auftreiben konnte.«
Dr. Kjellgren schien hinter ihrem Mundschutz die Nase zu rümpfen. Offensichtlich imponierte es ihr nicht, dass in der Klinik nur Roboter operierten.
Der PeperiBot, der ausschließlich bei Entbindungen zum Einsatz kam, war nur einer der hochspezialisierten MediBots.
Die Ärztin wandte sich wieder Linn zu. »Was stehen Sie denn noch hier? Los!«
Linn wirbelte herum und hastete zu einem der Schränke, die unsichtbar in die Wand des Kreißsaals eingelassen waren. Sie musste mehrere Türen öffnen, bis sie schließlich einen kleinen Stapel silbern glänzender Tabletts fand.
Hinter ihr stöhnte die Schwangere und Linn erschauderte. Was war hier nur los? Wo war sie hier nur hineingeraten? So funktionierte eine Geburt doch nicht!
Mit bebenden Händen versuchte sie, das Sterilitätssiegel an dem Operationsset zu lösen. Die transparente Folie, die das Besteck umgab, schien plötzlich undurchdringlich zu sein. Sie zerrte an der Packung, bis diese unerwartet aufplatzte und das Besteck klirrend zu Boden fiel.
Dr. Kjellgren drehte sich blitzschnell zu ihr herum. »Idiotin!«, blaffte sie, die Ruhe war nun aus ihrer Stimme verschwunden, und Linn zuckte ängstlich zusammen.
Die Ärztin kam auf sie zu. »Geburtshelferin 823!«, presste sie wütend hervor, »Sie gehen jetzt augenblicklich vor zur Stationsaufseherin und bitten um ein weiteres Set.«
Die Augen der Gynäkologin waren zu Schlitzen verengt und blitzten zornig. Linn blickte beschämt zu Boden.
»Und ich hoffe für Sie, dass es in diesem Krankenhaus noch ein steriles Operationsbesteck für einen Kaiserschnitt gibt, sonst werde ich persönlich dafür sorgen, das S-«
»Da ist etwas! Ich sehe einen Fuß!«
Ingas hysterischer Ruf übertönte den Rest von Dr. Kjellgrens Androhung.
Die Ärztin wandte sich augenblicklich von Linn ab und stürmte zurück zum Operationstisch. Auch Dr. Morten hatte sein MediPad abgelegt und war an Ingas Seite geeilt. Alle drei blickten auf das Genital der gebärenden Frau, das unnatürlich weit gedehnt und blutverschmiert war und aus dessen Mitte gerade – Linn wurde übel – ein winziger Fuß hervorbrach.
»Steiß-Fuß-Lage«, stellte Dr. Kjellgren fest.
»Geburtshelferin 784«, sie richtete sich an Inga, »gleich wird der restliche Rumpf des Kindes folgen, dann wenden Sie den Bracht-Griff an.«
Inga starrte die Ärztin mit großen Augen an.
»W-Was?« Die Antwort der Geburtshelferin war kaum mehr als ein leises Wimmern.
Die Mutter schrie wieder auf und Linn, die mittlerweile näher an den Operationstisch herangetreten war, sah, wie ein weiterer kleiner Fuß und das Gesäß des Kindes geboren wurden. Der Anblick war grauenvoll und faszinierend zugleich. Linn konnte nicht anders, als zu starren.
In diesem Moment stieß Dr. Kjellgren Inga grob zur Seite. »Was können Sie überhaupt?!«, schimpfte sie wütend.
Blitzschnell griff die Ärztin nach einem Paar Hygienehandschuhen aus einem Spender, der an der Unterseite des Operationstisches angebracht war, und zog sie über ihre Hände. Dann umfasste sie den Rumpf des Kindes und zog daran. Die junge Frau auf dem Operationstisch gab ein Geräusch von sich, das wie ein Fauchen klang. Dr. Kjellgren ignorierte die Reaktion der Mutter, sie zog, bis der komplette Unterleib und der Rücken des Kindes zu sehen waren. Als schon beinahe die Schulterblätter hervortraten, stoppte sie.
»Geburtshelferin 823!« Der Befehlston der Gynäkologin riss Linn aus ihrer Starre. »Kommen Sie her! Sofort!«
Linn eilte an die Seite der Ärztin. Inga war vom Operationstisch zurückgetreten und blickte mit einem undefinierbaren Ausdruck auf ihre blutverschmierten Hände.
»Hören Sie mir gut zu!«, ermahnte Dr. Kjellgren Linn nun. »Wenn ich sage 'Jetzt', drücken Sie mit ihrer Faust fest auf das Gebärmutterdach!«
Linns Blick wanderte zu der Mutter, die keuchend auf dem Tisch lag. Sie konnte sehen, wie die Kräfte der jungen Frau schwanden. Ihre Augen waren glasig, ihre Stirn von Schweißperlen bedeckt. Sie brauchte Hilfe. Sie würde es nicht schaffen, das Kind aus eigener Kraft herauszupressen.
»Geburtshelferin 823«, sagte Dr. Kjellgren energisch, »haben Sie verstanden?!«
Linn wandte sich der Ärztin zu. Dr. Kjellgren schaute ihr prüfend in die Augen.
Dieses Mal hielt Linn ihrem Blick stand.
Dieses Mal war sie gefasst und konzentriert.
Dieses Mal war sie bereit zu helfen.
»Ja!«, antwortete Linn mit fester Stimme.
Die Gynäkologin nickte. »Gut. Halten Sie sich bereit.«
KAPITEL 2
Die kugelrunde Lampe an der Wand über Runas Bett weckte sie mit ihrem immer heller und greller werdenden Licht. Künstliches Vogelgezwitscher drang aus Lautsprechern, die hinter der wabenartigen Wandmembran verborgen lagen. Runa zog sich grummelnd die Decke über ihren Kopf, sodass nur noch ein paar blonde Haarspitzen darunter hervorschauten. Es war früh, viel zu früh für Runa. Doch das interessierte in diesem Haus niemanden. Wenige Augenblicke später öffnete sich die automatische Tür zu ihrem Schlafzimmer mit einem leisen Zischen.
Ohne unter ihrer Bettdecke hervorlugen zu müssen, wusste Runa, dass ihre Mutter gerade den Raum betreten hatte. Ida war eine Frau, die Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit schätzte. Jeden Morgen, ohne Ausnahme, weckte sie Runa zur selben Zeit.
»Metis«, sagte Runas Mutter an den DomoBot gewandt, »beende Wecken. Öffne Jalousien.«
Die künstliche Intelligenz, die unsichtbar, aber allgegenwärtig alle Funktionen des Hauses steuerte, gehorchte.
Metis ließ das Vogelgezwitscher verstummen. Das grelle Licht wurde sanfter und passte sich dem Tageslicht, das langsam durch das bodentiefe Fenster in den Raum fiel, an.
Runa spürte, wie sich das Gewicht auf ihrer Matratze verlagerte. Ida hatte sich neben sie auf den Rand des Bettes gesetzt. Sanft zog ihre Mutter die Decke von Runas Kopf.
»Guten Morgen, Tochter«, begrüßte sie Ida. Wie immer hatte sie ein mildes Lächeln auf ihren Lippen, das jedoch nie ganz ihre Augen erreichte.
Runa drehte sich verschlafen zu ihrer Mutter um. »Guten Morgen, Mutter«, erwiderte sie.
Ida strich sich eine Strähne ihres glänzenden braunen Haares hinters Ohr. Dann sagte sie mit samtweicher Stimme: »Es wird Zeit aufzustehen. Heute ist ein wichtiger Tag.«
»Ja, ich weiß«, antwortete Runa, bemüht um einen freundlichen und wachen Tonfall. »Ich stehe sofort auf, Mutter.«
Für einen Moment war es so, als hätte Ida sie nicht gehört. Sie schaute Runa mit unergründlicher Miene an. Das Mädchen richtete sich etwas ungeschickt auf, um sich dem starren Blick ihrer Mutter zu entziehen.
Es verunsicherte Runa, dass sie nie richtig erkennen konnte, was in Idas Kopf vorging. Obwohl diese Frau sie geboren hatte, obwohl sie beide sich jeden Tag sahen, schien da immer eine unsichtbare Wand zwischen ihnen zu stehen.
Eine unüberwindbare Distanz.
Während Runa noch grübelte, erhob sich Ida unvermittelt. Der rätselhafte Ausdruck war vom Gesicht ihrer Mutter verschwunden, beinahe so, als hätte Runa sich den entrückten Blick nur eingebildet. Nun nickte Ida zufrieden, drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer.
Runa seufzte und schälte sich widerwillig aus ihren Laken. Kaum hatte sie ihre Füße über die Bettkante geschwungen, erschien ein Hologramm vor ihr auf Augenhöhe.
»Guten Morgen, Runa.« Metis' körperlose Stimme erklang aus dem Nichts. »Deine Vorschau für den heutigen Tag: Du hast heute ein wichtiges Ereignis. Das wichtige Ereignis lautet: Aufnahmeprüfung Lamarck-Akademie.«
Der Termin leuchtete in grellblauen Lettern vor Runa auf. Sie verdrehte ihre Augen.
Als ob sie das jemals vergessen könnte!
Seit Wochen bereitete Runa sich auf diese Aufnahmeprüfung vor. Ihr ganzer Alltag, wie wahrscheinlich der Alltag vieler 17-Jähriger in Eugenica, war davon bestimmt. Sie hatte ihren Heimunterricht vor drei Monaten erfolgreich abgeschlossen, nun galt es sich einen Platz an einem der renommiertesten Weiterbildungszentren des Landes zu sichern.
Runa war für Lamarck bestimmt, denn dort waren schon ihre Eltern ausgebildet worden. Die Akademie brachte die Top-Ärzte und -Genetiker des Stadtstaates hervor, und kaum etwas hatte in Eugenica einen so hohen Stellenwert wie Medizin und Genforschung.
»Bitte beeile dich.« Metis hatte für Runas Grübeleien und Morgenmuffeligkeit kaum mehr Geduld als Ida. »Frühstück beginnt in 10 Minuten.«
»Ja, ja, ja«, murmelte Runa, stand auf und trat vor die Wand rechts von ihrem Bett. Augenblicklich verschwand die Mauer, die nur eine holografische Einrichtung war, und gab den Blick auf das Badezimmer frei.
Das Bad war, wie Runas Zimmer, in sterilem Weiß gehalten. Neben einem Waschbecken und einer Toilette gab es eine große gläserne Duschkabine. Runa streifte ihren schlichten hellblauen Pyjama ab und trat unter die Brause.
»Frühlingsregen«, sagte sie und einen Augenblick später plätscherte lauwarmes Wasser auf sie herab.
Ein Duft von Magnolien, Flieder und frisch geschnittenem Gras hüllte sie ein, während an die durchsichtigen Duschwände Bilder von blühenden Bäumen und Wiesen projiziert wurden.
Runa atmete tief ein. Sie war nervös, denn die Prüfung heute würde nicht leicht werden. Zwar hatte Runa ihre gleichaltrigen Mitschüler im virtuellen Vergleich immer überflügelt, aber die Aufnahmeprüfung der Lamarck war mit den Tests, die sie unter Metis‘ Aufsicht zuhause bearbeitet hatte, nicht zu vergleichen.
Die Prüfung würde mündlich stattfinden, und Bestandteil der Probe war nicht nur ein Wissenstest, sondern auch ein psychologischer Test. Es gab keine Einschränkungen bezüglich des Lernstoffs, der abgefragt werden durfte, was es so gut wie unmöglich machte, sich gezielt vorzubereiten. Die Prüfer konnten sie beinahe alles fragen!
Dennoch, um zumindest ihr Gewissen zu beruhigen, hatte Runa in den vergangenen Wochen und Monaten jedes Thema, das sie je im Heimunterricht bearbeitet hatte, wiederholt. Alles, was die Kinder von Eugenica in 10 Jahren lernten, war in ihrem Kopf abgespeichert. Hoffentlich würde das ausreichen!
Erfrischt, aber nicht weniger besorgt, trat Runa aus der Dusche. Eine wärmende Lampe und ein leise summendes Gebläse trockneten ihren Körper, während das Mädchen schon nach der ordentlich gefalteten Kleidung griff, die in einem versteckten Fach in der Badezimmerwand lag.
Sie schlüpfte in eine seidige dunkelblaue Hose und eine weiße Tunika – Standardkleidung, wie sie jede Jugendliche in Eugenica trug. Ihr schulterlanges blondes Haar fasste Runa einfach locker mit einer Haarspange zusammen.
Sie betrieb keinen großen Aufwand um ihr Aussehen. Während andere Mädchen eine raffinierte Frisur oder ein sorgfältig abgestimmtes Make-up nutzten, um sich abzuheben, störte es Runa nicht, mit ihrer Uniform in der Masse unterzugehen. Mit ihrem hellblonden Haar und den leuchtend blauen Augen stach sie ohnehin schon heraus.
Die meisten Eugenicaner hatten dunkles Haar und braune Augen, dieser Phänotyp hatte sich über Jahrhunderte der dominant-rezessiven Vererbung durchgesetzt. Alles, was davon abwich, galt als exotisch. Nur wenige einflussreiche Bürger konnten sich diese selteneren Merkmale leisten, die kaum noch auf natürlichem Wege vererbt wurden.
Mithilfe uralten Erbmaterials und technologischer Raffinesse wurden sie in einem Prozess, den man Genus-Design nannte, den eugenicanischen Kindern mitgegeben, wenn sie kaum mehr als ein Klumpen von Zellen waren.
»Wer schön und besonders ist«, hatte Ida mal zu Runa gesagt, »hat mehr Erfolg im Leben.«
Dass man mit dem Genus-Design Krankheitsmarker identifizierte und ausmerzte, war mittlerweile selbstverständlich, aber dass man das Aussehen eines Kindes optimierte, war Luxus.
Runa konnte sich eigentlich glücklich schätzen, dass ihre Eltern so wohlhabend waren und bei ihrem genetischen Design nicht gespart hatten. Runa war nicht nur gesund und hübsch, sie war auch ein wenig größer als die meisten Mädchen ihres Alters. Ihr schlanker, athletischer Körperbau galt als äußerst attraktiv.
Doch manchmal fragte sich Runa, wie sie wohl ausgesehen hätte, wenn ihre Gene nicht nach den Wünschen von Ida und Leif zusammengestellt worden wären. Vielleicht hätte sie dann das kastanienbraune Haar ihrer Mutter geerbt. Vielleicht wäre sie mit den kühlen grünen Augen ihres Vaters geboren worden, die ebenso besonders, aber nicht so unnatürlich blau wie ihre eigenen waren. Vielleicht hätte sie kürzere Beine gehabt, aber dafür den eleganten, wiegenden Gang ihrer Mutter übernommen …
»Bitte beeile dich«, unterbrach Metis Runas Gedanken, »Frühstück beginnt in zwei Minuten.«
Runa trat aus ihrem Zimmer hinaus in den Flur. Boden und Wände des langen, schmalen Raumes waren wie so vieles im Haus in Weiß gehalten. Obwohl keine Fenster oder Lampen zu entdecken waren, war es taghell in dem Gang. Es gab keine Möbel, kein einziges überflüssiges Einrichtungsstück, das nur im Weg gestanden hätte. Scheinbar führten auch keine Türen aus dem Gang hinaus, doch tatsächlich waren die Eingänge zu den zahlreichen Zimmern im Heim der Eriksons lediglich versteckt. Übergangslos in die Wände eingelassene Schiebetüren oder Holo-Einrichtungen gaben, kaum dass man davorstand, den Weg in die angrenzenden Räume frei.
Runa ging ein paar Schritte und blieb dann vor der Wand zu ihrer Linken stehen. Ein leises Zischen war zu hören und die Mauer schob sich zur Seite.
Sie betrat das Esszimmer.
»Guten Morgen, Vater«, begrüßte Runa den Mann, der am gläsernen Esstisch saß und konzentriert ein Hologramm las.
Seine grünen Augen flogen schnell über die winzigen leuchtenden Buchstaben, die vor ihm über dem Tisch schwebten. Wahrscheinlich las Leif Erikson wieder einmal eine wissenschaftliche Veröffentlichung über Genetik, denn Runas Vater war einer der angesehensten Genetiker des Landes. Nachdem er den Absatz beendet hatte, blickte er zu Runa auf.
»Guten Morgen, Tochter«, sagte er mit einem schmalen Lächeln, »setz dich doch zu mir.«
KAPITEL 3
Blut – Linn hatte noch nie so viel davon gesehen wie bei dieser Geburt. Es war überall: Auf der kühlen Oberfläche des Operationstischs, an den Schenkeln der Mutter, am Baby, an Dr. Kjellgrens Händen, an Linns Kittel, als sie das Neugeborene entgegennahm und fest an sich drückte.
Und es hörte einfach nicht auf.
Die Mutter blutete stark. Entkräftet lag die junge Frau auf dem Operationstisch, ihr Atem war flach und ihre Haut wurde zunehmend blasser. Es war, als würde man das Leben langsam aus ihr heraussickern sehen.
»Ich denke, es ist eine Uterusruptur«, sagte Dr. Kjellgren an Dr. Morten gewandt. »Wir müssen sofort operieren.«
Dr. Morten, der sich wieder seinem MediPad zugewandt hatte, hob eine Augenbraue: »Mit dem PeperiBot? Wohl kaum.«
»Doktor?!« Dr. Kjellgren riss ungläubig die Augen auf. »Sie verblutet!«
Dr. Morten schien völlig ungerührt.
In diesem Moment begann das Baby in Linns Armen zu schreien.
Dr. Kjellgren wirbelte herum. Der Blick der Ärztin, eine Mischung aus Ärger und Verzweiflung, traf Linn.
»Geburtshelferin 823, bringen Sie das Kind hier raus!«, befahl die Gynäkologin mit vor Wut zitternder Stimme. »Sofort!«
Linn gehorchte. Als sie am Operationstisch vorbeiging, sah sie aus dem Augenwinkel, wie sich die Mutter rührte. Das Baby weinte immer noch in Linns Armen, dennoch blieb sie kurz stehen. Die Lider der jungen Frau flatterten, bis ihre halb geöffneten Augen schließlich Linns Gesicht fanden.
Obwohl die Frau so schwach wirkte, war ihr Blick intensiv. Ihre leuchtend blauen Augen (ein Blau, wie es Linn noch nie zuvor gesehen hatte) schienen der Geburtshelferin etwas sagen zu wollen.
Die farblosen Lippen der jungen Mutter bebten. Es dauerte einen Moment, bis Linn registrierte, dass die Patientin leise wisperte. Es war eher ein Hauch als ein Wort und Linn beugte sich zum Operationstisch hinunter, um die Frau über das Weinen des Babys hinweg zu verstehen.
»Liv...«, flüsterte sie, »Livia.«
»Livia?«, wiederholte Linn in gedämpften Ton, sodass die beiden Ärzte, die wenige Meter entfernt vom Operationstisch standen und diskutierten, nichts von ihrer Unterhaltung mit der Patientin mitbekamen.
Die junge Mutter schloss kurz die Augen, Linn kam es vor wie ein Nicken.
»Ist das ihr Name?« Die Geburtshelferin blickte zu dem Baby in ihren Armen, das sich ein wenig beruhigt hatte und jetzt nur noch leise wimmerte. Es war noch immer blutverschmiert, sein Gesicht verschwitzt und tränennass.
»Livia«, krächzte die Mutter abermals, doch ihre Augen öffneten sich nicht mehr.
»Sie können nicht einfach abwarten, bis die Patientin stirbt!« Dr. Kjellgrens energische Behauptung ließ Linn zusammenzucken.
»Das ist nicht meine Patientin!«, entgegnete Dr. Morton. Seine üblich gelangweilte Art war nun auch der Wut gewichen. »Ich weiß nicht, wo sie diese Aussortierte …«, der Arzt spuckte das Wort heraus, als wäre es giftig, »… gefunden haben. Aber diese Geburt war lediglich ein medizinisches Experiment, keine Behandlung! Ich werde nicht unsere Ressourcen an ein Invalidum verschwenden!«
»Ein Invalidum?!« Dr. Kjellgren war empört. »Sehen Sie sie nicht? Blonde Haare, blaue Augen … Das sind Merkmale, die im Grunde ausgestorben sind! Sie könnte einen wichtigen Beitrag zu unserem Genpool leisten!«
»Sie«, die Verachtung in der Stimme des Oberarztes war unüberhörbar, »ist vermutlich irgendwo in der Einöde aufgewachsen. Wahrscheinlich ist sie krank, verstrahlt oder missgebildet in einer Art und Weise, die wir ihr nicht ansehen können!«, zischte er. »Ich werde mich nicht dieser Kreatur annehmen, nur weil sie schöne Augen hat!« Dr. Morten warf einen missbilligenden Blick in die Richtung der jungen, blutenden Frau. »Außerdem müssen wir sie nicht am Leben erhalten, um ihr genetisches Material zu untersuchen«, fügte er leise murmelnd hinzu.
»Was haben Sie gerade gesagt?«, fragte Dr. Kjellgren entsetzt.
Der Streit der Mediziner wurde immer hitziger. Linn konnte der Debatte der beiden Ärzte kaum folgen. Aber das war auch nicht ihre Aufgabe, erinnerte sie sich selbst. Ihre ganze Aufmerksamkeit und Sorge sollte dem Kind gelten. Mit einem letzten Blick auf die junge Mutter, die scheinbar vor Erschöpfung eingeschlafen war, huschte Linn zur Tür.
Kurz bevor die schwere Milchglasscheibe hinter ihr zufiel, hörte sie Dr. Kjellgren noch fragen: »Und was ist mit dem Kind?!«
Linn brachte das Neugeborene in den Säuglingsraum. In etwa einem Dutzend kleiner schwebender Sphären schliefen dort friedlich die anderen Babys.
An einer der weißen Wände gab es eine Hygienestation, ein einfaches ovales Becken über dem ein MediBot – ein deutlich schlichteres Modell als der PeperiBot aus dem Kreißsaal – im Standby ruhte. Linn legte das noch völlig nackte Kind hinein.
Sofort erwachte der MediBot zum Leben und einer seiner vier Arme schwang hinunter zu dem Säugling. Am Ende des Roboterarms kam ein schmaler Duschkopf zum Vorschein, der jetzt mit weichem, warmem Wasser das Neugeborene wusch. Das wenige Minuten alte Baby quiekte auf, halb erschrocken, halb vergnügt.
Linn betrachtete es lächelnd, während der MediBot fortfuhr. Das winzig kleine Mädchen hatte große blaue Augen und eine zierliche Stupsnase. Ihre Hände und Füße waren unfassbar klein. Ihre Finger und Zehen wirkten so zerbrechlich, als wären sie aus Porzellan. Es war nicht das erste Baby, das Linn während ihrer Arbeit zu Gesicht bekam, doch gerade jetzt, nach dieser blutigen Geburt, faszinierte es sie umso mehr. Was war es doch für ein Wunder, dass aus so etwas Schmerzhaftem und Barbarischem, so etwas Schönes hervorging!
Der MediBot trocknete das Baby ab, zog ihm ein Windelhöschen über die zarten Beine und wickelte es von Kopf bis Fuß in ein strahlend weißes Tuch. Es war nun wie in einen seidigen Kokon gehüllt. Linn nahm das Kind liebevoll in den Arm und trug es hinüber zu einer noch leeren Sphäre.
Gerade als sie das Neugeborene hineinlegen wollte, schwang die Tür auf. Inga, ihre Kollegin, stand mit einem seltsamen Gesichtsausdruck im Eingang zum Säuglingsraum. Ihre Augen waren weit aufgerissen und sie starrte Linn und das Kind eine Weile an, bevor sie zu sprechen begann.
»Linn«, sagte sie schließlich, »das Baby!« Die Geburtshelferin deutete mit ihren noch von der Entbindung blutigen Händen auf das Neugeborene in Linns Armen. »Du musst es wegbringen!« Ingas Stimme klang panisch.
»Wegbringen?« Linn verstand nicht. »Wie meinst du das?«
Jetzt stürmte ihre Kollegin auf sie zu, packte Linn an den Schultern und sagte abermals: »Du musst es wegbringen!«
Linn runzelte die Stirn. »Ja, aber wohin denn?«, fragte sie verwirrt.
»Einfach weg!«, antwortete Inga gehetzt, dann fügte sie flüsternd hinzu: »Er will es aussortieren.«
Eine Pause trat ein. Linn hatte das Gefühl, als hätte ihre Kollegin sie mit heißem Wasser überschüttet. Sie konnte nicht glauben, was sie gerade gehört hatte.
»Er will es aussortieren?«, wiederholte sie leise Ingas Worte.
Die ältere Geburtshelferin nickte.
Aussortieren bedeutete, dass man das Kind der Mutter wegnahm. Es bedeutete, dass das Baby als Forschungsobjekt in ein Labor gebracht oder getötet werden würde. Seit Jahrzehnten war diese Praxis verpönt – sie war ein Relikt aus der Zeit vor dem Genus-Design, bevor die Menschen in Eugenica angefangen hatten, ihre Nachkommen genetisch zu optimieren. Invaliduen, Kinder bei deren Design etwas schiefgegangen war, wurden damals aussortiert. Kinder, die schwer krank oder missgebildet zur Welt kamen und das Fortbestehen einer starken und widerstandsfähigen Population mit ihren fehlerhaften Genen gefährdeten. Doch für gesunde Kinder, wie dieses Baby, war diese Behandlung niemals vorgesehen gewesen.
»Nein«, platzte es aus Linn heraus. »Aussortieren … Das ist … unmöglich!« Sie schüttelte heftig den Kopf, als könnte sie damit dieses hässliche Wort abwerfen.
»Doch«, widersprach ihr Inga, »ich habe es genau gehört!«
Sie ließ ihre Hände sinken und hinterließ dabei blutige Fingerabdrücke auf dem schneeweißen Stoff an Linns Schultern.
»Linn, die Mutter ist … sie ist tot.« Ingas Stimme brach, als sie das sagte. Der Schock über den Tod der Patientin war ihr deutlich anzumerken.
Todesfälle waren im St. Hilaire Krankenhaus, insbesondere auf der Geburtsstation, eine Seltenheit. Die Medizin war so weit fortgeschritten, dass es so gut wie nie vorkam, dass ein Patient bei einem Eingriff starb oder seiner Krankheit erlag. Nur die allerschwersten Fälle endeten tödlich.
Auch Linn war wie vom Schlag getroffen. Gerade noch hatte sie die Mutter gesehen, in ihre blauen Augen geblickt und sie sprechen gehört. Ja, die Patientin war schwach gewesen. Ja, Linn hatte mitgekriegt, was Dr. Kjellgren über den Zustand der jungen Mutter gesagt hatte. Aber sie hätte nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde. Sie hätte nicht erwartet, dass die junge Frau wirklich sterben würde. Sie war noch so jung gewesen … eigentlich noch ein Mädchen, eine Jugendliche wie Linn selbst. Wie konnte sie plötzlich tot sein?
»Dr. Morten hat sie sterben lassen«, erklärte ihr Inga mit zittriger Stimme, als hätte sie Linns Gedanken gehört. »Er hat sie da auf dem OP-Tisch einfach verbluten lassen!« Ein Schluchzer entfuhr ihrer Kollegin.
Linn war geschockt. Die junge Geburtshelferin fühlte sich wie betäubt.
Das konnte einfach nicht sein!
Das durfte einfach nicht sein!
Linn hielt das Kind noch immer im Arm, ein warmes, atmendes Bündel.
Ein Lebewesen.
Ein Mensch.
Ein Kind, das aussortiert werden sollte.
»Das darf er nicht«, flüsterte sie.
Ihre Arbeitskollegin nickte energisch. »Bring es weg, Linn!«, sagte Inga eindringlich. »Bring dieses Kind in Sicherheit!«
KAPITEL 4
Leifs Blick ruhte auf Runa, während sie ihr Frühstück aß.
»Wie fühlst du dich?«, fragte er seine Tochter. »Bist du nervös?«
Runa zuckte mit den Schultern, während sie auf einem Happen Algensalat herumkaute. »Ja, irgendwie schon«, gab sie zu, nachdem sie den Bissen hinuntergeschluckt hatte.
Dabei war das eigentlich deutlich untertrieben! Runa wurde von Minute zu Minute angespannter. Der Gedanke an die Prüfung schnürte ihr regelrecht die Kehle zu. Ihr verging die Lust am Essen und sie begann, appetitlos in den glibberigen grünen Algen herumzustochern.
»Nun, hast du dich denn vorbereitet?« Der Blick ihres Vaters war prüfend, geradezu durchdringend.
Runa rutschte unsicher auf ihrem Stuhl hin und her. »Natürlich, Vater«, antwortete sie ihm. »Aber-«
»Dann hast du ja nichts zu befürchten!«, fiel ihr Leif ins Wort. Er ließ seiner Tochter keine Gelegenheit, ihre Bedenken zu äußern.
Runa biss sich verunsichert und verärgert auf die Lippe. Es war so typisch für ihren Vater, dass er nichts von ihren Zweifeln hören wollte. Für Leif zählten nur Erfolge! Über ein mögliches Scheitern zu sprechen, war für ihn schon eine Art des Versagens.
»Wie schon gesagt, es interessiert mich nicht«, hörte Runa plötzlich ihre Mutter sagen. Ida war in ein Gespräch vertieft, als sie das Esszimmer durch einen Seiteneingang betrat.
In ihrer Ohrmuschel steckte ein kleiner weißer Knopf. Sie telefonierte.
»Schluss jetzt, Viggo. Ich will nichts mehr davon hören.« Die Stimme ihrer Mutter war bestimmt, als sie sich gegenüber von Runa an den Tisch setzte. »Wir haben uns vor langer Zeit gegen sie entschieden, sie hat für uns keine Bedeutung mehr. Aber ich bin überrascht, dass sie überhaupt zu euch gelangen konnte.«
Runa lauschte neugierig der Unterhaltung ihrer Mutter, ohne von ihrem Algensalat aufzusehen. Worum es da wohl ging? Über wen sprach sie? Und wer war dieser Viggo am anderen Ende der Leitung?
»Ja«, antwortete Ida ihrem Gesprächspartner knapp, während sie sich auch ein Schüsselchen mit Algen füllte. »Ja, das würde ich dringend überprüfen.« Ihre Mutter klang zunehmend genervter.
Runa lugte zu ihr hinüber, ihre Blicke trafen sich und Ida lächelte gequält.
»Tschüss, Viggo«, sagte Runas Mutter schließlich und nahm schnell den TeleDot aus dem Ohr. An Leif gewandt sprach sie: »Sie haben scheinbar Probleme im Haeckel-Laboratorium.«
Leif wurde aufmerksam, in dem Forschungslabor hatten Runas Eltern viele Jahre gearbeitet.
»Inwiefern?«, fragte er.
Ida antwortete nicht, stattdessen warf sie ihm einen vielsagenden Blick zu. Leifs Augen schnellten für einen Wimpernschlag in Runas Richtung. Hätte das Mädchen nicht in genau diesem Moment von seinem Salat aufgeschaut, wäre es ihm wohl entgangen.
»Was hatte das denn nun zu bedeuten?«, wunderte sich Runa und musterte ihre Eltern mit gerunzelter Stirn.
Leif räusperte sich. »Nun, wir sollten uns heute Morgen nicht mit solchen Dingen beschäftigen«, sagte er schließlich und brach damit die unangenehme Stille am Esstisch. »Immerhin ist heute Runas großer Tag, nicht wahr?«
Ihr Vater lächelte ihr zu. Es wirkte aufgesetzt.
»Ja, natürlich.« Ida folgte seinem Beispiel und wandte sich nun auch ihrer Tochter zu. »Hast du dich gut vorbereitet?«
Als Runa später im Transporter zur Lamarck-Akademie saß, dachte sie noch immer über das seltsame Telefongespräch ihrer Mutter nach.
Viggo hatte sie ihren Gesprächspartner genannt. Runa kannte die meisten Freunde und ehemaligen Kollegen ihrer Eltern (die Eriksons veranstalteten häufig Dinner-Partys in ihrem Haus), doch niemanden mit dem Vornamen Viggo. Dennoch schien ihre Mutter seltsam vertraut mit diesem mysteriösen Mann gewesen zu sein. Vermutlich kannte auch ihr Vater diesen Viggo, denn so viel war sicher: Er schien irgendwie mit dem Haeckel-Laboratorium in Verbindung zu stehen.
»Entschuldige, ist hier noch frei?« Die Stimme eines Mädchens riss Runa aus ihren Gedanken.
Sie blickte auf.
»Natürlich«, sagte sie zu der Dunkelhaarigen, die vor ihrer Sitzreihe stand.
Das Mädchen lächelte und nahm neben Runa Platz. »Ich bin Karin Nakamura«, stellte sie sich vor und streckte Runa die Hand hin.
»Hallo.« Runa ergriff etwas verlegen die Hand des Mädchens. »Runa. Runa Erikson.«
Karin hob überrascht eine schmale Augenbraue. »Doch nicht etwa Leif Eriksons Tochter?«, fragte sie. Ihre braunen Augen leuchteten interessiert auf.
Runa hätte sich auf die Zunge beißen können. Warum hatte sie Karin bloß ihren Nachnamen gesagt?! Es war natürlich klar, dass der Ruf ihres Vaters als bedeutender Wissenschaftler Runa weit vorauseilte. Sie nickte stumm.
»Wie aufregend!«, freute sich Karin und fügte zwinkernd hinzu: »Da habe ich mich ja genau neben die Richtige gesetzt!«
Der Transporter füllte sich langsam. Immer wieder hielt er an und ließ einen weiteren Passagier zusteigen, ehe er mit schwindelerregender Geschwindigkeit weiter durch das unterirdische Netzwerk von Tunneln raste.
Jedes Haus in Eugenica war an das Transporternetzwerk angeschlossen. Die meisten Menschen bevorzugten es natürlich, in einer kleinen privaten Kapsel zu reisen, aber der Zugang zur Lamarck-Akademie wurde streng reguliert. Als Bewerber gelangte man nur mit einer der speziellen Mehrpersonen-Kapseln der Akademie hinein und auch wieder hinaus.
Während Karin neben ihr pausenlos über die bevorstehende Prüfung plapperte, beobachtete Runa die anderen Jugendlichen im Transporter.
In der Kapsel war Platz für genau achtzehn Personen. Es gab sechs Sitzreihen mit jeweils zwei Sitzplätzen auf der rechten und einem Sitzplatz auf der linken Seite, dazwischen verlief ein schmaler Gang.
Fast alle Sitzplätze waren mittlerweile besetzt mit jungen Eugenicanern. Viele schienen nervös, sie fummelten mit zittrigen Fingern an ihrer Tunika herum oder kauten auf den Nägeln. Ein paar wirkten völlig übermüdet, weil sie vermutlich noch die ganze Nacht gelernt hatten. Ein Junge, der gegenüber von Runa und Karin auf einem Einzelplatz saß, starrte mit undurchdringlicher Miene vor sich hin.
Runa fiel auf, wie ähnlich sie sich alle sahen. Natürlich trugen alle dieselbe Kleidung, aber viele hatten außerdem schwarzes oder dunkelbraunes Haar. Sie waren alle durchschnittlich groß – selbst die Jungen wirkten deutlich kleiner als Runa – und niemand, absolut niemand, hatte blaue Augen. Sie alle sahen ganz normal aus.
Alle, bis auf Runa.
Ihr wurde unangenehm bewusst, wie sehr sie aus dieser Gruppe von Bewerbern hervorstach, und Angst kroch ihre Kehle hoch. Sie wollte nicht im Mittelpunkt stehen, nicht heute! Sie wollte keine zusätzliche Aufmerksamkeit! Sie wollte einfach nur eine von vielen Prüflingen sein …
Die Kapsel kam an einem weiteren Transporter-Dock zum Stehen. Runa, die am Fenster saß, schaute hinaus, um zu sehen, wo sie gehalten hatten. Die Haltestelle war ähnlich unspektakulär wie die meisten anderen Docks, an denen sie bisher stehen geblieben waren. In vielen Häusern war der Transporterraum im Untergeschoss in einem schlichten, sauberen Weiß gehalten. Doch es war auch nicht der Raum, der Runa faszinierte, als sie hinausblickte. Es war der Passagier!
Ein junger Mann, Runa schätzte ihn ein wenig älter als sich selbst, stand dort und wartete lässig darauf, in die Kapsel einsteigen zu können. Er war groß, richtig groß, und hatte strubbelige rote Haare. Doch noch viel faszinierender war – Runa klappte die Kinnlade herunter, als sie es erkannte –, dass auf seiner Nase etwas saß, das aussah wie eine Brille.
Sie musste zweimal hinsehen, um sich sicher zu sein, dass es auch tatsächlich eine Brille war. Runa hatte nämlich noch nie zuvor so eine Sehhilfe in echt gesehen, sie existierten in Eugenica im Grunde gar nicht mehr.
Sehschwächen beugte man bereits seit Jahrzehnten durch ein entsprechendes genetisches Design vor, und falls sie doch im Laufe des Lebens auftraten, ließ man sie umgehend mit einer Laseroperation behandeln. Doch dieser Junge schien tatsächlich schlecht zu sehen und machte scheinbar auch keine Anstalten, das zu verbergen. Runa konnte es kaum glauben.
»Ist das etwa ein Gezeugter?«, zischte ihr Karin ins Ohr.
Runa hatte nicht gemerkt, dass sich das dunkelhaarige Mädchen zu ihr herübergebeugt hatte und nun auch aus dem Fenster sah.
»Ich, ähm, ich weiß nicht«, antwortete Runa etwas überrumpelt.
Gezeugter war eigentlich kein Wort, das kultivierte Menschen verwendeten. Doch Runa wusste, was es bedeutete.
Gezeugte waren Menschen, die beim Geschlechtsakt entstanden waren. Ungeplant, ungewollt und ohne jegliche genetische Optimierung. Sie wurden in Eugenica von den meisten nicht akzeptiert.
Tatsächlich hatte Runa noch nie von einer Mutter gehört, die ein gezeugtes Kind ausgetragen hatte. In der Regel wurden diese Kinder abgetrieben, denn nur eine kontrollierte Befruchtung galt als eine sichere Befruchtung. Zu groß war die Angst davor, ohne ein vorangegangenes Genus-Design ein krankes oder missgebildetes Kind zur Welt zu bringen. Schließlich könnte so ein Kind, ein Invalidum, seinen Gendefekt weitervererben und langfristig die gesamte Population gefährden.
»Unfassbar, dass sie so ein Invalidum zur Prüfung zulassen!«, schimpfte Karin. Ihre Mandelaugen waren zu Schlitzen verengt und funkelten bösartig.
Runa wandte sich von dem Mädchen ab. Es gefiel ihr nicht, wie sie über den anderen Jugendlichen sprach. Nur weil er eine Sehschwäche hatte, musste das nicht gleich bedeuten, dass er ein Invalidum war.
»Er ist einfach nur anders«, dachte sich Runa verärgert.
Als der Rothaarige einstieg, fiel sein Blick sofort auf das blonde Mädchen. Er schaute sie so erschrocken und intensiv an, dass Runa einen Moment selbst ganz mulmig wurde. Doch dann erinnerte sie sich wieder daran, wie exotisch sie unter den anderen Passagieren wirken musste. Schließlich stach sie mit ihrem blonden Schopf mindestens genauso aus der Menge der Dunkelhaarigen hervor wie er mit seiner roten Fransenfrisur. Vermutlich war der Junge, genau wie Runa, bisher kaum einem Menschen begegnet, der ebenso besonders aussah.
Runa atmete tief durch und stellte sich seinem Blick. Für einen kurzen Moment, ehe sich der ältere Junge in den letzten freien Sitz fallen ließ, schauten sich die beiden einfach nur an. Der Rothaarige entspannte sich. Ein Grinsen machte sich in seinem Gesicht breit und auch Runa musste ein wenig lächeln. Ein warmes Gefühl der Erleichterung durchströmte sie.
Zumindest würde sie nun nicht ganz alleine im Mittelpunkt stehen.
KAPITEL 5
Alles musste ganz schnell gehen. Linn und Inga hatten sich einen Plan überlegt, wie sie das Neugeborene aus der Klinik schaffen konnten, ohne dass Dr. Morten etwas davon mitbekam.
Linn würde das Baby, das sie in Gedanken schon »Livia« nannte, als Stillgeborenes ausgeben, um an der Stationsaufseherin vorbeizukommen. Denn nur die toten Kinder verließen ohne ihre Mütter die Station. Es gab einen Raum im Untergeschoss der Klinik, wo entnommene Organe, Körperteile und eben auch Leichname verstorbener Patienten aufbewahrt wurden, ehe sie zusammen mit anderem organischem Abfall in einen Entsorgungstransporter verladen wurden. Dort würde sie das Kind hinbringen und – Linn musste bei dem Gedanken daran heftig schlucken – versuchen, das Klinikgelände im Mülltransporter zu verlassen.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin hatte Linn in Windeseile alles Notwendige zusammengetragen, was sie für die Versorgung des Babys zuhause benötigen würde. Im Grunde war das auch nicht schwer, denn auf der Säuglingsstation gab es InfanPacks, Taschen mit allerlei Babyzubehör, die Mutter und Kind beim Verlassen des Krankenhauses mit nach Hause gegeben wurden. Die Schwierigkeit bestand nun darin, den Inhalt eines InfanPacks so an Linns Körper zu befestigen, dass es nicht auffiel, wenn sie damit durchs Krankenhaus lief. Würde sie den Pack einfach über der Schulter tragen, könnte das sofort Aufsehen erregen und man würde denken, dass sie das Baby entführte.
Nun, in gewisser Weise tat sie das ja auch, dachte sich Linn, nur dass es eben keine Mutter mehr gab, von der sie das Baby stehlen konnte.
»Es hält einfach nicht!«, fluchte Inga leise.
Die beiden Geburtshelferinnen hatten sich in die Umkleide für die Stationsangestellten zurückgezogen. Gerade war Inga dabei, eine Packung Windeln mit einem Gurt um Linns Oberschenkel zu schnallen. Doch das glatte Material der Windeln rutschte an Linns Haut ab. Es würde kaum an Ort und Stelle bleiben, wenn sie damit schnell durch die Gänge lief.
»So wird das nichts!« Inga klang frustriert und ließ sich entmutigt auf den Boden fallen.
»Warum bist du auch so klein und zierlich?«, tadelte sie Linn. »Ich weiß nicht, wo ich das alles hinstecken soll!«
Linn wurde rot. Inga hatte bereits ihre Unterhose so mit Baby-Artikeln vollgestopft (glücklicherweise waren diese alle einzeln verpackt), dass Linns Hinterteil beinahe doppelt so groß wirkte wie sonst. In ihr Unterhemd konnte sie nichts stecken und die Taschen ihrer Uniform würden viel zu auffällig ausbeulen, wenn sie voller Windeln waren.
»Gib mir deinen BH!«, platzte es aus Linn heraus.
»Wie bitte?«, antwortete Inga ungläubig.
»Na ja, da könnte man dann doch noch etwas reinstecken, wenn ich den trage!«, erklärte sie hektisch.
Es war ihr furchtbar peinlich. Linn war flach wie ein Brett, ihre Kollegin hingegen hatte – obwohl sie kaum älter war – einen üppigen Busen.
Inga nickte zustimmend, dennoch wirkte sie etwas widerwillig, als sie ihren Büstenhalter umständlich unter ihrem Oberteil auszog und ihrer Kollegin überreichte. Linn zog sich den BH über ihr Unterhemd und war ein wenig eingeschüchtert, als sie sah, wie viel Platz das Kleidungsstück an ihren Brüsten noch ließ.
Auch Inga musste ein wenig kichern, als sie begann, die Windeln in die Körbchen zu stecken.
»Zum Glück musst du das Kind nicht stillen, das wäre ja ganz schön mager!«, scherzte sie.
Nach einer gefühlten Ewigkeit hatten die beiden jungen Frauen alles aus dem InfanPack unterbekommen. Linn zog sich eine frische Uniform an, denn die Blutflecken auf ihrem weißen Kittel würden nur ungewollte Aufmerksamkeit erregen. Sie griff sich die Sachen gleich eine Nummer größer aus dem Wäscheschrank der Station. Die weitere Kleidung würde die ungewohnten Wölbungen ihrer Figur kaschieren, und Linn hoffte inständig, dass niemandem auffiel, dass die Kennzeichnung auf der Brust nicht ihre Dienstnummer 823, sondern die Nummer 863 ihrer Kollegin Anna war.
»Hoffentlich kriegt Anna keinen Ärger, weil ich ihre Uniform trage«, sagte sie an Inga gewandt.
»Sorge dich lieber um dich selbst, Linn«, antwortete Inga trocken. »Du weißt schon, dass du nach dieser Aktion extrem vorsichtig sein musst, oder?« Sie warf ihrer jüngeren Kollegin einen strengen Blick zu. »Ich würde ja selbst mit dem Kind gehen, aber alle im zweiten Ausbildungsjahr haben heute eine Hygiene-Fortbildung. Anwesenheit ist Pflicht. Es würde sofort auffliegen, wenn ich da nicht auftauche«, erklärte sie seufzend. »Benimm dich einfach ganz natürlich, wenn du die Station verlässt, ja? Ich lasse mir schon etwas einfallen, wenn heute noch mal jemand nach dir fragt.« Sie nickte Linn aufmunternd zu.
»Und ich werde versuchen, deine Schicht zu verschieben, sodass du morgen erst einmal mit dem Baby in deiner Unterkunft bleiben kannst«, versprach die ältere Geburtshelferin. »Morgen nach Feierabend komme ich zu dir, übernehme das Kind und du gehst zur Nachtschicht. Verstanden?«
Linn nickte, die Aufregung stieg in ihr hoch. Bis zu diesem Moment hatte sie nur daran gedacht, Livia aus dem Krankenhaus herauszuschaffen. Jetzt, wo sie darüber sprachen, was danach geschehen sollte, wurde ihr erst richtig bewusst, dass die Rettung des Kindes alles verändern würde. Sie musste von nun an mit einem Geheimnis leben, und Linn beschlich das ungute Gefühl, dass es sie nicht nur ihren Job kosten würde, wenn es jemals herauskäme. Sie hätte sich nie vorstellen können, sich einmal über Dr. Mortens Anweisungen hinwegzusetzen.
»Aber wir tun das Richtige!«, dachte sie sich. »Livia darf nicht aussortiert werden!«
Die beiden Geburtshelferinnen kehrten in den Säuglingsraum zurück. Linn eilte sofort zu der Sphäre, in die sie Livia gelegt hatte. Das kleine Mädchen schlief friedlich. Die Hologramm-Anzeige, die über dem Kind in die Luft projiziert wurde, zeigte, dass alle Vitalwerte im Normalbereich lagen.
Linn atmete erleichtert auf. Das Kind war gesund, es ging ihm gut. Inga trat neben sie, in der Hand hielt sie ein dunkelblaues Laken. Es war die Art von Laken, die verwendet wurde, um Tote zu bedecken.
»Wir müssen sie darin einwickeln.« Ingas Ton war pragmatisch, doch Linn entging nicht, dass die Augen ihrer Kollegin immer wieder nervös zur Tür schielten. »Und wir sollten uns damit beeilen«, fügte die ältere Geburtshelferin hinzu.
»Aber sie wird aufwachen. Was, wenn sie schreit?« Linns Stimme klang schriller, als sie es beabsichtigt hatte.
Inga biss sich auf die Lippen. »Na ja, wir könnten ihr ein Schlafmittel geben«, schlug sie vor.
Linn schaute ihre Kollegin entsetzt an. »Was?!«, fragte sie ungläubig. »Ist das dein Ernst?«
Linn und Runa waren als Geburtshelferinnen nicht berechtigt, ihren kleinen Patienten Medikamente zu verabreichen. Insbesondere bei Babys konnte es schnell passieren, dass man die hochwirksame eugenicanische Medizin überdosierte. Nur Ärzte durften die Mittel anwenden und – das kam noch erschwerend hinzu – nur Ärzte hatten Zugriff auf den Medikamentenbestand.
»Wie willst du überhaupt an so etwas rankommen?!«, konfrontierte Linn ihre Kollegin.
Inga zog mit einem schuldbewussten Lächeln eine winzige Phiole aus ihrer Hosentasche. In dem Gefäß befand sich eine schimmernde pastellblaue Flüssigkeit. Linn erkannte das Medikament sofort wieder. Sie hatte gesehen, wie Dr. Morten es mal einer jungen Mutter verabreichte, die nach der Geburt ihres Kindes manisch wurde und nächtelang erbärmlich schrie.
Es hieß »Neosomnus« und war das stärkste bekannte Schlafmittel. Schon eine winzige Phiole wie diese reichte aus, um einen Erwachsenen für mindestens acht Stunden auszuschalten. Linn mochte sich nicht vorstellen, welche Wirkung eine zu hohe Dosis bei einem Neugeborenen haben würde.
»Das ist viel zu gefährlich!« Sie schüttelte entschieden den Kopf. »Woher hast du das überhaupt?!«
»Das spielt keine Rolle.« Inga wich ihrer Frage aus. »Außerdem: Wie willst du sonst der Stationsaufseherin glaubwürdig machen, dass das Kind tot ist?«
Linn schnappte nach Luft. »Das können wir aber nicht riskieren!«, widersprach sie nun deutlich energischer ihrer älteren Kollegin. »Wenn wir uns mit der Dosis vertun, könnte die Kleine daran sterben!«
»Linn«, Inga wurde nun sehr ernst, sie sah Linn tief in die Augen, »was glaubst du, was mit dem Kind passiert, wenn wir es nicht riskieren?«
KAPITEL 6
Der Transporter hatte sein Ziel erreicht.




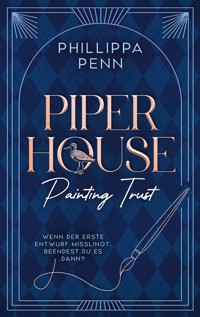














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









