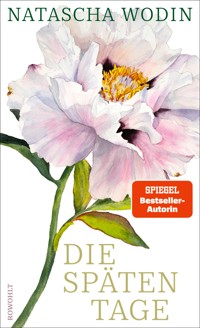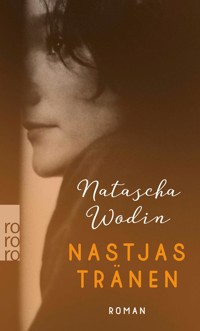9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Irgendwo in diesem Dunkel - Eine ungeheuerliche Geschichte von Ort- und Obdachlosigkeit im Nachkriegsdeutschland In Irgendwo in diesem Dunkel erzählt Natascha Wodin die Geschichte eines Mädchens, das als Tochter ehemaliger Zwangsarbeiter im Nachkriegsdeutschland lebt - misstrauisch beäugt und gemieden von den Deutschen, voller Sehnsucht, endlich ein Teil von ihnen zu sein. Die ältere der beiden Töchter ist sechzehn, ein mehrjähriger Aufenthalt in einem katholischen Kinderheim liegt hinter ihr. Sie lebt beim Vater in den "Häusern" am Fluss, abseits vom deutschen Städtchen, unter Verschleppten und Entwurzelten in einer Welt außerhalb der Welt. Dabei möchte sie so gern zu den Deutschen gehören, träumt davon, Ursula oder Susanne zu heißen und einen Handwerker zu heiraten, um ihrer russischen Herkunft zu entkommen. Doch der seit je gefürchtete Vater sperrt sie ein, verbietet ihr rote Schuhe zu tragen und zwingt sie zum Putzen. In einem Taftkleid der Mutter flieht sie in die Vogelfreiheit, die Schutzlosigkeit der Straße. Ausgehend vom Tod des Vaters in einem deutschen Altenheim, dessen Leben noch in der russischen Zarenzeit begonnen hat und fast das gesamte 20. Jahrhundert überspannt, begibt sich die Tochter auf die Suche nach dem Schlüssel zum Verstehen. Irgendwo in diesem Dunkel, hinter all dem Schweigen, hofft sie ihn zu finden. Natascha Wodin erzählt diese bewegende Geschichte eines Außenseiterdaseins in der klaren, um Sachlichkeit bemühten und doch von Emotion und Poesie getragenen Sprache, die ihresgleichen sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Natascha Wodin
Irgendwo in diesem Dunkel
Über dieses Buch
In «Sie kam aus Mariupol», ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, hat Natascha Wodin ihrer Mutter ein berührendes literarisches Denkmal gesetzt. Jetzt lässt sie ein Buch folgen, das an den Freitod der Mutter 1956 anschließt.
Erzählt wird die Zeit, als die ältere der beiden Töchter sechzehn ist, ein mehrjähriger Aufenthalt in einem katholischen Kinderheim liegt hinter ihr. Sie lebt beim Vater in den «Häusern» am Fluss, abseits vom deutschen Städtchen, unter Verschleppten und Entwurzelten in einer Welt außerhalb der Welt. Dabei möchte sie so gern zu den Deutschen gehören, möchte Ursula oder Susanne heißen und träumt von einem Handwerker, den sie heiraten könnte, um ihrer russischen Herkunft zu entkommen. Aber der seit je gefürchtete Vater sperrt sie ein. Sie soll keine roten Schuhe tragen, sie soll zu Hause putzen. In einem Taftkleid der Mutter flieht sie in die Vogelfreiheit, die Schutzlosigkeit der Straße.
Diese Geschichte eines Mädchens, das als Tochter ehemaliger Zwangsarbeiter im Nachkriegsdeutschland lebt – misstrauisch beäugt und gemieden von den Deutschen, voller Sehnsucht, endlich ein Teil von ihnen zu sein –, wird aus dem Rückblick erzählt, ausgehend vom Tod des Vaters in einem deutschen Altenheim. Sein Leben, das noch in der russischen Zarenzeit begonnen hat und fast das gesamte 20. Jahrhundert überspannt, ist für die Tochter immer ein Geheimnis geblieben. Irgendwo in diesem Dunkel, hinter all dem Schweigen, sucht sie den Schlüssel zum Verstehen. Eine ungeheuerliche Geschichte der Ort- und Obdachlosigkeiten, erzählt in der klaren, um Sachlichkeit bemühten und doch von Emotion und Poesie getragenen Sprache Natascha Wodins, die ihresgleichen sucht.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Das Gedicht auf Seite 142 von Natalja Gorbanewskaja erschien 1998 beim «Verband junger Literaten ‹Babylon›», und wurde von Natascha Wodin aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt.
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung: privat
ISBN 978-3-644-00165-7
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Oleg Dobrozrakow
in Dankbarkeit und Liebe
Es war ein stürmischer, verregneter Tag im Dezember. Ich steuerte das Auto durch die fränkische Mittelgebirgslandschaft, die kahl und abweisend unter den grauen, schnell ziehenden Wolken lag. Längst war der Ort, an dem ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht hatte, ein innerer Ort für mich geworden, der kaum noch Ähnlichkeit hatte mit der Realität, die ich jetzt durchs Autofenster sah. Der Wind schleuderte große, vereinzelte Regentropfen gegen die Windschutzscheibe, prallte in wütenden Böen aufs Dach.
Seit meinem letzten Besuch war eine lange Zeit vergangen. Ich fragte mich, ob die «Häuser» noch standen, in denen wir gewohnt hatten, die primitiven, für ehemalige Zwangsarbeiter erbauten Nachkriegsblocks, die außerhalb der ländlichen Kleinstadt lagen, an der Regnitz, die schon in den sechziger Jahren zu einem Teil des Rhein-Main-Donau-Kanals geworden war. Im Vorbeifahren konnte ich sie nicht sofort entdecken, erst auf den zweiten Blick begriff ich, was sich verändert hatte: Die Blocks waren verschwunden, jedenfalls deckte sich, was ich jetzt sah, nicht mit meiner Erinnerung. Mich blickten ganz neue, pastellfarbene Fassaden mit modernen Kunststofffenstern an, hinter denen Wohnungen mit Zentralheizung und Warmwasser zu vermuten waren. Man hatte die Blocks nicht abgerissen, ganz im Gegenteil, man hatte sie saniert. Es erschien mir unwirklich, aber nun gehörten sie zur Stadt, waren eingebettet in ein belebtes Neubaugebiet. Wer jetzt hier wohnte, sah aus den Fenstern nicht in die Wildnis, in das Niemandsland, das zwischen uns und den Deutschen gelegen hatte, sondern auf ein Einkaufszentrum an einer stark befahrenen Straße. Der einst abseitige, wie aus der Welt verbannte Ort war in einer gewöhnlichen Wohnlandschaft aufgegangen, im Organismus der Stadt, die für mich, als ich in den fünfziger und sechziger Jahren hier gewohnt hatte, der unerreichbare Planet der Deutschen gewesen war. Nichts hatte ich mir damals mehr gewünscht, als den «Häusern» zu entrinnen. Nun, im Jahr 1989, da kaum noch etwas an ihr früheres Erscheinungsbild erinnerte, war mir, als hätte man mir etwas genommen, das, ohne dass ich es wusste, ein Teil von mir geworden war.
Ich parkte vor dem Friedhof, wir stiegen aus. Meine Schwester machte eine zu laute, schrill klingende Bemerkung, Wolfgang, meine Freundin Heike und ich schwiegen. Zwei Minuten später standen wir vor der Scheibe des Leichenschauhauses, das mir von früher noch so gut bekannt war, und da sah ich ihn, den offenen Sarg, in dem der tote Körper meines Vaters lag. Der Anblick seines Todes erschien mir viel selbstverständlicher und natürlicher als das Leben seiner letzten Jahre.
Fast bis zu seinem siebzigsten Lebensjahr war er von zäher, beinah unnatürlicher Gesundheit gewesen, aber eines Nachts, als er zur Toilette gehen wollte, fiel er neben dem Bett hin und konnte nicht mehr aufstehen. Er war 1944 mit meiner Mutter aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol nach Deutschland gekommen, wo er als Zwangsarbeiter in einem Rüstungsbetrieb der Firma Flick arbeiten musste. Die ersten Jahre nach dem Krieg hatten wir in Lagern für Displaced Persons verbracht, schließlich wurde uns eine Wohnung in jenen Blocks zugewiesen, an denen ich eben vorbeigefahren war. Damals hatte man sie speziell für ehemalige Zwangsarbeiter erbaut, die, seit sie aus der Verantwortlichkeit der amerikanischen Besatzungsmacht entlassen und den deutschen Verwaltungsorganen übergeben waren, heimatlose Ausländer genannt wurden. Hier lebte mein Vater bis zu seinem Schlaganfall inmitten von Osteuropäern, auf einer Insel, auf der die deutsche Sprache weitgehend unbekannt war, allenfalls als eine Art Hilfsesperanto, mit dem sich die in babylonischer Sprachverwirrung lebenden Verschleppten aus dem gesamten osteuropäischen Raum radebrechend miteinander verständigten. In dem Altersheim, in das er nach dem Schlaganfall umziehen musste, befand er sich zum ersten Mal unter Deutschen, aber obwohl er jetzt Tür an Tür mit ihnen wohnte, gelang es ihm auch hier, seine deutsche Umwelt zu ignorieren – er lebte noch fünfzehn Jahre lang so weiter, als existiere diese Umwelt gar nicht. Die einzigen deutschen Wörter, die er in fast fünf Jahrzehnten in Deutschland gelernt hatte, waren «brauche» und «brauche nix». Das genügte ihm, um seiner deutschen Umgebung alles zu sagen, was er ihr zu sagen hatte.
Abgesehen von meiner Schwester, die weit entfernt wohnte und die er nicht öfter als einmal im Jahr sah, war ich, soviel ich wusste, bis zu seinem Tod der einzige Mensch, mit dem er sprach, einmal in vierzehn Tagen etwa, wenn ich ihn besuchte in seinem Zimmer mit Waschbecken und Balkon, den er nie benutzte, weil er den Blick in die Tiefe nicht mehr vertrug. Wie er sich mit dem deutschen Pflegepersonal verständigte, wusste ich nicht. In allen Angelegenheiten, die, wie minimal auch immer, über das Alltägliche hinausgingen, hatte er seit dem Tod meiner Mutter immer mich oder meine Schwester als Dolmetscherin gebraucht. Schon als Zehnjährige musste ich auf Ämtern dolmetschen, Formulare ausfüllen und alle anderen Verbindungen zur deutschen Umwelt herstellen, die sich nun einmal nicht vermeiden ließen. Seit das Leben meines Vaters in die Zuständigkeit der Medizin übergegangen war, wagte ich es kaum noch, meinen Wohnort zu verlassen, da ich jeden Augenblick gebraucht werden konnte zur lebensnotwendigen sprachlichen Vermittlung zwischen ihm und den Ärzten.
Im Jahr 1900 geboren, war er sein Leben lang immer so alt gewesen wie das Jahrhundert. Wann immer ich das Datum auf ein Blatt geschrieben hatte, standen die letzten zwei Zahlen für das Alter meines Vaters. Aber die Zeit blieb nicht stehen mit seinem Tod. Ich sah auf seine Leiche, und vor ihren Anblick schob sich ein weit zurückliegendes Bild, die Schlüsselszene unserer Beziehung. Ich war zehn Jahre alt, als meine Mutter sich im Oktober 1956 in der Regnitz ertränkte. Zu dieser Zeit war mein Vater nicht zu Hause, sondern auf Tournee mit dem russischen Kosakenchor, in dem er damals sang. Die Behörden suchten nach ihm, konnten ihn aber nicht finden. Mindestens zwei Wochen lang lag die Leiche seiner jungen Frau in einer Kühlkammer, während man erfolglos nach ihm fahndete. Ich hatte schon fast aufgehört, auf ihn zu warten, er schien für immer verschollen, da fand man ihn irgendwo in Spanien, und kurz darauf traf er zu Hause ein. Ich war gerade draußen, jemand rief es mir zu, und ich rannte sofort los, ich flog. Außer ihm und meiner Schwester, die erst vier Jahre alt war, hatte ich niemanden mehr. Er stand auf der Treppe vor unserer Wohnungstür, für die er keinen Schlüssel hatte, mit Hut, in seinem straff gegürteten Popelinemantel, neben ihm sein abgestellter Koffer. In meiner Vorstellung war ich jetzt, da seine Frau nicht mehr lebte, als die ältere seiner zwei Töchter ins Zentrum seines Lebens gerückt, seine erste Bezugsperson, mit der er alle wichtigen Dinge teilen und besprechen würde. Ich stürzte außer Atem auf ihn zu, aber in einer einzigen Sekunde prallte ich an ihm ab – an dem grün schimmernden Popeline seines Mantels, an seinem versteinerten Gesicht, in dem sich keine Miene verzog, als er mich erblickte. Er hatte im Treppenhaus nicht auf mich gewartet, sondern auf den Schlüssel. Wortlos nahm er ihn mir aus der Hand und schloss die Tür auf.
Auf meinem nächsten Erinnerungsbild saß er in der Küche und rauchte, eine Zigarette nach der anderen, Nacht für Nacht. Ich wusste, worüber er nachdachte, während er in den Rauch starrte, den er aus seinen Lungen ausstieß. Er musste wieder auf Tournee, er hatte nichts anderes als seine Stimme, um Geld zu verdienen, und er wusste nicht, wohin mit meiner Schwester und mit mir. Seine Frau hatte ihn allein gelassen mit den zwei Kindern, sie hatte ihn zum Witwer einer Selbstmörderin gemacht, ihn, den schon gealterten sechsundfünfzigjährigen Mann, den Fremdling, der sich mit nichts auskannte in Deutschland und keine Ahnung hatte, wie es jetzt weitergehen sollte. Ich stand im Nachthemd auf dem dunklen Flur und sah durchs Schlüsselloch in die Küche, sah meinen Vater am Tisch sitzen, mit seiner schwarzen Zigarettenspitze in der Hand, die er in kurzen Abständen zum Mund führte. Er saugte den Rauch mit zugekniffenen Augen ein, hielt ihn einen Atemzug lang in sich fest, dann stieß er ihn wieder aus, in das graue Gewölk, in dem er saß, reglos wie eine Sphinx, während sich hinter der steilen Falte auf seiner Stirn mein Schicksal entschied.
Immer, seit ich denken konnte, war es ein Fluch für mich gewesen, das Kind meiner Eltern zu sein. Ich wollte nicht zu einer Welt außerhalb der Welt gehören, zu den Fremden, den Aussätzigen, die hinter der Stadt wohnten, von allen gemieden und verachtet, irgendein Abschaum, von dem ich nicht wusste, wo er herkam und wie er entstanden war. Ich wollte deutsche Eltern haben, in einem deutschen Haus wohnen, wollte Ursula oder Susanne heißen. Nun, nachdem mein Vater eine Entscheidung getroffen hatte, kam ich der Erfüllung dieses Wunsches schwindelerregend nah.
Für meine Schwester hatte er eine Unterkunft bei zwei alten Frauen gefunden, die als einzige Deutsche noch hinter unseren Blocks in einem verwunschenen Häuschen am Fluss wohnten. Frau Lerner war eine aufgeschwemmte, herzkranke Alte mit wasserblauen Augen, die, wann immer meine Mutter sich über den Zaun hinweg mit ihr unterhalten hatte, um ihren Sohn weinte, der Pfarrer geworden war und irgendwo weit entfernt am Ort seiner Pfarrei lebte. Ihre winzige, ausgedorrte Schwester Kuni, eine alte Jungfer, ging so gekrümmt, als würde sie mit ihrer Nase die Erde pflügen. Wie mein Vater den beiden seinen Wunsch vermittelt hatte, eine seiner Töchter bei ihnen abzugeben, wusste ich nicht. Vielleicht hatte er jemanden aus den Blocks zum Dolmetschen mitgenommen, vielleicht hatten die mitfühlenden christlichen Frauen den russischen Witwer auch ohne Worte verstanden. Jedenfalls packte er einen Pappkoffer und lieferte meine Schwester in dem abgelegenen Häuschen am Fluss ab. Sie war verwirrt, verstand nicht, dass ihre Mutter tot war und nicht wiederkommen würde.
Den Platz für mich hatte er über eine Russin gefunden, mit der meine Mutter einmal befreundet gewesen war. Sie war keine von uns, sondern wohnte mit ihrem deutschen Mann, einem Rechtsanwalt, in einem der feinen Häuser in der Gartenstraße. Meine Mutter hatte sie manchmal besucht, bis der Rechtsanwalt, der auf seinen Ruf achten musste, seiner Frau den Umgang mit einer Bewohnerin der «Häuser» verbot. Offenbar hatte mein Vater es dennoch gewagt, sie aufzusuchen, jedenfalls machte sie ihn mit der deutschen Kriegerwitwe bekannt, die sich bereit erklärte, mich, die russische Halbwaise, gegen ein angemessenes Pflegegeld bei sich aufzunehmen.
Frau Drescher wohnte im Neubauviertel der Stadt, in einem der ersten futuristischen Hochhäuser mit Lifts und bunten Balkonen. Sie war eine große, hagere Frau, die immer eine Kittelschürze trug und jeden Samstag zur Wasserwelle ging. Ihre Tochter Rotraud, eine unterkühlte, spitzzüngige Schönheit, wurde von ihr ständig instruiert, wie sie ihren Freund, einen vielversprechenden jungen Ingenieur, behandeln müsse, um ihn auf Dauer zu halten. Rotraud sagte immer nur «pah», lackierte sich die Fingernägel mit Perlmuttlack oder drückte Mitesser vor dem Spiegel aus. Frau Dreschers Sohn, der kleine, dicke Bernhard, elfjährig wie ich, machte mit seiner Schwerfälligkeit seinem Namen alle Ehre – er ähnelte einem Bernhardiner.
Jeden Tag gab es zum Abendbrot etwas, das Schnittchen hieß. Ich kannte dieses Wort nicht und hatte Vergleichbares noch nie gesehen. Die dünn geschnittenen, präzise geviertelten Brotscheiben waren belegt mit Wurst, Gürkchen, Käse, Lachsschnitzeln oder gekochten Eiern mit Schnittlauch. Bei uns zu Hause hatte es immer nur Borschtsch und andere dickflüssige Suppen mit klobigen Brotstücken gegeben, auch das deutsche Essen, das ich in einem Erholungsheim für unterernährte Nachkriegskinder kennengelernt hatte, war nicht zu vergleichen mit Frau Dreschers Schnittchen, die allein durch ihren Anblick den ganzen Appetit in mir erweckten, den ich nie gehabt hatte – sie schienen mir der ureigentliche Ausdruck des Deutschen zu sein. Ich stopfte ein Schnittchen nach dem andern in mich hinein, ich konnte nicht genug davon bekommen, aber nach ein paar Tagen, in denen ich die befremdeten Blicke der anderen schon deutlich auf mir gespürt hatte, erklärte mir Frau Drescher, dass für die Mengen, die ich verschlang, das Geld nicht reichen würde, das mein Vater ihr für mich bezahlte. Immer war ich bisher ermahnt worden, mehr zu essen, weil ich so mager war, jetzt erfuhr ich, dass es unanständig sei, so viel zu essen. Mein Anteil an den Schnittchen wurde reduziert, aber mein Appetit war nicht das Einzige, was Frau Drescher an mir missfiel. Das Geld meines Vaters stand in keinem Verhältnis zu der Zumutung, die ich für sie darstellte. «Man merkt sofort, wo du herkommst», waren ihre geflügelten Worte, die ich schon mein Leben lang hörte. Sie trafen ins Schwarze meiner Scham und zerstörten immer wieder meine Hoffnung, dass mir gerade meine Herkunft aus den «Häusern» vielleicht doch nicht anzumerken sei.
Ich fraß Frau Drescher nicht nur die wassergewellten Haare vom Kopf, ich war auch ungezogen, faul, frech, ich log, wenn ich den Mund aufmachte, ich vernachlässigte meine Hausaufgaben und zierte mich, wenn ich mich morgens gemeinsam mit Bernhard im Bad ausziehen und waschen sollte. In dieser Scham erkannte Frau Drescher ein Zeichen meiner Verdorbenheit. Immer wieder klatschte mir ihre harte Kriegerwitwenhand ins Gesicht, und mehrmals musste ich meinem Vater auf Russisch Briefe schreiben, in denen ich ihn im Namen von Frau Drescher aufforderte, entweder mehr Pflegegeld für mich zu überweisen oder mich sofort wieder abzuholen. Mein Vater, dem die Post durch eine Konzertagentur nachgesandt wurde, antwortete nicht, er schien erneut verschollen, aber eines Tages stand er in seinem Popelinemantel unangekündigt vor der Tür. Ohne seinen Hut abzunehmen, ließ er Frau Dreschers wütende Klagen und Vorwürfe über sich ergehen, dann nahm er wortlos den Koffer mit meinen gepackten Sachen entgegen und brachte mich ins städtische Waisenhaus.
Ich sehe einen rostigen Maschendrahtzaun vor mir, einen großen kalten Waschraum mit vielen Wasserhähnen und meine Füße in hässlichen braunen Schnürschuhen. Diese Füße sehe ich rennen, immerzu rennen, ich weiß nicht, warum und wohin, doch ich erinnere mich, dass ich gedacht habe, ich muss doch schwarze Schuhe tragen, weil meine Mutter gestorben ist, alle tragen Schwarz, wenn jemand gestorben ist, aber meine Schuhe, in denen ich renne und renne, die sind braun.
Lange durfte ich nicht im Waisenhaus bleiben, weil ich keine Vollwaise war, sondern noch einen Vater hatte. Nach einer Zeit, an deren Dauer ich mich nicht erinnere, musste er mich erneut abholen, und gleich darauf starb Frau Lerner, bei der meine Schwester untergebracht war, an ihrer Herzkrankheit. Die krumme Kuni, die allein zurückblieb, konnte sich selbst kaum versorgen, geschweige denn ein Kind. So verlor auch meine Schwester ihre Bleibe. Und wieder saß mein Vater Nacht für Nacht in der Küche und rauchte.
Hilfe kam diesmal von Frau Lerners Sohn, dem katholischen Pfarrer. Er hatte Beziehungen zur Bischofsstadt Bamberg und vermittelte uns, meiner Schwester und mir, Plätze in einem katholischen Mädchenheim. Es wurde von Nonnen geführt, die sich Schwestern vom Göttlichen Erlöser nannten. Hinter den schweren alten Klostermauern verschwanden wir für fast fünf Jahre aus der Welt.
Daran erinnerte ich mich, während ich durch die Glasscheibe auf meinen toten Vater sah. Ich wusste, dass es gegen die Regeln moderner deutscher Bestattungspietät verstieß, aber ich hatte ihn nach russischer Sitte im geöffneten Sarg aufbahren lassen. Einer dunklen Logik folgend, hatte das von mir beauftragte Bestattungsinstitut ihm, dem im Leben so viel Gewalt widerfahren war, auch im Tod noch Zwang angetan. Immer war mein Vater akkurat rasiert gewesen, erst in den letzten Monaten seines Lebens, als er den Rasierapparat nicht mehr halten konnte, war ihm ein dünner, filziger Bart gewachsen. Die zwei weißen Spritzer in diesem Bart verrieten den Grund für den lächerlichen Ausdruck seines Totengesichts. Sie mussten von der Masse stammen, mit der seine Mundhöhle gefüllt worden war, das zahnlose Loch, in das er mit der letzten Atemluft seine Lippen eingesogen hatte, und bei der Behebung dieses Malheurs war man nicht gerade sorgfältig vorgegangen. Die nach außen geschürzten Lippen kräuselten sich über der Füllmasse in seinem Mund, es sah aus wie bei einem albernden Kind, das im Begriff war, jemanden anzuprusten.
Er trug die Kleidung, die ich für ihn ausgesucht hatte, seinen dunkelblauen Sonntagsanzug, das weiße Hemd und die silbergraue Krawatte, auf die er stets bei feierlichen Anlässen zurückgekommen war. Die Sachen passten ihm nicht mehr, sein winziger, kaum noch vorhandener Körper versank in den Falten des verrutschten Jacketts, der abstehende Hemdkragen gab seinen dünnen, runzligen Hals preis, der mich an den eines gerupften Huhns denken ließ. Alle seine Glieder schienen sich auf dem Transport zum Friedhof verzogen zu haben, er lag schief und krumm in dem hölzernen, mit Rüschenpapier ausstaffierten Kasten, die Hände waren über dem weißen Pappmaché gefaltet, mit dem der untere Teil seines Körpers bedeckt war. Irgendeinen Rest meines einstigen, zu meiner Kindheit und Jugend gehörenden Vaters erkannte ich in diesen Händen, die in den letzten Jahren kaum noch ein Wasserglas hatten halten können und jetzt an die gefältelten, fast stofflosen Flügel einer Fliege erinnerten, aber selbst dieser Anblick rührte noch an den Schrecken, den sie mir früher eingeflößt hatten.
Als Kind und als Jugendliche hatte ich meinem Vater inbrünstig den Tod gewünscht. Ich hatte mir vorgestellt, wie ich ihn meuchlings in den Fluss stieß, in dem meine Mutter sich ertränkt hatte, wie ich ihn vergiftete oder mit einem Messer erstach, ich hatte ihn als siechen, gelähmten alten Mann vor mir gesehen, der mir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Wenn er eines Tages, schwach und hilflos geworden, auf mich angewiesen sein würde, wollte ich ihn eiskalt seinem Untergang überlassen, genauso wie er einst mich dem meinen.
Später, ich war längst erwachsen, besuchte ich ihn etwa zweimal im Monat im Altersheim. Er war gelähmt, er war siech, er war alt, denen, die ihn pflegten, ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Um ihn jetzt zu töten, wäre nicht mehr nötig gewesen, als ihn für ein paar Tage einfach nur zu vergessen, ein einziger Schlag von denen, die seine Faust früher zu Dutzenden auf mich niederfahren ließ, hätte gereicht, um sein Leben auszulöschen. Es hätte genügt, ihm einen Tag lang seine Medikamente zu entziehen, und er hätte es nicht überlebt.
Doch niemand tat ihm den Gefallen. Niemand erlöste ihn von dem Martyrium seines zu Tode erschöpften Körpers, an dem es kaum noch etwas Menschliches gab, niemand erlöste ihn von dem Rest seines Lebens, das längst zu einer Unnatur geworden war. Ein Greis von biblischer, von monströs gewordener Langlebigkeit – als wäre der Tod die letzte menschliche Schwäche, die ihm, der Schwäche immer verachtet hatte, nun zu seiner Erlösung versagt blieb, damit er sie bis ans Ende auslitte an sich selbst. Es war, als bannte ihn etwas ins Diesseits, als gäbe es eine Schuld, die ihn zu einer unmenschlichen Lebenszeit verdammt hatte – als müsste er die Jahre nachleben, die meine Mutter noch gelebt hätte bis zu ihrem natürlichen Tod, als wäre er gestraft mit den Jahren, um die ihr Leben zu kurz gewesen war. Als sie starb, war er schon fast ein alter Mann, aber dreißig Jahre später lebte er immer noch. Beinah ein ganzes Jahrhundert drängte sich zusammen in seiner winzig gewordenen Gestalt, in seinem verdorrten, erstarrten Körper, den das Leben so hart gemacht hatte, dass er nicht sterben konnte. Manchmal erinnerte er mich an Michail Bulgakows Pontius Pilatus, der irgendwo allein im Universum auf einem steinernen Thron saß und, für immer schlaflos, ins Licht des Mondes starrte.
Das Altersheim war ein riesiges, sechsstöckiges Betongebäude, das der evangelischen Kirche gehörte. Es befand sich in einer der für die Nachkriegszeit typischen Siedlungsgegenden, in denen die Straßennamen den verlorenen deutschen Osten beschworen: Breslauer Straße, Königsberger Straße, Stettiner Straße. Schon am Schmuck der Eingangstür erkannte man die Jahreszeit: Fasching, Ostern, Erntedank, Weihnachten. Alles war modern, hell, alles blitzte und blinkte. Die Zimmer hatten fließendes kaltes und warmes Wasser, die meisten einen Balkon. So luxuriös hatte mein Vater noch nie gewohnt. Es gab eine Kellerbar, einen Gymnastikraum, eine Hauskapelle, man konnte Lichtbildvorträge und Volksmusikkonzerte besuchen, aber von alldem nahm er keine Notiz. Er verließ sein Zimmer nur, um die Mahlzeiten im Speisesaal einzunehmen und zur Toilette zu gehen, solange er das noch konnte.
Nie wusste ich, ob er Wert auf meine Besuche legte oder ob sie ihm womöglich lästig waren. Er saß in seinem mit Kissen und Windeln ausgepolsterten Sessel, klein, grau, entrückt in die Moränenlandschaft seiner zerstörten Gefäße, in denen er dem Tropfen einer unendlichen Zeit nachzulauschen schien. Immer hatte er meine Mutter und später auch mich mit seinem Sauberkeits- und Ordnungswahn verfolgt, immer hatte er uns die beispielhafte deutsche Ordnung vorgehalten, die er selbst nur vom Hörensagen kennen konnte – nun hatte die Ironie des Schicksals ihn an einen Ort verpflanzt, der sein ganzes Deutschlandbild auf den Kopf stellen musste. Hinter den pieksauberen Fassaden des Altersheims saß er im Schmutz. Verstaubte Möbel, ungewaschene Vorhänge, ein schmuddeliger Teppichboden, Asseln im Waschbecken. Für Menschen wie meinen Vater schien hier niemand zuständig zu sein. Er war ein Grenzfall, sehr schwach und hinfällig, aber noch nicht schwach und hinfällig genug, um auf die Pflegestation verlegt zu werden. Es war, als hätte man ihn tatsächlich vergessen, als hätte sich um ihn bereits zu Lebzeiten eine Todeszone gebildet.
Obwohl sein Alltag nichts als eine Abfolge elementarster Handgriffe und Schritte war und er fast die ganze Zeit im Sessel saß, schien dieser Alltag ihm eine übermenschliche Anstrengung abzuverlangen, die offenbar nur darin bestand, am Leben zu sein. Er war fast blind und orientierte sich hauptsächlich an Geräuschen. Manchmal schien mir, sein angestrengtes Lauschen gelte der Akustik im Innern seines Körpers, dem Lärmen seiner Organe, einer ausgedienten Maschinerie, die in den letzten Zügen lag.
Ich hasste ihn immer noch, aber noch schlimmer war mein Mitleid mit ihm. Es fühlte sich an wie Salzsäure in mir, wie Fieber, das mich auszehrte. Aus jeder Entfernung erreichten mich die seismographischen Ausschläge seiner Schmerzen, mein Körper signalisierte mir, was ihm gerade wehtat, ich fühlte es in meinen eigenen Organen, in meinem eigenen Gewebe. Es war, als hätte er mich endlich doch noch besiegt, als wäre ihm meine Unterwerfung schließlich doch geglückt, als hätte er mit seiner Schwäche und seiner Verlassenheit erreicht, was ihm einst mit seiner Kraft nicht gelungen war. Nichts wollte ich damals weniger sein als sein Kind – jetzt ertrug ich es nicht, dass er schwächer war als ich, dass ich, da er mein Kind geworden war, nicht mehr sein Kind sein konnte. Ich lebte in einem ständigen Kampf gegen die Zusammenbrüche meines Körpers, gegen eine Schwäche, die, um die seine zu übertreffen, nur noch die Schwäche des Todes hätte sein können.
Und weil es mich immer mehr in diese letzte Schwäche zog, die mich am Ende doch noch zu seinem Kind gemacht hätte, phantasierte ich wieder, wie früher, seinen Tod. Ich phantasierte, ihn zu ersticken, indem ich ihm ein Kissen aufs Gesicht drückte, um sein Leiden nicht mehr mit ansehen zu müssen, um erlöst zu werden von meinem selbstmitleidigen Mitleid. In den Nächten lag ich wach und kämpfte mit ihm – ich rang mit ihm um mein Leben, als wäre das seine nicht nur noch das einer Motte, die schon im allerletzten Rest ihres Silbers lag. In meinen Träumen erschien er mir in immer neuen, unheimlichen Gestalten, als schwerer, heißer, von oben bis unten bandagierter Körper, den ich auf meinen Armen treppab tragen musste und der, ließe ich ihn fallen, in tausend Scherben zerspringen würde. Er erschien mir als böser, gestikulierender Zwerg, der in einem bizarren Möbel, das Thron und Krankenbahre in einem war, zu meiner Wohnung hinaufgetragen wurde, um Gericht über mich abzuhalten.
Immer besuchte ich ihn bei Dunkelheit, die mir Geleitschutz geben musste, und immer schleppte ich mich lieber die fünf Treppen zu ihm hinauf, als den Lift zu benutzen – aus Angst, ich könnte stecken bleiben, im letzten Moment doch noch für immer in seine Gefangenschaft geraten.
In den Jahren im Heim hatte ich fast vergessen, dass ich irgendwo draußen in der Welt noch einen Vater hatte. Ich war immer schon von der Welt abgeschnitten, seit dem Tag meiner Geburt, aber jetzt gab es nur noch dieses jenseitige Reich aus Schlafsälen, Speisesälen, Lernsälen, Rosenkränzen, Messen, Hochämtern, ein Leben mit Exerzitien und immerwährenden Gebeten: Beten nach dem Aufstehen, Beten bei der Morgenandacht in der Kapelle, Beten vor dem Frühstück, Beten nach dem Frühstück, Beten vor der ersten Unterrichtsstunde, Beten in den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden, Beten nach Schulschluss, Beten vor dem Mittagessen, Beten nach dem Mittagessen, Beten vor der Mittagsruhe, Beten nach der Mittagsruhe, Beten vor dem Lernen, Beten nach dem Lernen, Beten vor dem Abendessen, Beten nach dem Abendessen, Beten bei der Abendandacht in der Kapelle, Beten vor dem Schlafengehen. Und auch dazwischen immer Beten, innerlich, jeder für sich, Vater unser, der du bist im Himmel … vergib uns unsere Schuld … mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa … Schuld, Schuld ohne Anfang und Ende. Das hatte ich nicht gewusst, dass ich schon kraft Geburt schuldig war und dass man beten, immerzu beten musste, denn sobald eine Lücke beim Beten entstand, konnte durch diese Lücke sofort der Satan in uns fahren. Ich war in ein Schuldgefängnis geraten, in dem man seine Schuld nicht absaß, sondern ständig einatmete, wie die giftige Luft einer Bleikammer, so lange, bis man erstickte. Sogar nachts im Schlaf hörte man die Schuld durchs Haus geistern. Eine verstorbene Nonne, die ihr Armutsgelübde gebrochen und Geschenke für sich behalten hatte, anstatt sie beim Orden abzuliefern, kam Nacht für Nacht zurück und suchte nach ihrem sündigen Diebesgut, das sie überall im Haus versteckt hatte. Man hörte das Rascheln und Scharren in den Wänden, das leise Wimmern und Klagen der unerlösten Seele.
Als Elfjährige war ich in die Gruppe der Großen gekommen, die von Schwester Marie-Joseph geleitet wurde, einer dicken, rotgesichtigen Frau, die alle fürchteten. Generationen undankbarer Heimkinder hatten ihre Nerven ruiniert, so jedenfalls wurde ihr jähzorniges, cholerisches Temperament erklärt. Ihre flinken, an Sprungfedern erinnernden Hände fürchtete ich fast genauso, wie ich einst die meines Vaters gefürchtet hatte. Manchmal schlug sie uns auch mit Gegenständen, mit einer Triangel oder Rassel aus dem Musikzimmer, manchmal, wenn sie nichts anderes zur Hand hatte, verwendete sie ihren langen Rosenkranz aus schweren Holzperlen, den sie um die Taille trug – ein immer parates Züchtigungsinstrument.
Und nicht selten hörte man aus dem Refektorium die Geräusche tätlicher Auseinandersetzungen. Die Nonnen schlugen nicht nur ihre Zöglinge, sondern drangsalierten sich auch gegenseitig. Sie alle schienen einander aus tiefster Seele zu hassen, man hörte, wie sie sich schubsten und traten, ihr Kreischen klang, als würden sie einander den Schleier vom Kopf reißen und an den Haaren zerren. Die meisten von ihnen waren wahrscheinlich nicht freiwillig ins Kloster eingetreten, sie stammten aus armen Familien, die ihre vielen Kinder nicht ernähren konnten und deshalb eines von ihnen Gott opferten. So schlug man zwei Fliegen mit einer Klappe. Man hatte ein Maul weniger zu stopfen und konnte dereinst, nach dem Tod, auf eine bevorzugte Behandlung am Himmelstor hoffen.
An den Wochenenden und Feiertagen durften die anderen Mädchen in einem bestimmten Turnus nach Hause fahren, zu Ostern, zu Weihnachten und in den ausgedehnten Sommerferien war das Haus leer. Nur ich und Gretl, ein Waisenkind mit einem Wolfsrachen und pfeifendem Atem, waren immer da. Auch meine Schwester war natürlich da, aber die durfte ich nicht sehen. Nach unserer Ankunft hatte man uns sofort getrennt, sie kam in die Gruppe der Kleinen, ich in die Gruppe der Großen. Der Kontakt zwischen diesen zwei Altersgruppen war nicht erlaubt, offenbar fürchteten die Klosterschwestern anarchistische Umtriebe, außerdem mussten die Kleinen vor der Verderbtheit der Großen geschützt werden. So vergaß ich mit der Zeit auch meine Schwester. Wenn ich ihr einmal auf einem der langen Korridore begegnete, begann sie zu weinen und sich an mich zu klammern, aber ich versuchte, sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden, weil ich mich vor Schwester Marie-Josephs Strafe fürchtete. Wir alle zitterten Tag für Tag vor ihrer schlechten Laune, vor ihren regelmäßigen Strafgerichten über uns, die wie eine unabwendbare Naturgewalt über uns herein brachen.
Manchmal war es auch schön. Wenn wir Theater spielten oder sangen. Ein Sonntag, irgendein Feiertag, an dem es zum Frühstück Kakao gab, die Sonne schien durch die hohen staubigen Fenster im Speisesaal, und wir sangen: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren … Meine Stimme floss mit den Stimmen der anderen, deutschen Kinder zusammen, ein jubelnder, ekstatischer Lobgesang.
Zwei-, dreimal im Jahr bekam ich eine bunte Ansichtskarte von meinem Vater. Schwester Marie-Joseph, die jeden eingehenden Brief vor der Aushändigung öffnete und las, befahl mir, den Inhalt der Karte aus dem Russischen zu übersetzen, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr konnte, denn auch das Russische hatte ich schon fast vergessen. Mühsam entzifferte ich die belanglosen, nichtssagenden Worte, unter den misstrauischen Blicken von Schwester Marie-Joseph, die mir nicht glauben wollte, dass mein Vater mir nichts Wichtigeres schrieb. Ich bewahrte die Karten in meinem Spind auf und betrachtete sie hin und wieder. Der Eiffelturm, der in einer Stadt namens Paris stand, eine Flamencotänzerin mit einem Rock aus fliegenden roten Volants, ein Meeresstrand mit Strandkörben und Menschen in Badeanzügen. Irgendwo dort war mein Vater, in der fernen, für mich unerreichbaren Welt, die ich, so schien es mir, nie im Leben sehen würde.
Hatte meine negative Besonderheit bisher immer darin bestanden, dass ich nicht deutsch war, so bestand sie jetzt darin, dass ich nicht katholisch war. Ich kannte nur das russisch-orthodoxe Kreuzzeichen, ich durfte nicht beichten, damit mir meine Sünden vergeben wurden, in der Morgenmesse, wenn die anderen zur Kommunion nach vorn gingen, blieb ich allein in der Kirchenbank zurück, ich war nie ein kleines weißes Bräutlein Christi geworden, ich wusste nicht einmal, ob ich getauft war. Das Nichtdeutschsein war eine Verdammnis auf Erden, das Nichtkatholischsein die Verdammnis in Ewigkeit, weil nur Katholiken in den Himmel kamen. Für mich gab es bloß ein endloses Fallen, Tag für Tag, jahrelang, sogar noch im Schlaf fühlte ich dieses ständige Sündenfallen auf die Hölle zu.
Das Ende dieses Fallens verdankte ich einer Tragödie, die meinem Vater widerfahren war. Er hatte seine Stimme verloren, seinen kostbarsten, eigentlich einzigen Besitz. Schon als Knabe hatte er gesungen, im Kirchenchor seiner Heimatstadt in Kamyschin an der Wolga, wo er noch in der Zarenzeit geboren war. Später, in den Nachkriegsjahren in Deutschland, hatte er mit seiner Stimme zum ersten Mal etwas Geld verdient und uns damit vor dem Hunger gerettet. Angeblich war es ein zu kalt getrunkener Rotwein gewesen, der seine Stimme ruiniert hatte, aber da ich ihn seit je als Trinker kannte, fragte ich mich, ob es wirklich an der Temperatur des Weins gelegen hatte oder ihm nicht vielmehr die Menge zum Verhängnis geworden war. Jedenfalls reiste er nicht mehr und nahm mich und meine Schwester wieder zu sich.
Seinen Alkoholismus hatte er schon aus Russland mitgebracht, und das Leben in Deutschland war nicht dazu angetan gewesen, ihn zu kurieren. Außerdem erinnerte ich mich, dass er schon früher, wenn er in Tourneepausen zu Hause war, meiner Mutter von Streitigkeiten mit anderen Chormitgliedern erzählt hatte, es schien eine verschwimmende Grenze zwischen seiner Trunksucht und irgendwelchen geheimnisvollen Dingen zu geben, die in seinem Leben vor meiner Geburt begraben lagen, in seiner Vergangenheit in der anderen, kommunistischen Welt. Niemals hörte ich meine Eltern über diese Vergangenheit sprechen, ich schnappte immer nur Andeutungen auf, die ich nicht verstand, aber jedes Mal spürte ich, dass sich irgendwo in diesem Dunkel der Schlüssel zu ihrem Leben verbarg. Alles schien von Anfang an um dieses Geheimnis zu kreisen, und weil das Eigentliche unaussprechlich war, war bei uns immer alles unaussprechlich gewesen, schon die simpelste, belangloseste Wahrheit war so etwas wie Gift, das auf keinen Fall in den Mund genommen werden durfte. Die einzig sichtbare Wahrheit war für mich immer nur das Entsetzen in den Augen meiner Mutter gewesen, das mit jedem Tag zu wachsen schien, bis sie schließlich ganz aufhörte zu sprechen und nur noch auf einem Stuhl saß und ins Leere starrte, bevor sie ins Wasser der Regnitz ging.
In all dem Verschwiegenen mochte sich auch der Grund dafür verbergen, dass mein Vater zurückgekommen war. Vielleicht war etwas Schlimmes über seine Vergangenheit in der Sowjetunion herausgekommen, vielleicht hatte man ihn deshalb aus dem Chor geworfen, vielleicht hatte ihn seine Geschichte eingeholt und seiner Existenz beraubt, gemeinsam mit dem Alkohol. Aber vielleicht war er der jahrelangen Tingelei auch einfach müde geworden, vielleicht waren seine Stimmbänder erschlafft, was bei einem Mann von über sechzig Jahren nicht abwegig war. Erst hatte er seine Frau, dann seine Stimme verloren, ohne die ich ihn mir gar nicht vorstellen konnte. Seine Stimme war immer das Wichtigste an ihm gewesen, sein Wesen, seine Substanz, ohne seine Stimme war mein Vater gar nicht mein Vater. Nach seinem Ausscheiden aus dem Chor hatte ich ihn nie wieder singen gehört, erst als er im Altersheim war, versuchte er zwei- oder dreimal mit dünner, brüchiger Stimme, eines der alten Lieder anzustimmen, Lieder, die wir früher, als meine Mutter noch lebte, so oft auch zu Hause gesungen hatten. Nach ihrem Tod waren diese Lieder für immer verstummt.