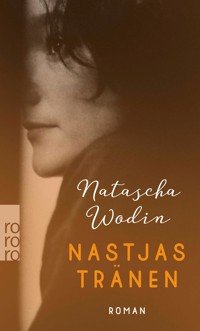
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt, sucht sie jemanden, der ihr beim Putzen hilft. Sie gibt eine Annonce auf, und am Ende fällt die Wahl auf eine Frau aus der Ukraine, dem Herkunftsland ihrer Mutter, die im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt wurde. Nastja, eine Tiefbauingenieurin, konnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr überleben − ihr letztes Gehalt bekam sie in Form eines Säckchens Reis ausgezahlt. Da sie ihren kleinen Enkelsohn und sich selbst nicht länger ernähren kann, steigt sie, auf etwas Einkommen hoffend, in einen Zug von Kiew nach Berlin. Dort gelingt es ihr, mehrere Putzjobs zu finden, nach getaner Arbeit schläft sie auf dem Sofa ihrer Schwester. Zu spät bemerkt sie, dass ihr Touristenvisum abgelaufen ist. Unversehens schlittert sie in das Leben einer Illegalen, wird Teil der riesigen Dunkelziffer an Untergetauchten im Dickicht der neuen, noch wildwüchsigen deutschen Hauptstadt. Für Natascha Wodin ist es, als würde sie von ihrem Schicksal erneut eingeholt. Im Heimweh dieser Ukrainerin, mit der sie mehr und mehr eine Freundschaft verbindet, erkennt sie das Heimweh ihrer Mutter wieder, die daran früh zerbrochen ist. Jetzt, Jahre später, zeichnet sie mit verhaltener, tief anrührender Poesie das Porträt von Nastja, einer kämpferischen Frau.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Natascha Wodin
Nastjas Tränen
Roman
Über dieses Buch
Als Natascha Wodin 1992 nach Berlin kommt, sucht sie jemanden, der ihr beim Putzen hilft. Sie gibt eine Annonce auf, und am Ende fällt die Wahl auf Nastja aus der Ukraine, dem Land, aus dem Natascha Wodins Eltern stammten, die im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt wurden. Nastja, eine Tiefbauingenieurin, konnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im wirtschaftlichen Chaos ihrer Heimat nicht mehr überleben. Ihr letztes Gehalt bekam sie in Form eines Säckchens Reis ausgezahlt – zu wenig, um sie und ihren kleinen Enkelsohn zu ernähren; also stieg sie, auf etwas Einkommen hoffend, in einen Zug nach Berlin. Doch kaum ist ihr Visum dort abgelaufen, schlittert sie in das Leben einer Illegalen, wird Teil der riesigen Dunkelziffer an Untergetauchten im Dickicht der neuen, noch wildwüchsigen deutschen Hauptstadt.
Für Natascha Wodin ist es, als würde sie von ihrem Schicksal erneut eingeholt. Im Heimweh dieser Ukrainerin, mit der sie mehr und mehr eine Freundschaft verbindet, erkennt sie das Heimweh ihrer Mutter wieder, die daran früh zerbrochen ist. Jetzt, Jahre später, zeichnet sie mit verhaltener, tief anrührender Poesie das Porträt von Nastja, einer kämpferischen Frau.
Vita
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt «Die gläserne Stadt», das 1983 erschien, folgten etliche Veröffentlichungen, darunter die Romane «Nachtgeschwister» und «Irgendwo in diesem Dunkel». Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für «Sie kam aus Mariupol» bekam sie den Alfred-Döblin-Preis, den Preis der Leipziger Buchmesse und den Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 verliehen. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Gabrielle Duplantier/plainpicture
ISBN 978-3-644-01079-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Eckhard
Благодарю Вас, милый друг
Alexander Vertinsky
Wir kamen beide zur selben Zeit nach Berlin, ich aus einem idyllischen Winzerstädtchen in der Südpfalz, Nastja aus der Hauptstadt der damals bankrotten Ukraine. Es war der dritte Sommer nach dem Mauerfall, sie war mit einem Touristenvisum unterwegs, ich hatte mich in ein neues Leben in Berlin aufgemacht, wie damals viele. Meine seit langem angeschlagene Wirbelsäule hatte mir den Umzug allerdings so übelgenommen, dass ich jemanden brauchte, der mir beim Auspacken der Umzugskisten half und meine Wohnung putzte.
Ich gab eine Annonce in der «Zweiten Hand» auf und ahnte nicht, was ich damit auslösen würde. Ab sechs Uhr am Morgen klingelte mein Telefon. Es riefen vor allem Osteuropäerinnen an, die deutlich an ihrem Akzent zu erkennen waren. Bis zu dem abgelegenen Winzerstädtchen nahe der französischen Grenze waren die seit dem Mauerfall nach Deutschland strömenden Osteuropäer noch nicht vorgedrungen, auf deutschem Territorium waren sie mir in meinem bisherigen Leben nur selten über den Weg gelaufen, jetzt stürmten sie mein Telefon in Berlin. Vor allem waren es Polinnen und Russinnen, die ihr Glück in der neuen Ost-West-Stadt mit ihrer Goldgräberstimmung suchten. Es rief auch ein Mann an, der meine Anzeige offenbar falsch verstanden hatte und mir Dienste ganz anderer Art anbot, außerdem eine Araberin, die später in Begleitung ihres Mannes vorbeikam und sich von ihm die Kiefer aufdrücken ließ, damit ich an ihrem Gebiss erkennen konnte, wie stark sie war. Bis zum Abend wusste ich nicht mehr, wie viele Frauen ich gesprochen und gesehen hatte, wie viele Lenas, Tanjas und Katjas. Eine von ihnen konnte damit punkten, dass sie Götz Georges Hemden bügelte. Eine andere weinte ins Telefon, ich verstand nicht, was sie sagte, nur dass offenbar ihre Mutter krank war. Am zweiten Tag war ich so erschöpft von den vielen fremden Stimmen und Gesichtern, dass ich beschloss, die nächstbeste Bewerberin zu nehmen, die bei mir an der Tür läuten würde.
Die Treppe herauf kam eine sehr schmale, schüchtern wirkende Frau, die etwa fünfzig Jahre alt sein mochte, aber aussah wie ein Mädchen. Sie trug Jeans und einen Rucksack auf den Schultern, auf den ersten Blick hätte man sie für eine typische Erscheinung der Prenzlauer-Berg-Szene halten können, doch bei näherem Hinsehen verrieten das altmodische, verwaschene Blüschen und die manierliche Haarspange die Herkunft aus einem anderen Teil der Welt. Sie stellte sich als Nastja aus Kiew vor, überglücklich, dass sie mit mir Russisch sprechen konnte.
Am Anfang drang es mir gar nicht ins Bewusstsein, dass sie nach meiner Mutter die erste Ukrainerin war, mit der ich es in Deutschland zu tun hatte. Meine Mutter war 1944 als Zwangsarbeiterin nach Deutschland gekommen, eine von Millionen, die aus der Sowjetunion ins Dritte Reich verschleppt wurden und als Arbeitssklaven für die deutsche Kriegsindustrie schuften mussten. Im letzten Kriegsjahr hatte sie mich geboren und sich elf Jahre später in einem deutschen Fluss ertränkt, rechtlos, perspektivlos, zerstört von den Gewalten, in deren Mahlwerk ihr Leben geraten war. Jetzt, fast vierzig Jahre nach ihrem Tod, war für mich der Gedanken- und Gefühlsweg von ihr bis zu dieser in die Gegenwart gehörenden Ukrainerin zu weit, Nastja selbst eine zu unwirkliche Gestalt für mich. Die Grenze zwischen der westlichen und der östlichen Welt war durch mein ganzes Leben verlaufen, sie hatte sich so tief in mein Inneres eingeprägt, dass ihr Verschwinden in der äußeren Welt für mich nicht fassbar wurde. Eine Ukrainerin, die in meiner Wohnung in Berlin die Möbel abstaubte, konnte es gar nicht geben.
Eines Tages, Nastja kam schon seit zwei oder drei Monaten zu mir, legte ich eine alte, vor langer Zeit in Moskau gekaufte Schellackplatte mit ukrainischer Volksmusik auf, wehmütige, von Kopfstimmen getragene A-cappella-Gesänge aus der Herkunftswelt meiner Mutter, einer Ukraine, der ich auf meinen flüchtigen Arbeitsreisen als Dolmetscherin nie begegnet war. Ich hatte Nastja mit der Musik eine Freude machen wollen, aber stattdessen brach sie, die immer so zurückhaltend und scheinbar unbeschwert gewesen war, in Tränen aus.
So begann meine Geschichte mit ihr. Schlagartig erkannte ich in ihren Tränen das Heimweh meiner Mutter wieder, dieses grenzenlose, unheilbare Gefühl, das das Rätsel meiner Kindheit gewesen war, das Mysterium meiner Mutter, die große dunkle Krankheit, an der sie gelitten hatte, solange ich sie kannte. Fast jeden Tag hatte ich ihre Tränen gesehen, und ich hatte immer gespürt, dass ich gegen das, was sich Heimweh nannte, keine Chance hatte, dass meine Mutter sich jeden Tag ein wenig mehr darin verlor, dass sie unentwegt im Verschwinden begriffen war, dass sie eines Tages endgültig weg sein und nur noch das Heimweh von ihr zurückbleiben würde.
Nastja war drei Jahre vor Kriegsende in einer ländlichen Kleinstadt mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil in der westlichen Ukraine geboren worden. Einst, vor der Revolution, vor dem Krieg, als die Ukraine noch als Kornkammer Europas galt, hatte der Ort inmitten endloser Weizenfelder gelegen, in denen die kleinen Dörfer und Städte zu versinken schienen. Die zwei Farben der ukrainischen Nationalflagge stehen noch heute für das Gelb genau dieser Weizenfelder mit dem Blau des Himmels darüber.
An den Krieg hatte Nastja keine Erinnerung mehr, diese Zeit kannte sie nur vom Hörensagen. Die Deutschen hatten eine einzige Bombe über dem Städtchen abgeworfen und ein größeres Wohnhaus getroffen, dessen Bewohner alle in den brennenden Trümmern umgekommen waren. Bloß eine alte Frau, die gerade zum hölzernen Plumpsklo hinter dem Haus hinausgegangen war, hatte überlebt.
Nastja wohnte mit ihren Eltern und ihrer Schwester Tanja in einem kleinen Haus am Ortsrand, in dem man im Winter noch auf dem Ofen schlafen konnte. Es gab zwar Elektrizität, aber das Wasser musste man draußen an einem Brunnen holen. Während des Kriegs waren drei deutsche Soldaten bei ihnen einquartiert gewesen, die Mutter musste für sie Essen kochen und die Wäsche waschen, aber sie sollen nett gewesen sein und der Familie Brot und andere Lebensmittel zugesteckt haben. Zur gleichen Zeit wurden in dem Konzentrationslager, das die Deutschen in dem Städtchen errichtet hatten, innerhalb eines Jahres etwa 13000 Menschen vernichtet, vor allem ukrainische Juden, deren osteuropäische Schtetlwelt in diesem Krieg für immer unterging. Über die unbefestigten, matschigen Straßen fuhren geschlossene Lastwagen, mobile Gaskammern. Unter dem Vorwand der Evakuierung wurden Juden eingesammelt und hinter der Stadt im Innern des Wagens, in den sie gestiegen waren, mit Auspuffgas erstickt.
Als die Rote Armee zurückkehrte, entdeckte Nastjas Mutter einen deutschen Soldaten, der sich in den Johannisbeersträuchern im Garten versteckt hatte: einen etwa sechzehnjährigen Jungen, ein Kind in Uniform, das am ganzen Körper zitterte und weinte vor Angst. Sie brachte es nicht übers Herz, ihn an die Rote Armee auszuliefern, ihr Mitleid hätte sie das Leben kosten können, sie gewährte einem Kriegsfeind Unterschlupf. Zum Glück war der Junge am nächsten Tag aus dem Garten verschwunden, ohne Folgen für Nastjas Mutter.
Ihren Vater sah Nastja zum ersten Mal, als er nach Kriegsende von der Front nach Hause kam. Plötzlich stand ein großer, fremder Mann in Uniform vor der Dreijährigen, der die Arme nach ihr ausstreckte. Ängstlich wich sie zurück. «Ich kenne dich nicht», sagte sie mit weinerlichem Stimmchen. So jedenfalls erzählte man es ihr später.
Der Hunger der Kriegs- und Nachkriegszeit hatte sie für immer geprägt. Sie reagierte auf den Hunger dieser Jahre nicht mit gesteigertem Appetit, sondern mit Appetitlosigkeit. Als Kind wäre sie fast gestorben, weil sie auch von dem Wenigen, das es noch gab, nichts essen wollte. Es schmeckte ihr nichts, allein der Geruch von Nahrung rief Widerwillen in ihr hervor. Auch Jahrzehnte später konnte sie nie mehr essen als eine Katzenportion, ihr Körper hatte sich das Verlangen nach mehr Nahrung für immer abgewöhnt, kulinarische Genüsse waren ihr weitgehend fremd. Ihrer kargen Ernährung in allen ihren Lebenszeiten verdankte sie wohl ihre schmale, mädchenhafte Figur, die sie ihr Leben lang behielt, und wahrscheinlich auch einen Teil ihrer offenbar unverwüstlichen Gesundheit und Beweglichkeit.
Ihre Eltern waren beide Pharmazeuten und führten die einzige Apotheke im Ort. Es gab nur die wichtigsten Medikamente, und auch die nicht immer. Das Gehalt reichte nicht, um jeden Tag satt zu werden. Alle hungerten, alle lebten in Elend und im Dreck. In Moskau saß ein Georgier namens Iosif Wissarjonowitsch Stalin, der das riesige Sowjetreich regierte und pausenlos nach Menschenopfern verlangte, nach immer neuen Feinden, die beseitigt werden mussten. Sein wohl fleißigster Vollstrecker war ein Mann namens Wassilij Blochin, der eifrig die täglichen, von Stalin unterzeichneten Todeslisten abarbeitete und pro Nacht in einem gekachelten Keller in Moskau zweihundertfünfzig und mehr Menschen mit seiner Dienstpistole erschoss. Wenn die Munition knapp wurde, jagte er eine Kugel durch zwei Köpfe, die er präzise hintereinander angeordnet hatte. In der gesamten Sowjetunion verschwanden zahllose Menschen in Lagern, auch in der ukrainischen Provinz wurden Nachbarn abgeholt und kamen nicht wieder. Nastja spürte immer die Angst der Erwachsenen, die Angst ihrer Eltern; alle schwiegen, duckten sich. Nur in den Küchen wurde manchmal geflüstert, aber viele waren davon überzeugt, dass der Leviathan in Moskau auch das hörte.
Nastja war ein spätes, nicht mehr erwartetes Kind ihrer Eltern, das fünfzehn Jahre nach ihrer Schwester Tanja geboren wurde. Schon früh begriff sie, dass sie ältere Eltern hatte als andere Kinder. Die Angst, sie zu verlieren, verließ sie nie, hielt ihr Kinderherz fast immer umklammert und übertrug sich in ihrem späteren Leben auf alle ihr nahestehenden Menschen, um die sie beständig in Sorge lebte. Auch ihre Angst vor dem Alleinsein wurzelte in der Verlustangst ihrer Kindheit. Wenn sie frühmorgens in ihrer Kammer hinter der Küche aufwachte und es im Haus noch völlig still war, wenn ins Fenster nur der stumme Sauerkirschbaum aus dem Garten hereinsah, fühlte sie sich umgeben vom Unheimlichen. Waren ihre Eltern vielleicht schon gestorben, lagen sie tot in ihren Betten auf der anderen Seite des kleinen Flures mit den morschen Holzdielen? Der entfernte Hahnenschrei belebte den Morgen nicht, er verstärkte nur ihr Gefühl der Verlorenheit und Angst. Ihre ältere Schwester Tanja, die immer neben ihr geschlafen hatte, war nicht mehr da, sie hatte geheiratet und war nach Kiew gezogen. Nastja war jetzt allein mit ihren Eltern, die jeden Augenblick sterben konnten. Sie waren so alt, dass viele sie für ihre Großeltern hielten. Nastja war ihr Nesthäkchen, denn ihre Mutter hatte sie so spät geboren, dass sie mehr ein Geschenk des Himmels als der Natur zu sein schien. Ein schwaches, vielleicht schon genetisch benachteiligtes Kind alter Eltern, das keine Nahrung aufnehmen wollte – nicht nur Nastja hatte Angst um ihre Eltern, sie bangten nicht minder um sie.
Einmal war sie mit ihnen in der Hauptstadt gewesen, wo sie ihre Schwester Tanja und deren Familie besucht hatten. Seitdem wünschte sie sich nichts mehr, als später einmal auch in Kiew zu wohnen, in der großen, belebten Stadt mit Schaufenstern, Straßenbahnen und vielen Menschen auf den Straßen, in einer Gemeinschaftswohnung, in der man nie allein war, weil man Tag und Nacht die Lebensgeräusche der Zimmernachbarn hörte. Hier, glaubte sie, würde sie die Angst verlieren, hier wäre kein Platz für Gespenster und Dämonen, hier wären sie verdrängt von den Menschen.
Bei ihrer Einschulung wurde sie zum «oktjabrjonok», einem Kind der Oktoberrevolution, wie alle sowjetischen Erstklässler. Sie lernte, dass sie im schönsten, freiesten, glücklichsten Land der Welt lebte und dass Stalin der beste Freund aller Kinder war. Draußen spielte sie mit den anderen Krieg, Ukrainer gegen Deutsche, Rote gegen Weiße, sie hetzten stundenlang durch die alten, vom Krieg, von den Frösten und Hitzewellen vieler Jahre zerstörten Straßen, sie versteckten sich in Gräben und hinter Büschen und schossen einander tot.
Die ganze Schulzeit hindurch war sie eine Einserschülerin, die Klassenbeste, die schwächeren Schülern bei den Hausaufgaben half, sich um die Heimkinder in ihrer Klasse kümmerte, Kinder von Alkoholikern, Kriminellen und anderen sozialen Absteigern, mit denen die meisten nichts zu tun haben wollten, obwohl die Schüler zu Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit erzogen wurden – zu einem Wir, das mehr galt als das kleine Ich, was Nastjas tiefem Verlangen nach Gemeinschaft entgegenkam. Begierig wartete sie darauf, bei den Jungen Pionieren aufgenommen zu werden, sie fälschte sogar ihr Geburtsdatum, um endlich auch das rote Halstuch tragen und in den Ferien ins Pionierlager fahren zu dürfen, im Herbst zum gemeinsamen Ernteeinsatz irgendwo auf dem Land. In der örtlichen Bibliothek war sie der häufigste Gast, sie verschlang alle Bücher, die dort zu bekommen waren. Die Auswahl war nicht sehr groß, viele Bücher las sie mehrfach und träumte davon, später einmal, wenn sie in Kiew leben würde, alle Bücher zu lesen, die dort in der riesigen Staatsbibliothek auf sie warteten. Später sollte sie von sich sagen, dass sie von Beruf Leserin sei.
Ihr Brotberuf wurde Bauingenieurin. Am liebsten hätte sie Literatur am Gorki-Institut in Moskau studiert, aber dorthin führte kein Weg für sie, allein schon deshalb nicht, weil es so gut wie unmöglich war, eine Zuzugsgenehmigung für die Hauptstadt der Sowjetunion zu erhalten. Außerdem war das gesamte riesige Land immer noch in der Phase des Wiederaufbaus nach dem Krieg, gleichzeitig sollte es unter Lenins Motto «Kommunismus – das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes» aus einem Agrarstaat in einen Industriestaat verwandelt werden. Es wurden Legionen tüchtiger junger Menschen mit technischen Berufen gebraucht, in denen auch möglichst viele Frauen arbeiten sollten. Die programmatisch beschlossene Emanzipation der Frau brachte damals jede Menge Traktoristinnen, Bauarbeiterinnen und Metallurginnen hervor, aber auch Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen. Nastja, die in der Schule auch alle mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer mit Bestnoten abgeschlossen hatte, wurde ein Studium der Ingenieurwissenschaften im Fach Tiefbau an der Technischen Hochschule in Kiew nahegelegt. Im Kampf gegen die katastrophale Wohnungsnot wurden in der ukrainischen Hauptstadt zu jener Zeit riesige Plattenbausiedlungen errichtet, und Nastja sollte lernen, alles für diese Bauten zu projektieren, was unter der Erde lag. Das war nicht das, was sie sich gewünscht hatte, aber nicht nur die Literatur, auch die Technik barg ein Geheimnis, das ihr Interesse weckte, und vor allem durfte sie endlich nach Kiew ziehen.
In der großen, aufregenden Gemeinschaft der Studenten fühlte sie sich vom ersten Tag an zu Hause. Im Studentenheim wohnte sie mit drei anderen Studentinnen in einem kleinen Zimmer, zwei Hochbetten, die einander gegenüberstanden – eine Enge, die Nastja nicht bedrängte, im Gegenteil: Sie war glücklich wie ein Küken im gemeinsamen Nest. Die Freundschaften, die sie während ihres Studiums schloss, behielt sie das ganze Leben.
Das Essen, das dreimal am Tag in der Mensa ausgegeben wurde, war nicht gerade schmackhaft und abwechslungsreich, fast jeden Tag gab es Kohl, Rote-Bete-Suppe oder Buchweizengrütze, aber in Gesellschaft der immer hungrigen Studenten steigerte sich auch Nastjas Appetit, sodass ihr magerer, eckiger Körper allmählich weiblichere Formen annahm. Nachts las sie im Bett, mit einer Taschenlampe unter der Decke. Endlich hatten sich ihr die Türen zu den heiligen Archiven der Weltliteratur geöffnet, das dünne Rinnsal, aus dem sie zu Hause geschöpft hatte, war jetzt ein Ozean geworden. Sie las Platon, Dante, Goethe, Shakespeare, Jules Verne, Bernard Shaw, E.T. A. Hoffmann und viele andere. Es war die Zeit der sogenannten Tauwetterperiode unter Nikita Chruschtschow, der Stalin und dessen Terrorherrschaft 1953 abgelöst hatte. Die Studenten waren in Aufbruchsstimmung, alle fühlten, dass die Leine, an der man sie seit jeher geführt hatte, etwas länger geworden war.
Im dritten Semester lernte sie Roman kennen, ihren späteren Mann. Er studierte an der Medizinischen Hochschule, ein schöner, schwarzlockiger Karäer von der Krim, der im selben Studentenheim wohnte wie sie. Er war einer, der Glück gehabt hatte: Im Krieg hatten die Deutschen auf der besetzten Krim fast die gesamte jüdische Bevölkerung ermordet, auch einen Teil der Karäer, deren rassische Zugehörigkeit damals nicht eindeutig geklärt war. Romans Familie konnte dem Massaker nur knapp entgehen, davon abgesehen war über diese Familie dasselbe hinweggerollt wie über alle anderen auch: Revolution, Bürgerkrieg, Enteignungen, Hungersnöte, Stalins Vernichtungsterror, der Überfall der Deutschen, die die größte Stadt der Krim am Schwarzen Meer, Sewastopol, in Schutt und Asche legten und unter dem Namen Theoderichshafen zu deutschem Siedlungsgebiet machen wollten. Schließlich schenkte Nikita Chruschtschow die zu Russland gehörende, vom Krieg verwüstete Halbinsel samt ihrer dezimierten Bevölkerung dem ukrainischen Brudervolk. Für den damals sechzehnjährigen Roman spielte es keine Rolle, ob er Russe oder Ukrainer war, er blieb Sowjetbürger, aber eines noch fernen Tages sollte dieser historische Transfer schwerwiegende Folgen für ihn haben: Nach der Abspaltung der Ukraine von Russland forderte Wladimir Putin Chruschtschows großzügiges Geschenk zurück und gliederte die Krim gewaltsam wieder an Russland an. Seitdem konnte Roman, der in Kiew lebte, seine Heimat mit den dort noch lebenden Verwandten und Freunden nicht mehr besuchen, weil die ukrainische Regierung ihren Bürgern verbot, auf die von Russland annektierte Halbinsel zu reisen.
Roman wurde 1938 in Bachtschyssaraj geboren, einer kleinen, sagenumwobenen Stadt in einem weiten Tal des Krimgebirges. An den Hängen wuchsen die Trauben für den berühmten Krimsekt, Berberitzensträucher und Feigenkakteen. Das Haus, in dem er mit seinen zwei Geschwistern groß wurde, stand direkt gegenüber dem Khan-Palast, einst Sitz der Herrscher über die Krimtataren, ein märchenhaftes architektonisches Ensemble, zu dem der sogenannte Tränenbrunnen gehörte, aus dem seit fast zweihundert Jahren unentwegt zwei Wassertropfen auf eine Rose fielen – die unvergängliche, in Marmor gemeißelte Trauer eines Khans um seine verstorbene junge Frau. Der tägliche Blick aus den Fenstern auf den Tatarenpalast war die einzige Besonderheit des Hauses, in dem der junge Roman sein Leben auf der Krim verbrachte. Im Übrigen bestand es aus verwahrlosten Gemeinschaftswohnungen, in denen mehrköpfige Familien wie in den meisten sowjetischen Altbauten in einem einzigen Zimmer zusammengepfercht waren. Während seiner gesamten Kindheit und Jugend schlief er hinter einem großen Schrank, auf dem sich Kisten und Koffer bis zur Decke türmten, was die Illusion eines eigenen Zimmers schuf. Seine beiden jüngeren Geschwister schliefen hinter einem Vorhang am anderen Ende des Zimmers, in der Mitte hatten die Eltern ihr schmales Nachtlager, am Tag fand in diesem Mittelteil des Zimmers das Familienleben statt.
Romans Vater war Augenarzt im Bezirkskrankenhaus, die Mutter Buchhalterin auf einem staatlichen Weingut. In der Nachkriegszeit, als jeder Lebensmittelladen leer und auch die Natur von den hungrigen Menschen schon geplündert war, musste Roman die Schule unterbrechen und zwei Jahre lang die Kühe einer Tante hüten, die in einem Gebirgsdorf in der Nähe eine armselige Landwirtschaft betrieb. Dafür wurde er mit den Mehlresten vom Brotbacken entlohnt, mit kleinen Portionen Butter und Quark. Ab und zu gelang es dem Vater, etwas Traubenzucker oder Ascorbinsäure für seine Kinder aus dem Krankenhaus zu schmuggeln, wofür man ihn wahrscheinlich erschossen hätte, wenn es herausgekommen wäre.
Nach dem verspäteten Abschluss der Zehnklassenschule musste Roman den obligatorischen dreijährigen Armeedienst absolvieren, er wurde zur Marine eingezogen, die als die brutalste Truppengattung des sowjetischen Militärs galt. Der unmenschliche Drill, der die jungen Männer brechen sollte, bewirkte bei ihm das Gegenteil, er machte ihn widerspenstig, unbestechlich und resistent gegen jede Obrigkeit. Er hatte eine sehr innige Beziehung zu seinem Vater und wusste schon als Kind, dass auch er Arzt werden wollte; später erstrebte er das umso mehr, als es ein unpolitischer, ideologiefreier Beruf war, in dem er sich dem System weitgehend entziehen konnte. Auch wenn Ärzte sehr schlecht bezahlt wurden und es in der rückständigen medizinischen Praxis an fast allem fehlte, was man zur Behandlung kranker Menschen brauchte.
Er machte das Grundstudium an der Universität von Simferopol, wo es eine angesehene medizinische Fakultät gab. Als er nach sechs Semestern nach Kiew ging, um sich in urologischer Chirurgie ausbilden zu lassen, ließ er in Bachtschyssaraj ein Mädchen zurück, Alsu, das in der Kindheit seine Spielgefährtin gewesen war und das er schon damals hatte heiraten wollen, eine Tochter tatarischer Eltern, die der massenhaften, durch Stalin angeordneten Deportation der Krimtataren während des Zweiten Weltkriegs hatten entgehen können – Überlebende wie seine eigenen, jüdischen Eltern auch. Er war ein Mädchenschwarm, aber Affären hatten ihn nie interessiert, er blieb Alsu immer treu. Sein Lebensplan sah vor, dass er nach Abschluss seines Studiums auf die Krim zurückkehren würde, um seine Arbeit als Arzt in einer Klinik in Simferopol oder Sewastopol aufzunehmen und Alsu zu heiraten, die ebenfalls angehende Ärztin war.
Die Begegnung mit Nastja veränderte alles für ihn. In ihr erkannte er auf den ersten Blick diejenige, die er immer gemeint hatte. Sie war nicht weniger umschwärmt als er, einen ihrer Verehrer hatte sie bereits in die engere Wahl gezogen, aber bei Roman brauchte sie nicht abzuwägen, bei ihm war sie sich sofort sicher. Allen, die die beiden zusammen sahen, war klar, dass sie füreinander bestimmt waren, aber letztendlich entschied Alsu. Fast zeitgleich war auch sie aus ihrer Kinderliebe erwacht und schrieb ihm, dass sie sich in einen anderen verliebt habe. Sie ahnte nicht, wie erlösend diese Nachricht für ihn war.
Zu Nastjas schönsten Erinnerungen gehörten die Motorradtouren mit Roman. Er besaß eine schwere, noch aus der Vorkriegszeit stammende Maschine, auf der er von der Krim in die Hauptstadt gekommen war und die er immer wieder mit viel Phantasie reparierte. Sie spie blauschwarze Wolken aus und machte ein infernalisches Geräusch, aber wenn Nastja auf dem Rücksitz saß, festgeklammert an Romans Oberkörper, angeschmiegt an seinen Rücken, war ihr, als hätte sie den Schweif des Feuervogels zu fassen bekommen, der sie mit Roman durch die Lüfte trug. Sie brausten in die Karpaten, zu Nastjas Eltern aufs Land, zu Romans Eltern auf die Krim. In Kiew hatten sie kaum je Gelegenheit, allein zu sein, aber das Motorrad brachte sie immer schnell an Orte, wo endlich niemand mehr über sie wachte, wo keiner war außer ihnen.
Die Fahrten nach Bachtschyssaraj waren ein abenteuerliches Unterfangen auf den damaligen Straßen, die durch kaum erschlossene, wilde Gegenden führten, doch am Ende des Weges wurde Nastja reich belohnt. Die Krim war eine andere Welt, hell und warm, eine Welt am Meer, das sie vorher nie gesehen hatte. Schon als Kind hatte es sie immer ans Wasser gezogen, an Flüsse und Seen, sie sagte von sich, sie sei eigentlich nicht als Mensch, sondern als Fisch geboren worden. Das Meer mit seiner Urgewalt war eine Offenbarung für sie, es wurde zu ihrem Sehnsuchtsort.
Nie sonst waren Nastja und Roman so lange allein wie beim Zelten am Strand. In ihren Wohnverhältnissen in Kiew war ihnen das Alleinsein nicht nur während der Studentenzeit, sondern auch später nur sehr selten möglich. Wenn sie auf die Krim fuhren, was sie so oft wie möglich taten, fuhren sie in die Freiheit. Alle paar Tage besuchten sie Romans Eltern, dort konnten sie duschen und etwas Warmes essen, dann fuhren sie zurück in die Wildnis, wo ihr Zelt stand – an einem abgelegenen Ufer des Schwarzen Meeres mit seinen atlantisch dröhnenden Wellen, in die Nastja sich nicht oft genug hineinwerfen konnte. Hier waren sie nicht nur allein, sondern für kurze Zeit auch unsichtbar für das Auge des Staates, die allgegenwärtige Instanz, der ein Sowjetbürger in seinem normalen Alltag nie entrinnen konnte.
Nach dem gleichzeitigen Abschluss ihres Studiums heirateten sie auf dem Standesamt in Kiew und traten beide ihre ersten Arbeitsstellen an: Roman als Praktikant in der Chirurgie einer Klinik, Nastja als Mitarbeiterin beim Städtischen Baukombinat, das die Bauvorhaben der gesamten Stadt plante und ausführte. In den ersten Monaten, in denen sie am Zeichenbrett die Rohrleitungssysteme für Neubauten entwarf, wohnte sie selbst mit Roman in einem uralten ausrangierten Güterwagen aus Holz. Normalerweise kamen junge Paare nach der Hochzeit in einer der elterlichen Wohnungen unter, aber da Nastja und Roman ihr Leben weder in der ukrainischen Provinz noch auf der Krim führen, sondern in Kiew bleiben wollten, mussten sie angesichts der aus allen Nähten platzenden Stadt froh sein, dass man ihnen das überhaupt erlaubt und eine Bleibe angeboten hatte.
Der Güterwagen war ihr eigenes kleines Haus, das auf Rädern stand und über eine schmale Eisentreppe zu betreten war. Früher wurden in dem Güterwagen Zuckerrüben transportiert, der faulig-süße Geruch hatte sich für die Ewigkeit in das feuchte, morsche Holz gefressen. Es zog durch die Ritzen, natürlich gab es weder Strom noch Wasser, allerdings einen Kanonenofen mit einem Rauchabzug direkt nach draußen, an dem sie sich ein wenig wärmen konnten – sofern sie in der Umgebung etwas gefunden hatten, das sich verheizen ließ. Duschen und Wasser holen durften die beiden in der Klinik, in der Roman arbeitete und auf deren Gelände der morsche Wagen stand. Die Geschäfte waren leer wie immer, viel mehr als das, was Nastja und Roman einmal am Tag in ihren jeweiligen Kantinen bekamen, hatten sie nicht zu essen. Die liberale Chruschtschow-Ära war inzwischen vorbei, ein Ukrainer mit buschigen Augenbrauen namens Leonid Breschnew war 1964 Erster Sekretär des Zentralkomitees der KPdSU geworden und fror das Leben im Sowjetreich für lange Zeit ein.





























