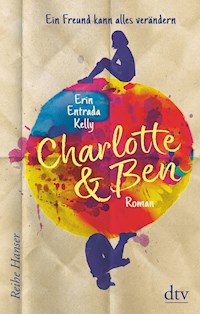12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Jeder Tag ist genau gleich langweilig – bis die Neue kommt! Es gibt 12 Kinder in der 7. Klasse der Fawn Creek Middle School, aber 13 Tische. Als die geheimnisvolle Orchid Mason die Klasse betritt und elegant an Tisch 13 Platz nimmt, wirbelt sie sofort das Leben ihrer Mitschüler auf. Orchid ist anders. Alles an ihr scheint leicht, und sie trägt eine Blume hinterm Ohr – ungeheuerlich! Wie in jeder Schulklasse herrschen auch hier komplizierte Strukturen. Und für Greyson und Dorothy, den Außenseitern der Klasse, die einfach nur wegwollen aus dem miefigen Nest, ist dieses fast märchenhafte Wesen ein Bild für Freiheit. Für andere ist sie ein Alien oder ein Hassobjekt. Wer wird Orchid Mason für sich beanspruchen? Wird sie die Kinder von Fawn Creek retten? Oder werden sie sie retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Ähnliche
Über das Buch
Jeder Tag in der Kleinstadt Fawn Creek fühlt sich genau gleich an – bis Orchid Mason auftaucht.
Als das geheimnisvolle Mädchen die Klasse betritt, wissen die anderen Siebtklässler nicht, was sie denken sollen. Orchid ist aufregend. Sie wurde in New York geboren und hat in Paris gelebt, sie scheint nicht von dieser Welt und trägt eine Blume hinterm Ohr – ungeheuerlich!
Orchid stellt Fragen, die sonst keiner zu stellen wagt, und rüttelt die Cliquen der Klasse durcheinander. Wer wird Orchid Mason für sich beanspruchen? Wer wird sich ihr entgegenstellen? Wer wird sie retten? Oder wird Orchid sie retten?
Eine berührende Geschichte über Freundschaft und Familie, über Wahrheit und Lügen und die Dinge, die am wichtigsten sind im Leben.
Erin Entrada Kelly in der Reihe Hanser:
Vier Wünsche ans Universum
Charlotte & Ben
Die Nelsons greifen nach den Sternen
Erin Entrada Kelly
Das Leben hinter der nächsten Ecke
Für alle, deren Träume größer sind
als die Orte, in denen sie leben
»Seid freundlich. Die Welt ist eine Kleinstadt.«
Austin Kleon
1
Am Tag als Orchid Mason zum ersten Mal den Raum K-12 in der Schule von Fawn Creek betrat, tat Greyson Broussard die rechte Schulter weh. Das würde einen fetten blauen Fleck geben.
Dieser bescheuerte Trevor!
Das sei doch »bloß Spaß«, hatte er gesagt, während er Greyson genüsslich kniff, aber was ist das für ein Spaß, wenn der eine lacht und der andere sich am liebsten in ein Loch verkriechen und sterben möchte? Dazu noch auf dem Weg zur Schule, im Truck, also im Beisein von Dad, der aber wie üblich dazu schwieg und sich nicht einmischte.
Und das alles nur, weil Greyson nicht mit auf Entenjagd wollte.
»Wenn du so weitermachst, halten dich die Leute bald für ein Weichei«, hatte sein Vater gesagt, während er mit der fleischigen Hand den Truck in die Ein- und Aussteigespur vor der Schule steuerte. »Bei der letzten Kontrolle hatte ich noch zwei Söhne, nicht einen Sohn und eine Tochter.«
Trevor hatte gegrölt vor Lachen, dabei war der Witz uralt, der Vater hatte ihn schon so oft gemacht.
»Das ist er doch jetzt schon, ein Weichei«, hatte Trevor gesagt.
Und dann hatte er ihn gekniffen.
Sollten ältere Brüder nicht eigentlich Vorbilder oder so was sein?
Als der Wagen zum Stehen kam, stieg Greyson aus, blieb aber wie immer noch eine Weile zurück und sah seinem bescheuerten Bruder nach, der schon die breite Treppe zu den Gebäuden hinauflief, wobei er wie immer zwei Stufen auf einmal nahm. Es war Freitag, der erste November, und Greyson befand sich wie schon seit Urzeiten auf dem Weg zur Schule, wo er wieder auf dieselben elf Mädchen und Jungen treffen würde wie gefühlt seit Anbeginn der Menschheit, Woche für Woche. In Fawn Creek änderte sich nie etwas, die Luft war heiß und feucht, und die Mücken sogen einem das Blut aus den Armen.
In dem Moment beschloss Greyson, seine Gedanken frei schweben zu lassen, weg von der Schule und hinüber zum nahen Bach. Er stellte sich vor, er stünde dort am Ufer, die Zehen im Wasser, eine Angel in der Hand. Der Bach fließt ganz ruhig, außer mir sind nur das Wasser da und die Fische. Kein Vater. Kein Bruder. Keine Schule. Nur ich.
So hätte er seine Gedanken noch den ganzen Morgen über treiben lassen können, hätte Dorothy nicht zu Beginn der ersten Stunde (Englisch) von hinten gegen seinen Stuhl getreten und ihn so mit einem Ruck zurück in die Wirklichkeit geholt. Das geschah zwar ganz sanft, wie alles bei Dorothy sanft geschah, aber es reichte schon.
Sofort schaute er auf.
Und im selben Moment, als er sie sah, ließ der Schmerz nach.
Nicht wirklich, doch es kam ihm so vor. Der Schmerz löste sich auf, plötzlich waren die kneifenden Finger nicht mehr zu spüren.
Mr. Agosto klopfte mit den Knöcheln auf sein Pult, dabei waren ohnehin schon alle Augen auf ihn gerichtet. Oder, genauer gesagt, auf das Mädchen an seiner Seite.
»Alle mal herhören«, sagte Mr. Agosto mit leuchtenden Augen. »Wir haben eine neue Schülerin.« Es war nicht zu übersehen, dass der Lehrer sich Mühe gab, seine Aufregung zu verbergen. Genauso guckte er auch, wenn er der Klasse neue Projekte vorstellte und fest überzeugt war, alle wären total begeistert. Einmal, zum Beispiel, hatten sie Briefe an längst verstorbene Dichterinnen oder Dichter schreiben müssen, die ihnen allen völlig egal waren. Liebe Emily Dickinson, stimmt es, dass Sie immer ein weißes Kleid trugen und nie das Haus verlassen haben, oder ist das erfunden?, hatte Greyson in seinem Brief geschrieben. Auch wenn er nicht viel auf Emily Dickinsons Gedichte gab, so fand Greyson doch die Dichterin selbst faszinierend. Sie hatte so etwas … Mysteriöses.
Und jetzt gab es da ein neues Mysterium, das ihn faszinierte – dieses Mädchen, das in einem weißen T-Shirt und einem luftigen Faltenrock vor der Klasse stand. Mit Faltenröcken kannte Greyson sich aus – seine Mutter war nämlich Schneiderin. Sie nahm nicht nur Änderungen an, sondern nähte auch Couchkissen, Kostüme für Karneval oder andere Verkleidungsfeste und Kleider für Schulbälle. Was für lange Haare das Mädchen hatte! Sehr lange. Hüftlang ungefähr und gewellt. Nein, nicht gewellt. Lockig. Eine richtige Mähne, wild, aber gleichzeitig so, als sollte sie so sein. Hinter einem Ohr steckte eine weiße Blüte, dabei war es November, ein Monat, in dem kein normaler Mensch an Blumen denkt. Und abgesehen davon, wer steckte sich überhaupt Blumen hinters Ohr, egal wann?
Sonst legten die zwölf Siebtklässler großen Wert darauf, mit möglichst ausdrucksloser Miene dazusitzen. Niemand wollte zuerst zugeben, dass man irgendetwas aufregend fand. Doch das hier – eine leibhaftige neue Mitschülerin, überhaupt irgendetwas aus dem richtigen Leben – war viel spannender als jedes Experiment im Naturkundeunterricht. Leute von irgendwo kamen nicht einfach so nach Fawn Creek. Schon gar nicht ohne Ankündigung. Am ehesten noch konnte man das von Mr. Agosto sagen, denn der war in Venezuela geboren und vor fast jeder Klasse der Einzige mit nichtweißer Haut. Aber er war mit drei Jahren nach Fawn Creek gekommen, weil sein Vater einen Job in Gimmerton hatte, und genau wie Greyson, Dorothy und im Grunde alle anderen hier hatte er Südlouisiana seit damals nie mehr verlassen. Weiter als bis zur Hauptstadt Baton Rouge, wo er die Louisiana State University besucht hatte, war er nie gekommen, und die lag gerade mal zwei Stunden entfernt.
»Kleinstädte sind wie Magneten«, hatte Greysons Mutter einmal gesagt. »Sie ziehen dich an und lassen dich nicht mehr los.«
Aber jetzt hatte der Magnet eine Fremde angelockt. Janie und Abby Crawford setzten sich gerade auf und richteten ihre blauen Augen auf die Neue. Greyson hätte gern ihre Gedanken gelesen. Max Bordelon, Daniel Landry und Michael Colt, die alle im Nachbarort zusammen in der Jugendliga Football spielten, grinsten einander an. Barnet und Lehigh Kingery fläzten sich in ihren Bänken, und auch die Übrigen konnten anscheinend nicht still sitzen.
Greyson sah zu, wie das Mädchen ihnen zuwinkte – wie eine Königin, die ihre Untertanen grüßt. Die Armreifen an ihrem Handgelenk klimperten. Sie lächelte. Ein großes, natürliches, lässiges Lächeln, bei dem man all ihre vollkommen geraden Zähne sah. Daelyn Guidry und Baylee Trahan, die in der Bank neben Greyson saßen, machten einen Schmollmund. Beide hatten erst kürzlich Zahnspangen bekommen, und Hallie Romero, die Dritte in ihrer Clique, hatte Tage damit verbracht, sie zu überzeugen, dass sie damit super aussahen.
Mr. Agosto fuhr fort: »Sie heißt …«
»Ich bin Orchid Mason«, sagte das Mädchen. Dann zeigte sie auf das einzige freie Pult im Klassenraum. Es stand direkt neben Janie und Abby Crawford. »Ich geh da drüben hin, wenn das okay ist.«
Sie schwebte zum freien Platz und setzte sich in einer geschmeidigen Bewegung.
Ein Duft von Zitronen ging von ihr aus.
Und so waren sie von jetzt auf gleich dreizehn in der Klasse.
2
Bevor Orchid auftauchte, hatte Mr. Agosto ihnen den Unterschied zwischen einem Vergleich und einer Metapher beizubringen versucht. Für einen Vergleich brauchte man die Wörter wie oder als. Für eine Metapher nicht.
Dorothy Doucet saß ganz hinten in der Klasse, wie immer in der hintersten Bank, gerade so, als wollte sie von der Wand verschluckt werden. Sie sah aus, als passte sie nicht auf, denn ihr Gesicht war hinter ihren braunen Haaren verborgen. Doch das war eine optische Täuschung, denn Dorothy Doucet passte immer auf.
Sie ließ ihren Blick durch den Raum wandern, musterte insgeheim die anderen in ihrer Klasse und dachte sich dabei ihre eigenen Metaphern und Vergleiche aus. Ihr gefiel die Vorstellung, dass Dinge nicht genau so sein mussten, wie sie sich nach außen zeigten.
Vor ihr saß ihr bester Freund, Greyson. Sie betrachtete aufmerksam sein strähniges blondes Haar und dachte: Greyson ist wie eine gelbe Rose. Aber keine frische. Eher wie gepresste Blütenblätter. Solche, wie meine Mutter sie zwischen die Seiten ihrer Bibel legt.
Abby und Janie Crawford sind wie Giftefeu. Sie sehen vollkommen harmlos aus, aber in bestimmten Situationen sind sie gefährlich. Was man manchmal erst merkt, wenn es zu spät ist.
Barnet und Lehigh Kingery sind Pflanzen, die kein Wasser brauchen. Man kann sie sich selbst überlassen, sie kommen schon klar, so wie die Sukkulenten meiner Mutter. Robust und völlig zufrieden mit ihrem Dasein als Einzelgänger.
Die anspruchsvollen Pflanzen, solche, die Blüten treiben, das sind Max, Daniel und Colt. Sie brauchen jede Menge Wasser und Zuwendung. Sie glauben, sie könnten aus eigener Kraft wachsen, aber das stimmt nicht.
Daelyn, Hallie und Baylee sind süß duftende Gänseblümchen, die sich immer nach der Sonne recken. Sie leuchten hell und sind ungefährdet.
Als Orchid hereinkam, war Dorothy gerade dabei, sich eine Metapher für sich selbst auszudenken.
Ich glaube, ich bin die Blumenerde, dachte sie. In dem Moment trat Orchid ein.
In einem verschlafenen Kaff wie Fawn Creek – das deshalb oft als Yawn Creek verspottet wurde – sollte man meinen, alle hätten längst gewusst, dass sie eine neue Mitschülerin bekommen würden. Aber Orchid hatte keiner auf dem Schirm gehabt. Mr. Agosto war der Einzige, der nicht völlig überrascht schien. Als es klopfte und Orchid gleich darauf in der Tür stand, winkte er sie herein mit den Worten »Nur Mut, nur Mut«, so als befände die Klasse sich mitten in einem großen Abenteuer und nicht in einem öden Lehrervortrag über guten Stil.
Als Orchid Mason die Klasse betrat, dachte Dorothy: Sie ist das Mädchen aus dem Märchen, das über eine Wiese schwebt und am Ende einen Prinzen findet.
Oder eine Spindel.
3
Nachdem Orchid in die Klasse gekommen war, hätte Mr. Agosto unmöglich weitermachen können mit seinem Vortrag über Metaphern und Vergleiche. So etwas hatte es in dieser siebten Klasse noch nie gegeben, dass jemand von außen neu dazugestoßen war. Wenn überhaupt etwas geschah, dann das genaue Gegenteil: Ganz selten einmal kam es vor, dass ein Kind die Klasse verließ, weil ein Elternteil irgendwo anders eine Stelle gefunden hatte, meistens im Nachbarort Grand Saintlodge. Deswegen stand auch ein freies Pult in der Klasse. Da hatte nämlich Renni Dean gesessen.
Das unerwartete Ereignis hatte den Tag völlig auf den Kopf gestellt. Freitags waren die Kinder generell unkonzentriert, auch ganz ohne neue Mitschüler, aber jetzt war es hoffnungslos, ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Unterricht zu lenken. Also richtete Mr. Agosto das Scheinwerferlicht auf Orchid, die ohnehin im Mittelpunkt des Interesses stand.
Während Greyson genau wie alle anderen zu ihr hinüberschaute, rasten Fragen über Fragen durch seinen Kopf. Wo kam dieses Mädchen her? Wieso hatte sie eine Blume im Haar? Wieso um alles in der Welt kam sie ausgerechnet an diese Schule?
Er musste sich zusammennehmen, um sich nicht umzudrehen und mit Dorothy zu sprechen. Gemeinsam würden sie auf eine Million Fragen und ebenso viele Antworten kommen, aber das musste bis zum Mittagessen warten.
Zum Glück kam Mr. Agosto Greysons Neugier ein Stück entgegen.
»Orchid«, begann der Lehrer. »Ich muss zugeben, es kommt nicht alle Tage vor, dass wir hier neue Mitschüler bekommen. Für uns ist das durchaus ein Ereignis.«
Janie und Abby Crawford rollten mit den Augen.
»Erzähl mal, von wo kommst du?«, fragte Mr. Agosto.
»Paris«, antwortete Orchid.
Paris. Nur ein Wort. Einfach so. Paris. Als würde sie ganz beiläufig den Namen irgendeiner Stadt in der Nähe nennen.
Greyson sah kurz zu Janie und Abby hinüber. Abby saß kerzengerade da, so als hätte ihr jemand mit einer Nadel in den Rücken gestochen. Janie guckte so wie immer.
»Paris!«, sagte Mr. Agosto. »Wie wundervoll!«
Barnet Kingery lehnte sich hinüber zu Daniel Landry, und die Metallbeine seines Pults rutschten quietschend ein Stück über den Boden. »Echt jetzt?«
»Nicht möglich«, sagte Daniel.
Greysons Herz raste.
»Bist du Französin oder so was?«, fragte Baylee.
Greyson war aufgefallen, dass Baylee sich seit diesem Schuljahr schminkte. Aber so richtig bekam sie es noch nicht hin. Die dunklen Linien um ihre Augen waren verrutscht, und das Rouge auf ihren Wangen war ein bisschen zu rosa. Nicht, dass Greyson eine Ahnung davon gehabt hätte, wie man sich schminkte. Ihm fielen solche Dinge einfach nur auf, auch wenn er nie eine Bemerkung dazu machen würde. Außer vielleicht mal Dorothy gegenüber.
Orchid lachte. Kein spöttisches Lachen, nur ein ganz helles, leichtes.
»Ich? Oh nein, ich bin keine Französin. Ich bin in New York geboren«, sagte sie.
»New York City?«, fragte Hallie Romero.
Hallie sah Daelyn und Baylee an, deren nagelneue Zahnspangen mit einem Mal kein Thema mehr waren, dabei hatten sie während der ganzen letzten Woche die Unterhaltung bestimmt. Eines der beiden Mädchen hatte garantiert irgendwann gefragt: »Findest du wirklich, dass ich okay aussehe?«, worauf die andere regelmäßig antwortete: »Natürlich, du siehst toll aus.« Wie in einem Tennismatch flog der Ball zwischen ihnen hin und her, hin und her, jeden Tag, zum Zweck der gegenseitigen Beruhigung.
Greyson hatte diese Unterhaltungen von seiner Bank aus mitangehört und sich überlegt, ob er sagen sollte: »Ihr seht toll aus, macht euch keine Gedanken« oder »Bevor ihr euch dreimal umgedreht habt, sind die Dinger doch schon wieder runter«, aber dann hatte er doch geschwiegen. Er konnte nicht einschätzen, ob die beiden dankbar oder genervt sein würden. Er kannte die beiden zwar schon sein Leben lang – zum Beispiel wusste er, dass Daelyn die kleine Narbe am Kinn davon hatte, dass sie in der zweiten Klasse vom Klettergerüst gefallen war, und dass Baylees Patenonkel vor zwei Jahren an Alzheimer gestorben war –, trotzdem wollte er kein Risiko eingehen.
»Jep, New York City«, sagte Orchid. »Genau da.«
Mr. Agosto räusperte sich. Seine Blicke schossen durch den Raum, als machte er sich Sorgen, dass ihm der Tag aus den Händen gleiten und er ihn nie wieder einfangen könnte.
»Also wirklich«, sagte er. »Ich wusste zwar, dass wir heute eine neue Mitschülerin bekommen würden, aber dass sie so weit gereist ist, das war mir auch nicht klar.«
Greyson stellte sich Orchid auf den Straßen von New York vor, wie sie eilig zur U-Bahn lief oder bei einem Straßenhändler Hotdogs kaufte. Dann stellte er sie sich vor, wie sie in einem Flugzeug saß und zum Fenster hinausschaute. Sie gehörte sicher zu denen, die immer am Fenster sitzen wollen. Sollte ich je die Chance haben zu fliegen, setze ich mich ganz sicher ans Fenster, dachte Greyson. Vermutlich hatte sie in irgendeiner Schublade einen Pass mit einem Dutzend Stempel liegen. All das konnte er sich leicht vorstellen, aber wenn er versuchte, sie hier irgendwo zu sehen, in Fawn Creek, Louisiana, einem Ort ohne auch nur eine einzige Ampel, dann wurde es schon schwierig.
Und doch – hier war sie.
4
Paris! Na und?, dachte Janie Crawford.
Was soll daran so toll sein? Der Eiffelturm? Woo-woo! Geboren in New York City? Und wenn schon? In New York sind die Bürgersteige verstopft und die Menschen alle unhöflich und aggressiv, das weiß doch jeder! Und wer will schon in einer Stadt leben, in der man nicht atmen kann? Nur weil es ständig im Kino und im Fernsehen zu sehen ist, glauben die Leute, New York wär so was Besonderes.
Janie war zwar noch nie dort gewesen, aber egal. New York oder Paris interessierten sie nicht, und schon gar nicht interessierte sie sich für dieses neue Mädchen mit der wilden Mähne und so einer blöden Blume hinter dem Ohr – gerade so, als wäre sie … als wäre sie … als wäre sie was?
»Eine Märchenprinzessin«, murmelte Janie.
Ihre Cousine Abby wandte ihr den Kopf zu.
»Hast du was gesagt?«, fragte Abby.
»Hm?« Janie guckte betont gelangweilt. So als fände sie nicht nur Abbys Frage langweilig, sondern alles überhaupt. Wenn auf einmal alle durchdrehten und unhöflich wurden, bloß wegen irgendeiner Neuen – sollen sie doch. So wie ihre Gesichter plötzlich aufleuchteten, sollte man meinen, sie hätten in ihrem ganzen Leben noch nie einen unbekannten Menschen gesehen. Gottes selbst ernannter Hilfstrupp – Daelyn, Baylee und Hallie – starrte Orchid an, als wäre sie die Königin von England oder sonst wer. Und die Jungs erst mal! Wie dumme, sabbernde Hundewelpen. Janie sah, wie Michael Colts Blicke immer wieder in Richtung Orchid wanderten, auch wenn er sich große Mühe gab, total cool auszusehen.
Warte nur, bis ich Renni davon erzähle, dachte Janie. Renni und Colt hatten zwar vor einer Weile Schluss gemacht, aber trotzdem.
Und Max? Der hatte doch auch zu Orchid rübergeguckt, oder?
Janie rutschte auf ihrem Platz herum. Ach was, wen interessierte schon Max Bordelon?
»Ich dachte, du hättest was gesagt«, flüsterte Abby.
Mr. Agosto stand mit dem Rücken zur Klasse am Whiteboard und schrieb irgendwelches öde Zeug an.
»Nee«, antwortete Janie.
Abby wies mit dem Kopf unauffällig in Orchids Richtung. Das Mädchen schaute stur geradeaus. Ein einziges Heft lag auf ihrem Pult, darauf hatte sie die gefalteten Hände gelegt, so als wollte sie allen zeigen, wie sauber und ordentlich sie war. Egal.
»Wir sollten sie fragen, ob sie sich zu uns setzen will beim Mittagessen«, sagte Abby.
»Ausgeschlossen«, sagte Janie.
»Wieso?«
»Damit wir zugucken dürfen, wie Barn und Slowly sich wie die letzten Idioten aufführen? Nein danke.« Es war schon schlimm genug, dass sie gezwungen waren, mit Barnet und Lehigh, den jeder Slowly nannte, zusammen an einem Tisch zu sitzen. Kein Mädchen, das nicht völlig den Verstand verloren hatte, würde sich freiwillig zu den Kingery-Jungs setzen, aber die beiden waren nun mal Janies Cousins, daran ließ sich nichts ändern. Manchmal war es wirklich nervig, immer nett sein zu müssen.
»Na und? Die beiden führen sich doch auch sonst wie Vollidioten auf.«
Janie beugte sich vor und sah ihrer Cousine fest in die Augen. Lieber Himmel, Abby konnte so was von naiv sein. Manchmal wusste Janie nicht, wer schlimmer war – Abby, die das Gehirn einer Achtjährigen hatte, oder Janies freche kleine Schwester Madeline, die tatsächlich acht Jahre alt war.
»Ich will nicht, dass sich noch jemand zu uns setzt«, sagte Janie und drückte zur Betonung eine Fingerspitze fest auf ihr Pult.
Abby hob beide Hände zum Zeichen dafür, dass sie sich geschlagen gab. »Okay, okay. Meine Güte!« Sie drehte sich wieder nach vorn.
Janie lächelte vor sich hin. Nein danke, sie hatten wirklich keinen Bedarf an einer weiteren Person an ihrem Tisch. In den vergangenen zwei Jahren waren sie immer nur zu viert gewesen: Abby und sie, Barn und Slowly. Und obwohl Barn und Slowly nicht die hellsten Lichter am Baum waren, wie Janies Vater es ausdrücken würde, so hatten die vier zusammen doch einen gewissen Ruf in Fawn Creek zu verteidigen.
Sie waren so etwas wie der Adel dieser Stadt. Den Crawfords, also den Familien von Janie und Abby, gehörten das Restaurant und der Lebensmittelladen im Ort, während den Kingerys, der Familie von Barn und Slowly, der Angelladen gehörte. Beide Familiennamen prangten überall auf Schildern.
»Die Menschen in dieser Stadt schauen zu uns auf, Janie«, sagte ihre Mutter oft. »Du musst achtgeben, mit wem du Umgang hast. Wenn über dich geredet wird, wirft das ein schlechtes Licht auf deinen Vater und mich.«
Wer wusste schon irgendetwas über dieses Mädchen, diese Orchid? Janie hatte noch nie von ihr gehört, bis sie auf einmal dastand. Nicht die kleinste Andeutung beim Mittagessen oder auf dem Heimweg von der Schule, von niemandem. Sie war einfach plötzlich da. Hier bin ich, die lange verlorene Tochter aus Paris und New York, und ich setze mich einfach mal hierhin, auf Renni Deans alten Platz, so als gehörte er mir.
Janie hatte begriffen: Sie mussten sich mit den richtigen Leuten zusammentun. Aber die arme Abby war ein zu schlichtes Gemüt, um den Unterschied überhaupt zu erkennen.
Zum Glück, dachte Janie, hat sie mich.
5
»Wir sollten sie einladen, sich zu uns zu setzen«, sagte Greyson.
Wie ein Geist ging Orchid durch die Schulkantine. Langsam und wie in einem Traum bewegte sie sich, wie ein Vogel, der einen Ort zum Landen sucht. Mit ihren großen blauen Augen scannte sie sorgfältig jeden Tisch.
Die Schule von Fawn Creek war klein, freundlich ausgedrückt. Mittelschüler gab es insgesamt nur neununddreißig und selbst die brachten es fertig, sich in fest geschlossene Grüppchen aufzuspalten.
Orchid betrachtete jeden Tisch genau, blieb aber an keinem stehen. Sie ging erst an den Siebtklässlern vorbei und dann an denen aus der Achten, bis sie schließlich in der Menge hereinströmender Schüler unterging und Greyson sie aus den Augen verlor.
»Ich seh sie nicht mehr«, sagte Greyson, nachdem er sich den Hals in alle Richtungen verrenkt hatte.
»Hast du gesehen, wie viele Äpfel sie auf ihrem Tablett hatte?«, fragte Dorothy, die ihm gegenübersaß. »Wie kann ein einziger Mensch so viele Äpfel essen?«
Greyson seufzte. »Du solltest ihr nachgehen und sie fragen, ob sie sich zu uns setzen mag.«
Dorothy riss die Augen auf, gerade so, als hätte Greyson sie aufgefordert, jemanden umzubringen.
»Ich? Wieso ich?«, sagte sie.
»Weil du ein Mädchen bist.«
»Ja und? Was heißt das?«
»Ich kann doch nicht einfach auf eine Neue zugehen und sie einladen, sich zu uns zu setzen. Die würde doch denken, ich hab sie nicht mehr alle oder ich schleiche ihr nach wie so ein Stalker.«
»Und was, wenn sie von mir denkt, ich hab sie nicht mehr alle oder ich schleiche ihr nach?«
»Wenn ein Mädchen sich mit einem anderen Mädchen anfreunden möchte, denkt sich keiner was dabei. Aber ein Junge, der beim Essen ein Mädchen anquatscht, einfach so?« Greyson schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Entschuldige mal«, sagte Dorothy. »Du bist ein Junge, und ich bin ein Mädchen, und wir essen jeden Tag zusammen.«
»Du weißt genau, wie ich das meine.« Greyson schob sich eine kleine Menge Kartoffelrösti in den Mund. »Und wenn sie sich mit den Crawfords anfreundet, ahnungslos, wie sie ist?«
Dorothy warf einen Blick hinüber zu den Crawford-Cousinen.
»Was sollte ich überhaupt zu ihr sagen?«, sagte Dorothy mit leiser Stimme, während sich ihr Hals langsam rötlich verfärbte. Der Rote Schreck, so nannte Dorothy dieses Phänomen bei sich. Wann immer sie nervös wurde, bildeten sich rote Flecken auf ihrer Haut von der Brust aufwärts bis zu den Spitzen ihrer Ohren. Gerade war es jedoch noch harmlos. Noch.
»Heute machen wir uns darüber keine Gedanken mehr«, sagte Greyson, wobei er darauf achtete, Dorothy nur ins Gesicht zu schauen. »Am Montag gehen wir zusammen zu ihr und fragen sie.«
Dorothy zögerte. »Was, wenn …«
»Was wenn was?«
»Keine Ahnung.« Dorothy zuckte mit den Schultern. Ihre Haut nahm schon wieder ihre natürliche Farbe an. »Was, wenn wir sie nicht mögen? Was, wenn sie nicht zu uns passt? Ich meine, drei sind eine Menge, so sagt man doch, oder?«
»Colt, Daniel und Max hängen die ganze Zeit zusammen rum. Die sind auch drei.«
»Schon, aber Max mit seinem halben Hirn, der zählt nicht«, sagte Dorothy. »Weißt du noch, wie er in der ersten Klasse Rindenmulch vom Spielplatz gegessen hat?«
»Was ist mit Daelyn, Baylee und Hallie?«
Wieder zögerte Dorothy. »Bei denen gehört Gott zur Gruppe. Gott zählt als einer. Mindestens.«
Greyson seufzte. Diese Unterhaltung führte zu nichts, das wusste er auch. Dorothy mochte einfach keine Veränderungen. Normalerweise konnte Greyson damit leben. Aber diesmal war es anders. Es ging um ein neues Mädchen. Nie sonst kamen neue Mitschüler nach Fawn Creek, schon gar keine mit wilder Mähne und einer Blume hinterm Ohr.
Er wollte einfach wissen, wie sie war.
Und er wollte alles über Paris hören.
6
Wie ein Teil der Einrichtung, so fühlte sich Dorothy in ihrem Zuhause. So wie einer der beiden Stühle mit gestreiftem Sitzpolster, die im Wohnzimmer standen. Die Eltern hatten sie irgendwann ins Haus gebracht, seitdem aber kaum beachtet.
Dorothys Eltern machten alles so, wie es sich gehörte. Vor allem Dorothys Mutter. Wenn Dorothy von der Schule nach Hause kam, dann wusste sie schon immer, wo sie ihre Mutter finden würde – nämlich in der Küche, wo sie für ihre Tochter einen Apfel aufschnitt oder eine Apfelsine schälte als kleinen Nachmittagsimbiss. Sie wusste, dass ihre Mutter das Obst auf einen Teller legen würde. Sie wusste, dass ihre Mutter den Teller auf den Tisch stellen würde neben einem zusammengefalteten Küchentuch. Und sie wusste, dass ihre Mutter sie gleich fragen würde, wie es in der Schule gewesen sei.
Wie war’s in der Schule?, fragte die Mutter jedes Mal.
Gut, antwortete Dorothy ebenso regelmäßig und aß dann brav ihr Obst, so wie an jedem Tag seit der ersten Klasse.
Anschließend ging Dorothy auf ihr Zimmer und blieb dort, bis ihr Vater von seiner Arbeit bei den Chemiewerken Gimmerton nach Hause kam und es Abendessen gab. Die Familie setzte sich zu Tisch, aber geredet wurde kaum etwas. Am lautesten war noch das helle Klingklang, wenn Gabeln und Löffel auf Teller trafen. Sie waren Schauspieler in einem Theaterstück, und zwar in der Szene, in der die Familie zusammen isst. Jedem von ihnen war eine feste Rolle zugeschrieben: der schwer arbeitende Vater, die treusorgende Mutter, die pflichtbewusste Tochter.
Aber an diesem Abend hatte Dorothy den anderen etwas zu berichten. Es gab tatsächlich Neuigkeiten.
»Wir haben heute eine neue Mitschülerin bekommen«, sagte sie, während sie auf das Stück Braten auf ihrem Teller starrte.
»Tatsächlich?«, sagte Mrs. Doucet und hörte sich leicht überrascht an. Was aber auch nicht verwunderlich war. Schließlich kamen nicht jeden Tag neue Schüler nach Fawn Creek. »Ich wüsste nicht, dass jemand zugezogen wäre.«
Dorothy sah auf und zuckte mit den Schultern. Ihr Vater kaute mit vollen Backen.
»Hat jemand neu in der Chemiefabrik begonnen?«, fragte Mrs. Doucet ihren Mann.
Dorothys Vater schluckte und schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. In meiner Schicht jedenfalls habe ich niemand Neuen gesehen.«
Dorothy schob die gekochten Möhren auf ihrem Teller herum. Sie mochte Schmorbraten nicht so gerne, beklagte sich aber nie. Zu ihrer Rolle als pflichtbewusste Tochter gehörte es, ihre Meinung für sich zu behalten. Die Stühle mit dem gestreiften Polster beklagten sich schließlich auch nie, und sie würde es genauso halten.
»Sie kommt aus New York City«, sagte sie.
»New York City!«, rief Mrs. Doucet. »Wie sonderbar.«
»Also, ich habe nichts davon gehört, dass jemand aus New York City hergezogen sei«, sagte Dorothys Vater. »Ich wüsste auch nicht, was Leute aus New York bei uns sollten.«
Dorothy sah ihre Eltern an. Sie fragte sich, worüber die beiden wohl nachdachten. Ihre Gesichter waren wie aus Stein – Gesichter wieaus Stein, diesen Vergleich prägte Dorothy sich gleich ein –, und es war schwer zu entscheiden, was da unter der Maske köchelte. Wenn überhaupt etwas. Sie waren völlig anders als andere Eltern. Zum einen waren sie älter. Sie waren schon lange verheiratet gewesen, als Dorothy sich ankündigte. Erst mit fünfundvierzig hatte ihre Mutter sie zur Welt gebracht. Wie oft hatte Dorothy seither gehört, sie sei »eine totale Überraschung« gewesen.
Aber Überraschungen waren nicht immer etwas Gutes, stimmt’s?
Dorothy hatte eine Theorie über ihre Eltern entwickelt. Diese Theorie ging so: Die beiden hatten nie Kinder gewollt. Aber dann – Überraschung! – war’s passiert, und sie hatten keine andere Wahl gehabt, als ihre Rollen so gut wie möglich zu spielen. Dorothy wusste nicht mehr, wann sie zu dieser Erkenntnis gekommen war. Vielleicht hatte sie schon seit ihrer Geburt gewusst, dass sie das fünfte (genau genommen das dritte) Rad am Wagen war, weswegen sie sich immer nach Kräften bemühte, eine gute Tochter zu sein. Sie wollte nicht, dass die beiden einander vor dem Schlafengehen zuflüsterten: Siehst du, genau deswegen hatten wir nie Kinder gewollt! Wenn sie sich zu so etwas wie einem Möbelstück machte, dann hätten ihre Eltern nie einen Grund, enttäuscht zu sein.
Diese Theorie hatte Dorothy für sich behalten, nicht einmal Greyson gegenüber hatte sie sie erwähnt. Höchstens ansatzweise einmal in einem Aufsatz, den sie letztes Jahr in der Unterrichtseinheit Kreatives Schreiben geschrieben hatte. Mrs. Roat hatte ihnen die Aufgabe gestellt, aus Sicht eines unbelebten Gegenstandes zu schreiben. Damals hatte Dorothy über einen Schaukelstuhl geschrieben, der sich ganz verzweifelt wünschte, Teil der Menschenfamilie zu sein, der er gehörte. Als Greyson die Geschichte gelesen hatte, hatte er lange geschwiegen. Dann hatte er gesagt, es sei die beste Geschichte, die er je gelesen habe.
Dann sagte er noch: »Ich wünschte, ich wäre ein Möbel bei mir zu Hause.«
»Warum?«, fragte sie.
»Weil niemand mit Möbelstücken redet.«
7
Für Greyson gab es außer seinem eigenen Zimmer noch zwei weitere Rückzugsorte. Der eine war der kleine gepflasterte Hof hinterm Haus vor dem eingezäunten Blumengarten. Dort verbrachte die schokoladenfarbene Labradorhündin der Familie, Zucchini, den größten Teil ihrer Zeit.
Nach der Schule warf Greyson seinen Rucksack in eine Ecke und ging sofort auf die gläserne Schiebetür zu. Trevor machte sich gerade in der Küche ein Sandwich und hüpfte dabei herum zu Musik, die er über Ohrhörer hörte. Ohne kurz stehen zu bleiben, ging Greyson an Trevor vorbei.
Zucchini wartete schon in dem schattigen Patio. Sie wedelte wild mit dem Schwanz hin und her, trommelte mit den Pfoten auf den Boden und musste sich offenbar richtig zusammenreißen, um nicht an Greyson hochzuspringen. Sie war ein gut erzogener Hund.
Statt auf einen der Gartenstühle setzte Greyson sich auf den nackten Betonboden, und Zucchini warf ihn fast um vor lauter Liebe.
»Wie war dein Tag, Zuki?«, fragte Greyson. »Warst du ein braves Mädchen?«
Damals, als sie Zucchini zu sich nach Hause geholt hatten, war sie noch klein gewesen, hatte aber schon enorm große Pfoten. Auch Greyson und Trevor waren da noch klein gewesen – fünf und acht Jahre alt –, aber schon auf dem besten Weg, Feinde zu werden. Während ihre Mutter in der Küche das Abendessen zubereitete, stritten die Jungen darüber, wie der Hund heißen sollte. Als der Duft von gebackenen Zucchini zu ihnen herüberwehte, rümpfte Trevor die Nase und meckerte. Greyson meckerte ebenfalls. Zucchini gehörten zu den wenigen Dingen, über die sie gleicher Meinung waren.
»Wir sollten den Hund Zucchini nennen«, sagte ihre Mutter. »Dann könnt ihr wenigstens nie mehr ›Ich hasse Zucchini‹ sagen.«
Und dabei war es geblieben.
Streng genommen gehörte Zucchini Greysons Vater, Mr. Broussard. Er hatte die Hündin gekauft und für die Entenjagd ausgebildet. Laut Mr. Broussard war Zuki der beste Jagdhund, den er je gehabt hatte, und so behandelte er sie auch. Wenn sie sich im Schlamm gewälzt hatte, badete er sie. Er nahm sie immer mit, wenn er etwas zu erledigen hatte, und ging mit ihr zum Tierarzt, damit sie ihre Impfungen bekam. Jeden Abend, bevor er schlafen ging, brachte er Zuki einen Napf mit ihrem Futter, und bevor sie sich ans Fressen machte, küsste er sie auf den Kopf.
Greyson konnte sich nicht erinnern, wann sein Vater ihn je umarmt hatte.
Zucchini legte sich neben Greyson und bettete ihren Kopf auf seinen Schoß. Er spürte ihr Gewicht. Aber das machte ihm nichts. Er zog sein Handy aus der Hosentasche und suchte online nach Orchid, während er gedankenverloren den Hund hinter den Ohren kraulte.
Er suchte in allen sozialen Netzwerken, die ihm einfielen, fand aber nicht ein einziges Profil, das zu Orchid Mason gehörte. Es gab ganz allgemein nicht viel zu dem Stichwort. Nur Ortsnamen.
In Charlotte, North Carolina, gab es ein Stadtviertel Orchid Mason.
In Argyle, Texas, die Orchid Mason Lane.
In Burlington, Vermont, die Orchid Mason Apartments.
Aber kein zwölfjähriges Mädchen namens Orchid Mason.
Andererseits – so seltsam war das nun auch wieder nicht, oder? Greyson nutzte soziale Medien kaum. Dorothy auch nicht. Und er war sich ziemlich sicher, dass er selbst im Internet nirgendwo vorkam.
Um ganz sicherzugehen, googelte er sich. Und zu seiner Überraschung gab es doch verschiedene Treffer. Nicht viele, aber immerhin einige. Einen Kommentar zu einem YouTube-Video, den er irgendwann letztes Jahr geschrieben hatte. Ein paar Fotos auf der Homepage der Schule. Auf einer Fanseite für Kate Middleton gab es einen Thread von einem G. Broussard, den er total vergessen hatte. Wie peinlich! Ihm wurde ganz warm, als er sich vorstellte, dass jemand seinen Namen eingab und das fand.
Er schob Orchid also erst einmal aus seinem Gehirn und machte sich stattdessen auf die Suche nach Bildern von Kate Middleton, der Prinzessin von Wales. Während er die Bilder anklickte, warf er ab und zu einen Blick hinüber zum Haus, um sicher zu sein, dass Trevor nicht plötzlich bei ihm auftauchte. Greyson verbrachte übermäßig viel Zeit damit, sich Bilder der Prinzessin anzuschauen, vor allem wenn er sonst nichts zu tun hatte. Dabei war es nicht so, als würde er für sie schwärmen, jedenfalls nicht auf die übliche Art, aber neulich hatte sie ein rotes Mantelkleid getragen mit raffinierten Knöpfen und einer passenden Pillbox auf dem Kopf. So etwas Elegantes hatte Greyson überhaupt noch nie gesehen. Es gefiel ihm, wie sie darin aussah. Sie trug das Kleid, und das Kleid trug sie.
Dann dachte er an seine eigenen Sachen. Sie waren lahm, um es vorsichtig auszudrücken. Obwohl es November war, fühlten sie sich klebrig an von der Hitze und der Feuchtigkeit.
Zeit, ins Haus zu gehen.
Er kraulte Zuki noch ein letztes Mal hinter den Ohren, dann ging er. Aber statt sich direkt in sein Zimmer zurückzuziehen, entschied er sich für seinen zweiten Rückzugsort: das Nähzimmer seiner Mutter. Das war überhaupt sein Lieblingszimmer im ganzen Haus. Der einzige Nachteil war, dass es eine Tür hatte, die andere Menschen öffnen konnten, so wie Trevor es gerade tat, keine fünf Minuten nachdem Greyson sich auf den Boden gesetzt hatte.
»Was machst du denn hier?«, fragte Trevor und streckte kurz den Kopf zur Tür herein. »Hübsche Kleidchen nähen, wie?« Laut lachend verschwand er wieder.
Zu dumm, dass nicht Dienstag oder Donnerstag war; dann hatte Trevor nämlich nachmittags Fahrstunde. Mit gerade mal fünfzehn hatte er seine Eltern angebettelt, sie sollten ihn bei der Fahrschule anmelden, und keine zwei Wochen später war es so weit. Wenn Trevor etwas wollte, dann bekam er es auch.
Greyson konnte den Tag kaum erwarten, an dem Trevor seinen Führerschein bekam; vielleicht würde er dann wegfahren und nie mehr wiederkommen.
Übrigens nähte Greyson keine hübschen Kleider, er tat überhaupt gar nichts. Er saß einfach nur auf dem Boden, umgeben von Kissen, Hosen und Hemden, hielt sein Handy in der Hand und scrollte immer weiter hinunter. Er hielt den Bildschirm leicht zu sich gekippt, zum Schutz vor neugierigen Blicken. Trevor hatte die Angewohnheit, sich über alles lustig zu machen, was Greyson sich gerade im Internet ansah, und so war Greyson zu Hause dazu übergegangen, seinen Bildschirm grundsätzlich vor fremden Augen abzuschirmen, selbst wenn er gerade ganz alleine war.
Er schloss alle Tabs und überlegte, ob er vielleicht Dorothy anrufen sollte, aber ihr Vater sah es nicht gerne, wenn sie lange telefonierte.
Er lehnte seinen Kopf gegen eine Reihe von Kissen. Dann hörte er, wie die Haustür aufgeschlossen wurde. Mom war zurück.
Trevor war wirklich bescheuert! Niemand nähte Kleider in diesem Raum, selbst seine Mutter nur ganz selten. Hauptsächlich machte sie Änderungen oder stickte auf Anfrage inspirierende Zitate auf Kissenbezüge. Die meisten Aufträge bekam sie über Facebook, wo sie Bilder postete und so Werbung für sich machte. Das ganze Zimmer war dekoriert mit Kissenbezügen, auf denen halb fertige Sinnsprüche prangten wie Lebe Lache Liebe oder Tanze, als könnte niemand dich sehen