
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Das Problem ist, dass ich ihn nicht fragen muss, ob er für mich sterben würde. Vielmehr ist die Frage, ob er für mich leben würde. Und ich fürchte mich vor der Antwort.« Faye hat nicht den leisesten Schimmer, was sie in der Klinik erwartet. Sie weiß nur eins: Sie muss ihre depressiven Gefühle und Gedanken für ihre Mutter bekämpfen. Doch auch dort wird ihr das Leben nicht leichter gemacht. Denn der attraktive Cailan verhält sich genauso wie die Menschen, vor denen sie zu entkommen versucht: herablassend - rücksichtslos - eiskalt. Bald muss sie sich jedoch die Frage stellen, ob er das ist, was sie von ihm hält und ob ihr kleines Geheimnis noch sicher ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Eltern und meine Schwester, die für mich gekämpft haben,
wann immer ich mich aufgegeben habe,
und für meine wundervolle Oma,
die für immer in meinem Herzen weiterleben wird.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
KAPITEL 1
Liebe Gina,
heute ist es so weit. Heute ist der große Tag der Veränderungen – zumindest glaubt das der aufgeregte Mensch ein Stockwerk tiefer, der sich Mutter nennt. Sie ist der festen Überzeugung, dass es mir bald besser gehen werde. Tatsächlich glaubt sie, dass irgendwelche Leute in weißen Kitteln, die denken, sie wären etwas Besseres, meine Dämonen verscheuchen könnten. Als könnten ausgerechnet Fremde irgendetwas an meiner Gefühlswelt ändern!
Sie lächelt heute entscheidend mehr als sonst, und ich spiel das Spielchen mit. Ich möchte nicht, dass sie sich weiterhin Sorgen um mich macht oder meine furchtbar schlechte Laune aushalten muss, die ich dauernd bei ihr auslasse, indem ich so etwas wie ihre Fotorahmen auf den Boden zersplittern lasse. Anschließend muss ich mich zwar immer vor schlechtem Gewissen übergeben, aber trotzdem komme ich immer und immer wieder in diese Situation, in der ich meine Gefühle nicht kontrollieren kann. Eigentlich sind negative Erfahrungen dazu da, dass man aus seinen Fehlern lernt, aber auch wenn ich mich noch so oft übergebe, würde ich es immer wieder tun, weil ich ein egoistischer und selbstzerstörerischer Mensch bin – und weil meine Gedanken, verknüpft mit meinen Taten, nicht mehr kontrollierbar sind.
Ich vermisse dich. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Faye
Seufzend strich ich mit der Kuppe des Zeigefingers über die letzten Worte, die aus den Tiefen meines Herzens entsprungen waren, und steckte den kleinen Brief in einen türkisfarbenen Umschlag. Anschließend verstaute ich ihn in meiner Schublade und fühlte mich augenblicklich freier als zuvor. Das ging mir immer so, wenn ich Gina schrieb. Es war, als könnte sich meine Seele entfalten und als gäbe es keine Regeln mehr, welche Dinge ich erzählen durfte und welche nicht. In meiner Welt war das zu einer wichtigen Frage geworden. Was durfte ich von mir preisgeben, und welche Informationen würden Menschen verwenden, um mich zu zerstören? Früher hatte ich dieses Problem überhaupt nicht gekannt. Da hatte es nichts gegeben, wovor ich Angst gehabt oder wofür ich mich geschämt hätte bis auf die ganz normalen Dinge, die einen vermutlich ab der Pubertät so schrecklich peinlich waren. Mit der Zeit hatte ich gelernt, dass die Welt, in der ich lebte, kein Ort gutherziger Menschen war. Es gab Krieg, es gab Mobbing, es gab Verrat, es gab Lügen und Hass. Das alles hatte ich nicht wie andere nach und nach durch Medien realisiert. Vielmehr hatte ich es größtenteils am eigenen Leibe erkennen müssen, und es prägte mich bis heute. Ich war in einer Welt groß geworden, in der es den Weihnachtsmann oder den Osterhasen gab, in der man frei sein konnte und sich ausleben durfte, ohne Angst haben zu müssen, jemand verurteilte einen dafür, wer man war. Doch dann irgendwann verpuffte meine Illusion, und die Menschheit offenbarte mir, dass ich nur in einer Luftblase aus Lügen gesteckt hatte. Das Letzte, was ich sein durfte, war ich selbst. Ich hatte eine wunderbare Kindheit gehabt, ich war glücklich und zufrieden gewesen, aber gerade aus diesem Grund war der Aufprall auf den Boden, als die Luftblase irgendwann geplatzt war, auch so schmerzhaft gewesen.
Langsam stand ich auf und richtete den Blick auf den schlichten, großen Spiegel an der Wand meines Zimmers. Meine mahagonibraunen Haare fielen mir wellig über die Schultern und kräuselten sich an der Spitze in alle Himmelsrichtungen. Doch meinen Haaren schenkte ich nur wenig Beachtung, vielmehr starrte ich in die grauen Augen des Mädchens, das genau in meine sah. Der leere Ausdruck in ihnen, als würde man nur eine bloße Hülle erkennen, die keinerlei Gefühle beinhaltete, erschütterte mich jedes Mal erneut. Kein Funkeln, kein Strahlen, sie waren das Nichts – genauso wie das Mädchen selbst. Ich schaute nicht oft in den Spiegel, aber wenn ich es tat, schossen mir immer wieder die gleichen Fragen durch den Kopf: Wer bist du? Warum bist du so? Warum kannst du nicht anders sein? Und auf keine dieser Fragen hatte ich jemals eine Antwort erhalten.
Die Gesellschaft hatte schon lange ein Idealbild des Aussehens aufgestellt, dem ich absolut nicht entsprach. Ich war nicht sonderlich groß, hatte nicht sonderlich auffallende Augen, besaß nicht gerade die vollsten Lippen, und von meinen Brüsten wollten wir gar nicht erst anfangen. Mein Inneres sagte mir immer wieder, dass das alles Blödsinn sei, was einem das Internet und die Magazine einredeten. Die Fotos der meisten Models waren in den Zeitschriften bearbeitet worden, und das Idealbild konnten vielleicht zwei Prozent der Menschheit erreichen, ohne sich mehreren Operationen zu unterziehen. Warum machte ich mich also eigentlich verrückt? Ich hatte immer die Einstellung vertreten, dass jeder Mensch etwas Besonderes an sich habe und dass dies meistens sogar die Dinge waren, die man selber als Makel bezeichnete. Mir war klar, dass jeder Mensch einen anderen Geschmack hatte, ähnlich wie beim Essen. Manche hassten Spinat, manche liebten ihn. Manche fanden Rosenkohl total widerlich, manche konnten davon nie genug bekommen. Und manche fanden eben blondes Haar besonders attraktiv, andere schwärmten für Brünette. Es war also vollkommen egal, wie du aussahst – es gab immer Menschen auf dieser Welt, die dich hübsch finden würden. Ich wusste, dass ich die richtige Einstellung zu diesem ganzen Schönheitsideal hatte, aber wann immer ich mich im Spiegel ansah, konnte ich mich einfach nicht selber davon überzeugen, dass mich irgendjemand hübsch finden oder mich gar lieben konnte. Konnte dich überhaupt jemand lieben, wenn du dich selbst verachtetest?
»Faye? Bist du so weit?«, rief meine Mutter von unten und riss mich damit aus den Tiefen meiner Gedanken. Sie klang regelrecht euphorisch, und ich musste seufzen. Natürlich war sie froh darüber, dass ich diesen Schritt nun wagte. Wie lange hatte ich sie mit meinen Gedanken und Launen gequält, bis ich endlich eingelenkt hatte! Doch egal, wie sehr ich mich vor dem Neuen und Ungewissen fürchtete, ich war es ihr schuldig. Ich atmete tief ein und aus, bevor ich meinen Koffer vom Bett hob und ihn neben mich auf den Holzboden sinken ließ. Mit flauem Magen marschierte ich mit dem Gepäck aus meinem Zimmer, und als ich am Treppenabsatz stehen blieb, blickte ich mich noch einmal um. Die Zeit, in der ich meine Gefühle jederzeit äußern konnte, war vorbei, und ich fragte mich schon jetzt, wie ich das aushalten sollte. Dies war mein Rückzugsort und das Einzige, was mir Sicherheit vermittelte. Nichts hätte mir ein ähnliches Gefühl schenken können, dessen war ich mir ganz sicher.
Als ich die Stufen zum Flur hinunterschlenderte und dabei den Koffer bei jedem Schritt gegen das Geländer knallen ließ, spürte ich bereits die Präsenz meiner Mutter und wusste sofort, ohne aufsehen zu müssen, dass sie an der Wand neben dem großen Porträt meines verstorbenen Opas stand und mich musterte, doch ich schaute sie nicht an. Ich wusste, dass sie sich sorgte, und ich wusste auch, dass mein Blick alles nur noch schlimmer machen würde. Als ich die letzte Stufe hinunterstieg, stellte sie sich direkt vor mich und zog mich in eine Umarmung. Sofort versteifte ich mich – wie jedes Mal, wenn sie meine Nähe suchte – und ließ automatisch meine Arme wie eine Puppe schlaff an meinem Körper herunterhängen, anstatt ihre Umarmung zu erwidern. Es war nicht so, als hätte ich sie nicht lieb gehabt, ganz im Gegenteil, aber mein schlechtes Gewissen zerfraß mich, unsere Auseinandersetzungen zehrten an mir, und ich hatte das Gefühl, ich würde meinen Stolz überwinden müssen, wenn ich sie umarmte. Meine Mutter war das Einzige, was mir noch geblieben war, und ich stand im Zwiespalt zwischen »Lass mich nicht allein« und »Fass mich bitte nicht an«. Nichts von meinen Gedanken ergab einen Sinn, und das war der Punkt. Meine nachdenkliche Art brachte mich täglich dazu, mehr an mir zu zweifeln, und auch das war ein Grund für meine Zurückhaltung. Ich glaubte, ich würde ihre Liebe nicht verdienen. Nicht nach allem, was ich ihr angetan hatte. All die Wutausbrüche, all die Dinge, die ich ihr an den Kopf geschmissen hatte, obwohl ich es nicht im Geringsten so gemeint hatte. Ich war ein grausamer Mensch, und sie tat so, als wäre das nicht der Fall; so, als wollte sie es nicht wahrhaben, dass ihre einzige Tochter verkorkst war. Langsam strich sie mir beruhigend über den Rücken und kommentierte meine Zurückweisung in keiner Weise. Das liebte ich an ihr: Sie schenkte mir Nähe – obwohl ich es nicht zuließ –, weil sie wusste, dass ich es insgeheim brauchte. Und genau deshalb wuchs mein schlechtes Gewissen auch ins Unermessliche. Ich hatte das alles einfach nicht verdient. »Ich bin mir sicher, dir wird es bald wieder besser gehen, mein Schatz«, murmelte sie und küsste mich auf die Schläfe. Als sie mich losließ, lächelte ich ihr bloß ins Gesicht, um ihr zu signalisieren, dass ich gleicher Ansicht und genauso zuversichtlich sei. Natürlich war dem nicht so, aber niemals hätte ich meiner Mutter noch mehr Sorgen bereiten wollen. Sie hatte selber so viel hinter sich, dass sie es nicht im Geringsten verdiente, noch unglücklicher zu werden, nur weil ich mich nicht ein Mal zusammenreißen konnte.
Als ich mich auf dem Beifahrersitz positioniert hatte, nachdem ich meinen Koffer im Kofferraum verstaut hatte, fühlte ich mich absolut leer. Und als meine Mutter den Motor startete, hatte ich das Gefühl, von tausend Gefühlen überrannt und erdrückt zu werden. Manchmal spürte ich gar nichts, wirklich rein gar nichts, und manchmal spürte ich alles bis in jede Pore meines Körpers. Das war so verwirrend und erschöpfend zugleich, dass ich am liebsten für immer geschlafen hätte, um davor zu fliehen. Zugegeben, es war meistens meine eigene Schuld, denn wann immer ich so viele Empfindungen hatte, dass ich durchdrehen konnte, verdrängte ich sie wieder und war demnach wie auf einer Wippe gefangen. Wann immer ich mich nicht konzentrierte, fiel ich in dieses Loch der Gefühle. Ich war mittlerweile sehr gut darin, meine Panik und Trauer auszublenden und zu verdrängen. Natürlich waren diese Empfindungen immer in mir und brachen, wenn ich sie nicht kontrollierte, in einem gewaltigen Ausmaß aus mir heraus, aber für ein paar Stunden konnte ich so tun, als wäre ich eine normale junge Frau – die eine leere Hülle darstellte.
Schweigend fuhren wir an Familienhäusern und Straßenschildern vorbei, die Musik lief leise im Hintergrund, doch keine von uns beiden machte auch nur Anstalten mitzuwippen geschweige denn mitzusingen. Vor ein paar Jahren war das noch anders gewesen – da hatten wir immer zusammen laut gesungen und uns anschließend ausgelacht, weil uns die Autofahrer an den roten Ampeln amüsiert beobachtet hatten. Wir waren frei, doch diese Zeit gehörte längst der Vergangenheit an. Mittlerweile waren Autofahrten für mich anstrengend, weil ich immer wieder Angst hatte, dass ich einen Gefühlsausbruch jeglicher Art bekommen könnte und keinerlei Möglichkeit hätte wegzulaufen. Deshalb versuchte ich auch immer, still zu sein, und hoffte inständig, dass meine Mutter kein Thema anspräche, das mich zum Weinen oder Ausrasten brächte. Und weil das so gut wie bei jedem Thema zwischen uns passierte, war ich ihr zutiefst dankbar, dass sie einfach die gesamte Fahrt über schwieg, während ich mir meine Kopfhörer in die Ohren stopfte und laut Musik hörte.
Als wir nach einer knappen Stunde auf einem riesigen Parkplatz ankamen, polterte mein Herz wie verrückt in der Brust, und ich zog mir mit einem kräftigen Ruck beide Kopfhörer aus den Ohren. Ich starrte mit trockenem Hals aus dem Fenster und betrachtete mein Gefängnis, das ich für die nächsten Wochen oder Monate betreten musste – und das theoretisch freiwillig. Die Klinik war riesig. Hätte ich nicht besser gewusst, dass es ein steriles und einengendes Gebäude war, hätte ich fast annehmen können, es wäre eine Villa. Das Haus war schlicht in Weiß gehalten, und ich war der festen Überzeugung, dass das Innere genauso aussah. Die Fenster im Erdgeschoss waren mit kleinen Gitterstäben bestückt, damit keiner ausbrechen konnte, und ich fragte mich, wie dieses Gebäude einem Gefängnis noch ähnlicher werden könnte. Und oft geöffnet wurden die Fenster mit Sicherheit auch nicht. Ein weißes, steriles, einengendes und stickiges Gebäude mit einer Menge Leute, die mich rund um die Uhr bewachen würden – großartig. Wenigstens hatte die Klinik keine Nachbarn, was bedeutete, dass ich vielleicht nicht jeden Sonntag von Kettensägen oder Rasenmähern geweckt werden würde, die einen Lärm machten, der dem Krach einer Atombombe glich.
»Bist du aufgeregt?«, fragte mich meine Mutter vorsichtig, als sie den Motor abstellte und mich nach einer Stunde das erste Mal wieder ansah.
Meine Verzweiflung und Angst, gemischt mit solch einer Frage, waren der perfekte Auslöser eines Wutausbruches, doch ich biss mir auf die Wange, bis ich Blut schmeckte, damit ich mich zusammenriss.
»Nein«, erwiderte ich bloß und hoffte, sie nahm den Sarkasmus nicht wahr. Natürlich war ich aufgeregt und ängstlich. Am liebsten hätte ich hier und jetzt losheulen können, aber mein bescheuerter Stolz verlangte von mir, dass ich so zu tun hatte, als wäre ich die Ruhe selbst. In meiner Welt bedeutete Schwäche zeigen, sich den anderen auszuliefern, obwohl ich Gefühle wie Angst und Trauer eigentlich nicht als Schwäche bezeichnen wollte. Doch egal, wie sehr du auf deiner eigenen Einstellung beharrtest, irgendwann übernahm dein Hirn die Meinung der anderen, und dann standest du im Zwiespalt zwischen dem, was du wusstest, und dem, was dir andere aufzwangen.
»Das musst du auch nicht sein. Du wirst dich mit allen bestimmt gut verstehen«, sagte sie lächelnd und stieg aus dem Wagen.
Vermutlich sagte sie das, weil ich mich auch immer mit allen gut verstand, bis sie merkten, was für ein verkorkster Mensch ich eigentlich war. Meine Mutter hatte sich immer tierisch gefreut, als ich Mitschüler mitbrachte, doch jedes Mal, wenn die Wochen vergingen und sich keiner mehr bei uns blicken ließ, löcherte sie mich mit Fragen, warum ich keine Freunde mehr hätte. Also unterließ ich das Kennenlernen neuer Menschen, weil sie mich früher oder später für krank erklärten und gingen. Und diese besorgten Blicke meiner Mutter, wann immer sie in mein abgedunkeltes Zimmer kam, während ich tagelang im Bett lag, konnte ich mir ebenfalls nicht mehr antun. Die Zeiten, in denen ich mir eingeredet hatte, wirkliche Freunde zu haben, waren sowieso längst vorüber. Denn ich hatte eingesehen, dass ich mich bloß von einer Illusion ernährt hatte, um ein Gefühl zu erzwingen, das mich belebte, weil ich mich nicht mehr für einsam hielt. Aber ich schätzte, nachdem ich so vielen Menschen die Tür geöffnet hatte, während sie mir die Bude ausgeräumt hatten und dann wieder gegangen waren, war ich irgendwann müde geworden von der Hoffnung, ich würde einem Menschen die Tür öffnen, der bliebe. Und deshalb ließ ich die Tür lieber geschlossen, als das Risiko einzugehen, noch mehr zu verlieren.
Ich verdrehte aufgrund des Kommentars meiner Mutter die Augen und öffnete die Autotür, um meinen Weg in die Hölle anzutreten. Um das riesige Haus herum standen vereinzelt ein paar Bäume, und jetzt, da ich genauer schauen konnte, entdeckte ich tatsächlich an der Seite des Gebäudes eine eingezäunte, relativ große Wiese. Wir hatten also auch mal Auslauf? Wie gnädig. Eingezäunt wie Kaninchen im Außengehege – ich würde mich hier sicherlich total normal fühlen. In der rechten Ecke der Wiese befand sich eine Koppel, und ich fragte mich direkt, was diese für eine Funktion haben mochte, doch meine Spekulationen wurden durch eine Berührung beendet: Meine Mutter legte ihren Arm um meine Schulter, wobei ich wieder einmal zusammenzuckte, und führte mich zusammen mit meinem Koffer, den sie hinter sich herzog, zum Eingang meiner persönlichen Folterkammer. Kurz verspürte ich den Drang, einfach wegzulaufen, noch war es nicht zu spät, doch der Gedanke verpuffte regelrecht wieder, als ich mich auf das Gewicht des Armes meiner Mutter konzentrierte. Ich musste ihr zuliebe einfach durchhalten und mich zusammenreißen. Schlimmer konnte es nicht mehr werden, und selbst wenn, hatte ich immer die Option, alles zu beenden. Mehr als zu versuchen, etwas zu ändern, blieb mir ohnehin nicht übrig, wenn ich wollte, dass es meiner Mutter wieder besser ging und sie mich nicht dauernd mit müden und traurigen Augen betrachtete.
Als meine Mutter an der Klingel drückte und jemand die Tür von innen aufschloss, hatte ich das Gefühl, alles geschähe in Zeitlupe. Hätte ich das hier alles verhindern können? Eine Frau mittleren Alters öffnete die schwere Tür und lächelte meine Mutter freundlich an. Ihre strubbeligen, schwarzen Haare reichten ihr bis zu den Ohrläppchen, und mir fiel sofort auf, dass das Lächeln, das ihre schmalen Lippen umspielte, nichts als heuchlerische Freundlichkeit war. Wenn ich etwas gelernt hatte, dann das, diese kleinen Unterschiede auf Anhieb erkennen zu können. Ein weiterer Hinweis neben ihrem halbherzigen Heben der Mundwinkel waren ihre braunen Augen, die während dieser Mimik nicht das reinste Funkeln ausstrahlten. Ich würde mich hier absolut nicht wohlfühlen, dessen war ich mir direkt sicher.
»Frau Allington?«, fragte die Dame höflich meine Mutter, und noch bevor sie ihr antworten konnte, richtete sie den Blick auf mich. »Du musst Faye sein, richtig?«
Ich nickte bloß mechanisch und bekam nur am Rande mit, dass ich ihre kalte Hand schüttelte. Das war alles so unwirklich.
»Kommen Sie doch rein. Ich bin Frau Graves, Fayes Betreuerin«, sagte sie wieder an meine Mutter gewandt, und ich hatte das Gefühl, ein kleines Schulkind zu sein, dessen Mama alles regeln musste. Ich war verdammte siebzehn und keine sieben Jahre alt – oder zählte man hier als Kind, weil man psychisch krank war? Wurde man wie in manchen Altenheimen nicht mehr als reifer Mensch eingestuft, sondern behandelt wie ein kleines Kind, das keinerlei Entscheidungen mehr treffen konnte; das weder bestimmen durfte, wann es essen noch wann es schlafen wollte? Aber ganz ehrlich: Egal wie sehr ich mich in diesem Moment aufregte, ich wusste, dass das so kommen würde. Dazu hatte ich mich die letzten Tage viel zu viel mit Erfahrungsberichten aus dem Internet beschäftigt. Also trottete ich bloß hinter meiner Mutter her und stöhnte innerlich auf, als wir das Innere dieses Knastes betraten. Steriler, einengender Raum Nummer eins. Ich würde gern beschreiben, wie der gesamte Vorraum und der daran anknüpfende Flur aussahen, doch außer Weiß war hier nicht viel zu bestaunen. Meine Mutter schaute sich in kurzen Abständen immer wieder zu mir um und bedachte mich mit einem besorgten Blick, sodass ich darauf achtete, so zu tun, als würde ich mich interessiert umschauen – wobei ich kaum glaubte, dass sie mir das abkaufen konnte. Denn auch ihr musste bewusst sein, dass hier nicht im entferntesten Interesse aufkommen konnte. Als wir zu einem neuen Flur kamen – übrigens steriler, einengender Raum Nummer zwei –, standen wir vor drei Treppen, die jeweils in andere Richtungen führten.
»Unsere Klinik leitet drei Gruppen. Faye hat Glück, dass wir in einer Gruppe noch Plätze zu vergeben haben«, erklärte Frau Graves schnell und stieg die linke Treppe hinauf.
Als ich an der Treppe vorbeischaute, konnte ich einen großen Raum ausmachen, der augenscheinlich eine Cafeteria darstellen sollte, und mich schüttelte es bei dem Gedanken, dass das Essen hier genauso schmecken könnte wie das, was man in unserer Schulkantine als Speise betitelte.
»Bitte folgen Sie mir«, sagte Frau Graves, die auf der Hälfte der Treppe innehielt und mich und meine Mutter, die genauso wie ich in die Cafeteria schaute, beobachtete.
Ich hatte schon jetzt absolut keinen Nerv mehr, wenn diese Frau anfing zu sprechen. Stillschweigend folgten meine Mutter und ich ihr, und als wir vor einer weiteren Tür ankamen und sie von dieser heuchlerischen Frau aufgeschlossen werden musste, fühlte ich mich tatsächlich wie eine waschechte Kriminelle.
Mit einem aufgesetzten Lächeln und einer einladenden Handbewegung winkte sie uns herein, als wäre sie dem Märchen Hänsel und Gretel entsprungen. Das Grinsen einer Hexe konnte sie zumindest grandios imitieren. Zu meiner Überraschung hingen hier einige bunte Bilder an einigen Stellen, und die Wände waren in einem pastellrosa Ton sowie einem Cremeweiß gestrichen. Und trotzdem war es einengend, egal wie riesig dieses Gebäude auch sein mochte.
»Die anderen Patienten sind zurzeit noch in ihren Betten. An Sonntagen dürfen sie länger schlafen«, sagte sie lachend zu meiner Mutter, und ich fragte mich, ob sie sich dessen bewusst war, dass sie hier in einer Klinik für Jugendliche arbeitete und nicht in einem verdammten Kindergarten. Sie führte uns einen Gang entlang und zeigte immer mal wieder auf Türen von Waschräumen und Toiletten und eventuell auch von anderen Räumen, doch bei der Hälfte ihrer Führung hörte ich schon gar nicht mehr zu. Diese Frau ging mir auf die Nerven mit ihrem aufgesetzten Grinsen und ihrer hohen Stimmlage, als würde sie mit kleinen Kindern kommunizieren.
Als wir zu meinem Zimmer und somit zu dem Höllentor der nächsten Monate ankamen, strengte ich mich an, wieder zuzuhören.
»Faye muss sich momentan noch kein Zimmer teilen, sie ist das dritte Mädchen in dieser Gruppe«, verkündete Frau Graves, und schon keimte Hoffnung in mir auf. Vielleicht hatte ich doch meine Zeit, um ab und zu meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen.
»Ich lasse Sie einen Moment allein, um sich zu verabschieden.« Frau Graves beäugte mich noch einmal, bevor sie das Zimmer verließ. Langsam schaute ich mich um: Weiß, steril und einengend, aber wenigstens hatte ich hier meine Ruhe. Vor dem schmalen Bett an der Wand hatte ich eine Nachttischlampe, und ich malte mir schon aus, wie oft ich wohl nachts wachliegen und einfach nur lesen würde, bis meine Augen von allein zufielen. An der anderen Seite des Raumes stand ein ziemlich großer Schrank, und ich fragte mich, wie lange sie wohl eingeplant hatten, dass ich bleiben würde. Bei diesem Gedanken wurde mir ganz anders.
Neben dem Schrank stand ein kleiner Holztisch mit einem Stuhl davor und auch davon war ich positiv überrascht. Vielleicht sollte ich nicht immer vorschnell urteilen.
»Ist doch ganz nett hier«, sagte meine Mutter, und augenblicklich schaute ich ihr ins Gesicht. Sie war wohl der einzige Grund, weshalb ich das hier auf mich nahm, und immer wieder, wenn ich in ihre müden Augen sah, wusste ich, dass es das so was von wert war.
»Ja, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt«, erwiderte ich ehrlich und grinste kurz.
Sie kam auf mich zu und nahm mich fest in den Arm, ignorierend, dass ich mich mal wieder versteifte. »Ich wünsche mir so sehr, dass es dir bald wieder besser gehen wird! Pass auf dich auf, und nutze die Zeit hier, um über deine Gefühle und Gedanken zu reden.«
Ich nickte an ihrer Schulter und unterdrückte meine Tränen. Dies war der Moment, vor dem ich mich am meisten gefürchtet hatte: Die einzige Person, die ich hatte, verließ mich. Meine Mutter drückte mich noch ein letztes Mal fester und gab mir, als sie sich von mir löste, einen Kuss auf die Stirn. Dann drehte sie sich um und verließ mein Zimmer. Ohne darüber nachzudenken, lief ich ihr nach auf den Flur und schaute zu, wie sie mit schnellen Schritten zu der Tür ging, die Frau Graves bereits freundlich aufhielt. Kurz wechselten sie noch ein paar Worte, bevor sie sich die Hand reichten und meine Mutter die Station verließ. Dies war mit Abstand der Moment, an dem ich mich am einsamsten fühlte. Tränen flossen über mein Gesicht, ohne dass ich sie zurückgehalten hätte. Meine Mutter drehte sich nicht einmal um, und ich fragte mich, ob sie es nicht tat, weil es ihr genauso schwerfiel wie mir. Ich wusste, dass sie mich um jeden Preis am Leben erhalten wollte, und ich verstand das. Aber waren wir mal ehrlich: Dies hier war kein Leben mehr.
KAPITEL 2
Als Frau Graves die Tür verschlossen hatte, kam sie auf mich zustolziert und reichte mir ein Taschentuch. »Du wirst dich schnell einfinden«, sagte sie beiläufig und bedachte mich mit einem flüchtigen Blick. Am liebsten wäre ich ihr ins Gesicht gesprungen wie eine kleine Katze und hätte ihr das gekünstelte Lächeln zerkratzt, das sie aufgesetzt hatte. Doch stattdessen nickte ich ihr bloß zu und schaute auf den Boden, um mein verheultes Gesicht vor ihr zu verbergen. Ich hasste es abgrundtief, wenn mich jemand dabei erwischte, wenn ich weinte, und noch mehr hasste ich es, wenn das Menschen waren, die keinerlei Ahnung hatten, wie sie darauf zu reagieren hatten, und mich mit ihrer taktlosen Art noch mehr aus der Bahn warfen. Sollten Betreuer in einer Klinik nicht eigentlich richtig gut darin sein zu trösten, oder waren das bloß meine hirnrissigen Erwartungen, die ich hegte, um meine Unsicherheit zu lähmen?
Mit einem gefühllosen Tätscheln ging sie an mir vorbei in mein vorübergehendes Zimmer. Ich folgte ihr und fragte mich, wo diese Frau ihre pädagogische Lizenz gewonnen hatte, um hier angestellt werden zu können.
»Du hast doch sicherlich ein Handy dabei«, mutmaßte sie, als ich den Raum betrat, und streckte prompt ihre Hand aus. »Wir möchten, dass ihr so wenig Zeit im Internet verbringt wie möglich, damit ihr euch vollkommen auf eure Genesung konzentrieren könnt.«
Mit großen Augen starrte ich sie an. »Aber wie soll ich dann Kontakt zu meiner Mutter halten?«
»Es gibt so etwas, das nennt sich Briefe. Sehr altmodisch, aber effizient«, erwiderte sie und streckte ihre Hand noch weiter aus, höchstwahrscheinlich um mir zu signalisieren, dass sie keine Widerrede duldete. Ich biss die Zähne zusammen und holte mein Handy mitsamt meinem MP3-Player heraus. Effizient wäre sicherlich auch ein Anruf bei ihrem Chef gewesen, in dem ich ihm mal erläuterte, wie taktlos seine Angestellte war.
»Den musst du nicht abgeben«, sagte Frau Graves und zeigte auf meinen schwarzen Musikplayer, der bereits mehrere Kratzer auf dem Lack und dem Display aufwies. Ich hätte ihr am liebsten ins Ohr geschrien, dass ich das auch nicht vorhatte, doch ich nickte bloß und reichte ihr mein Handy.
Sie schob es sich in ihre Hosentasche und richtete ihre khakifarbene Strickjacke, die ihr definitiv drei Nummern zu klein war.
»Wir legen hier großen Wert auf Sicherheit«, teilte Frau Graves mir mit, als ich noch immer im Türrahmen stand, und zog meinen Koffer, ohne mich um mein Einverständnis zu bitten, zu sich. »Jetzt wollen wir erst mal sehen, was du mithast.« Ungläubig starrte ich sie an. Wollte sie jetzt tatsächlich meine Unterwäsche ohne Einwilligung durchkramen?
Anscheinend schon, denn sie öffnete meinen Koffer und wühlte mit gerunzelter Stirn durch meine Klamotten, bis sie meinen Kosmetikbeutel fand und den Reißverschluss hastig öffnete. Heraus zog sie meinen Rasierer und schaute mich geschäftig an. »Die Rasierklinge kommt zu uns. Wenn du dich rasieren möchtest, sag uns Bescheid, dann gehen wir mit dir zusammen ins Bad.« Privatsphäre? Leb wohl.
Beiläufig legte sie meinen Rasierer neben den Koffer und durchwühlte weiter meine Sachen. Als sie meine Hülle mit den türkisfarbenen Umschlägen herausholte und in die Luft hielt, stolperte mein Herz über sich selbst. »Was ist das?«, fragte sie neugierig und schaute mich abermals an.
»Briefe«, sagte ich bloß und hoffte inständig, dass sie mich nicht weiter danach ausfragte.
»Okay«, erwiderte Frau Graves desinteressiert und runzelte die Stirn. »Gut, ansonsten denke ich, dass hier nichts versteckt ist, was dich verletzen könnte. Du hast jetzt genügend Zeit, dich einzurichten. Frau Dr. Henderson, deine Psychiaterin, erwartet dich in einer Stunde im Therapieraum. Ich hole dich hier ab und bringe dich dann hin.« Mit diesen Worten richtete sie sich auf und ging mitsamt meinem Rasierer aus dem Zimmer.
Ich ballte die Hände zu Fäusten und kämpfte mit aller Macht gegen meine Gefühle an, um nicht loszuheulen. Ich würde das hier durchziehen und mein Bestes geben, so, wie ich es meiner Mutter vor wenigen Wochen versprochen hatte.
Also atmete ich ein paar Mal tief ein und aus und verstaute dann meine Kleidung in dem riesigen Schrank. Meine Hülle mitsamt den ausgewählten Briefen, die ich unbedingt mitnehmen wollte, sowie Papier und Stifte legte ich neben dem Bett in die Kommode, und meinen Koffer schob ich unter das kleine Holzbett. Anschließend ließ ich mich auf ebendieses fallen und betrachtete die kahle, sterile, einengende, weiße Decke. Eigentlich war es nichts wirklich Fremdes für mich, hier zu liegen und ins Leere zu starren, es war schließlich genau das, was ich auch zu Hause immer tat, wenn mir meine Gedanken die Sinne vernebelten. Aber diesmal war es anders. Ich konnte mir immer einreden, dass das alles nur eine Phase wäre. Ich konnte mir einreden, dass es von heute auf morgen wieder besser werden könnte und meine Motivation zurückkehrte. Hier zu sein, war der Beweis dafür, dass ich mich und mein Leben nicht mehr unter Kontrolle hatte. Es war ein Indiz dafür, dass ich Hilfe dabei brauchte, um wieder glücklich zu werden – falls ich jemals wieder glücklich werden würde. Meine Mutter hatte mir mal gesagt, dass es okay sei, sich Hilfe zu suchen, und dass es okay sei, wenn man Schwäche zeigte. Wenn es so okay war, warum fühlte ich mich so wahnsinnig beschämt? Ich wusste, dass ich mir das Ganze hier nicht ausgesucht hatte und ich mir auch ganz sicher nicht ausgesucht hatte, dass es mir nicht gut ging. Aber in dieser Gesellschaft bekam man nur Zuspruch, wenn man körperlich krank war. Wenn du eine psychische Krankheit hattest, war Spott dein ständiger Begleiter. Mich machte diese Denkweise wütend, und ich verachtete sie allesamt dafür, dass sie nicht verstehen wollten, dass ich weder Mitleid noch Aufmerksamkeit wollte. Ich wollte in Ruhe gelassen werden und meinen Tag hinter mich bringen, ohne noch unglücklicher zu werden, indem man mich wegen meiner Traurigkeit auslachte oder beleidigte. Das Problem unserer Menschheit war, dass viele Menschen anfingen, einen zu verurteilen, wenn man anders war. Wenn sich ein depressiver Mensch umbrachte und es in den Medien gezeigt wurde, waren alle auf einmal total betroffen, um zwei Wochen später wieder eine Person aus der Schule zu mobben. Ich hatte das Gefühl, dass genau diesen Menschen die Menschlichkeit fehlte … und ein Gehirn sowieso.
Ich wusste nicht, wie viele Minuten vergangen waren, als Frau Graves, ohne zu klopfen, in mein Zimmer trat und ich mich erschrocken aufrichtete.
»Frau Dr. Henderson empfängt dich jetzt«, sagte sie und bedeutete mir, ihr zu folgen.
Schnell fuhr ich mit den Händen über meine Haare, um die Wellen halbwegs zu bändigen, und folgte ihr durch den Flur. Ihren schnellen Schritten nach zu urteilen, hatte sie es ziemlich eilig, mich loszuwerden, und das leise Gemurmel aus den anderen Zimmern ließ mich auch vermuten, weshalb. Der Gedanke daran, dass ich bald die anderen Patienten kennenlernen würde, machte mich nervös. Was wäre, wenn sie mich auch nicht mögen würden? Wenn sie mich verachteten oder mich nicht ernst nähmen?
Als wir neben einer Treppe stehen blieben, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte, schaute mich Frau Graves auffordernd an. »Den Weg nach oben findest du, denke ich, allein.«
Ich glaubte, ich würde nie mit ihr sympathisieren. Diese Frau war zutiefst unfreundlich und falsch. Am liebsten wollte ich ihr sagen, dass ich mich freute, dass sie mir so viel zutraute, und ob sie auch glaubte, dass ich alleine atmen könne, doch ich ließ den Mund geschlossen. Mit einem rasend schnellen Herzschlag, der mich daran glauben ließ, dass ich gleich wie ein gestrandeter Pottwal auf diesem Boden landen würde, ging ich die schmale Treppe hinauf und hielt mich stärker am Geländer fest, als nötig gewesen wäre, doch ich hatte das Gefühl, würde ich loslassen, könnte ich meine Beine nicht mehr spüren. Ich wusste nicht, was auf mich zukommen würde, und ich hatte keinerlei Ahnung, welche Fragen mir diese Frau Dr. Henderson stellen würde. Ich wusste nicht, ob sie genauso unfreundlich war wie Frau Graves, und ich wusste nicht, ob ich ihr das sagen konnte, was sie von mir verlangte. Sie würde mich nicht verurteilen, zumindest würde sie mir das nicht zeigen, schließlich war es ihr Job, dass es mir irgendwann besser ging. Aber nur, weil sie es mir nicht zeigte, hieß das nicht, dass sie es nicht tat. Mein Gott, eigentlich hätte es mir egal sein können, was andere Leute von mir dachten. Aber egal, wie sehr ich mir einredete, dass es irrelevant wäre, ich konnte mich selber nicht davon überzeugen. Ich hatte fürchterliche Angst, was sie sagen könnte oder ob sie mir eine Frage stellen würde, die mich zum Heulen bringen könnte. Viel zu schlimm war die Vorstellung, vor jemandem in Tränen auszubrechen. Stufe für Stufe machte ich mich verrückter, und als ich auf der vorletzten angekommen war, hatte ich das Gefühl, vor Furcht zu explodieren. Vielleicht wäre das gar nicht so schlimm gewesen, schließlich hatte ich eine Sekunde lang bereits die Idee verfolgt, mich hier und jetzt tot zu stellen.
Als ich oben ankam und vor einer schlichten Tür stand, holte ich einmal tief Luft. Egal, was mich da nun erwartete, ich musste mich dem stellen. Es konnte unmöglich schlimmer sein, als die ganzen Jahre in der Schule zwischen Mobbern zu sitzen. Als ich letztendlich das Gesicht meiner Mutter vor Augen hatte, schloss ich traurig die Augen und klopfte.
Wenige Sekunden später stand eine große, schlanke Frau mit Brille auf der Nase vor mir und lächelte mich warmherzig an. »Hallo, Faye, ich bin Frau Dr. Henderson, deine Psychiaterin.«
Dass sie ihren Beruf nicht umschrieb, erweckte direkt den Eindruck, dass sie wahnsinnig authentisch sei, und das gefiel mir. Andere Psychiater würden wohl versuchen, unsere Session als »ungezwungene Unterhaltung« zu umschreiben, sie hingegen verzichtete auf diese hirnrissigen Ausschweifungen. Freudestrahlend reichte sie mir die Hand, und als ich ihre nahm, bröckelte ein Stück meiner Unsicherheit von mir ab.
»Komm doch herein«, sagte sie, bevor ich auch nur ein Wort erwidern konnte, und zeigte auf zwei Stühle, die gegenüber einem kleinen Tisch mit Blumen standen.
Nervös knetete ich die Hände und schaute sie fragend an. »Wo darf ich mich setzen?«, brachte ich heraus. Ich wollte nicht unhöflich sein und mich irgendwohin schmeißen, um dann einen Spruch wie »Entschuldige, aber das ist mein Stuhl« zu kassieren. Es war nicht an der Zeit, mir eine Bloßstellung zuzumuten. Außerdem lagen mir die von meiner Mutter eingetrichterten Höflichkeitsformen sehr am Herzen.
»Wo du gerne möchtest«, antwortete Frau Dr. Henderson noch immer mit einem Lächeln auf den Lippen, und als ich mich für die linke Seite entschieden hatte, nahm auch sie auf dem übrig gebliebenen Stuhl Platz. Als ich ihren Block und den schwarzen Kugelschreiber in ihren Händen sah, richtete ich meinen Blick auf meine ineinander verschlungenen Hände, die auf den Oberschenkeln ruhten. Sie würde sich jedes Wort, jeden meiner Gedanken aufschreiben und gegen mich verwenden können, wann immer ihr danach war. Dieser Gedanke ließ meinen gesamten Körper erschaudern, und die Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen rasant aus, sodass ich inständig hoffte, sie würde nicht auf meine frei liegenden Handgelenke starren.
»Faye ist ein außergewöhnlicher Name, was bedeutet er?«, fragte sie plötzlich neugierig in die Stille, und erstaunt schaute ich ihr in die hellbraunen Augen. Das war ungefähr die letzte Frage, die ich erwartet hätte. Vielmehr dachte ich, sie würde mich direkt ausquetschen wie einen nassen Schwamm und alles aus mir herauskitzeln, was mich schwach machte.
»Soweit ich weiß, liegt der Ursprung in dem Wort ‚faie‘, das im Altenglischen ‚Fee‘ bedeutet«, antwortete ich und musste dabei vollkommen verwirrt ausgesehen haben, doch sie ließ sich von meinem Gesichtsausdruck nicht beirren und stellte weiterhin Fragen, die ich nie erwartet hätte zu hören.
»Bist du ein Fan von Geschichten über Fabelwesen, oder ist das so gar nicht deins?«
Stirnrunzelnd schaute ich in ihre Augen und versuchte zu ergründen, ob sie mich auf den Arm nahm. Sie sah interessiert aus und gleichzeitig wachsam wie ein Adler, der eine Maus im Visier hatte.
Ich sprach langsam und versuchte, ihre Gesichtszüge zu deuten, doch alles, was ich in ihren Augen sah, war die bloße Neugier. »Ich lese gerne Fantasieromane, allerdings nicht unbedingt gern über Feen. Mein Lieblingsthema sind Vampire.«
»Feen sind doch meistens die Lieben und Vampire die Bösen. Magst du lieber düstere Geschichten?«, fragte sie weiter und schaute mich weiterhin gespannt an.
»In den Büchern, die ich lese, sind die Vampire überwiegend gut oder stellen sich gegen ihre böse Seite, weil sie gut sein wollen«, erwiderte ich schulterzuckend.
»Glaubst du, böse Menschen können gut werden, Faye?« Und sofort machte es in meinem Kopf klick. Diese ganzen Fragen waren gewählt gestellt worden, um Dinge über meine Einstellung, über meine Persönlichkeit herauszufinden. Sofort versuchte ich, meine Mauer wiederaufzubauen, ohne sonderlich unhöflich zu wirken.
»Das kommt darauf an, ob diese Menschen das auch wollen.« Meine Stimme war nun deutlich distanzierter und obendrein noch tonlos, sodass Frau Dr. Henderson rasant ihren Stift zückte. Ich wusste sofort: Dieser Frau würde nichts entgehen, und diese Tatsache machte mich zunehmend nervöser.
»Kennst du böse Menschen? Haben sie sich geändert oder wenigstens bemüht?«, fragte sie und schrieb etwas auf ihr Papier.
Ich spürte den Drang, ihr den Block aus der Hand zu reißen und zu lesen, was sie daraufgekritzelt hatte. Am liebsten hätte ich ihn zerrissen und aus dem Fenster geschmissen, so bloßgestellt fühlte ich mich in diesem Moment. Ich wollte ihr nichts von mir erzählen, ich wollte nicht diese Art von Gespräch führen, doch durch meine Naivität war ich nun mittendrin.
»Das kommt darauf an, wie man böse definiert«, wich ich ihrer Frage aus und begann erneut, meine Hände zu kneten.
Kurz beobachtete sie meine Gestik und sah mir dann wieder in die Augen. »Wurdest du schon mal schlecht behandelt, Faye?«
Frau Dr. Henderson schaute mich abwartend an und lächelte ermutigend, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich wusste, dass sie professionell war, und ich wusste auch, dass sie Verständnis für mich heucheln würde, egal was ich ihr auftischte, aber ich wusste nicht, was sie denken würde. Ich wusste nicht, ob sie mich verurteilte oder nicht, und das machte mir Angst. Auch wenn sie bisher auf mich wahnsinnig lieb wirkte, konnte ich mich getäuscht haben. Wer wusste schon, wie gut sie schauspielern konnte! Ich kratzte mir den Hinterkopf und schaute dann auf meine ineinander verschlungenen Finger. »Ja.«
»Magst du davon erzählen?«, fragte sie nach wenigen Sekunden, und ich schüttelte wie mechanisch den Kopf. Sie kann mich nicht zwingen, sie kann mich nicht zwingen.
»In Ordnung, ich möchte dich auch an deinem Anreisetag nicht mit so fiesen Fragen quälen«, erwiderte sie empathisch, stand auf und legte ihren Block und den Stift auf ihren Schreibtisch auf der anderen Seite des Raumes. Dann hielt sie mir ihre Hand hin, und ich stand auf. »Ich hoffe, du hast hier eine gute Zeit. Wir sehen uns morgen wieder.«
Ich lächelte sie zerknirscht an, nahm ihre Hand entgegen und verließ ohne ein weiteres Wort den Raum. Mein Kopf glühte, und mir war zum Einrollen und Schlafen zumute; und doch musste ich mir eingestehen, dass ich mir die Prozedur wesentlich schlimmer vorgestellt hatte. Klar hatte sie mich in gewisser Weise ausgetrickst, indem sie von einem scheinbar belanglosen Thema zu meinen tiefsten Ängsten gewechselt hatte, doch sie hatte mir in keiner Sekunde das Gefühl gegeben, mich drängen zu wollen oder mich zu verurteilen. Und ich war der Überzeugung, dass das schon sehr viel wert sei.
Als ich in meinem Zimmer ankam, konnte ich nebenan weibliche Stimmen hören und setzte mich im Schneidersitz aufs Bett in der Hoffnung, sie würden nicht auf mich aufmerksam werden und mich besuchen kommen. Nach wenigen Minuten verstummten die Stimmen, und ich hielt die Luft an. Hatten sie mich gehört? Eigentlich war das unmöglich, es sei denn, mein Atem wäre so laut wie das Schnarchen meines Opas. Doch wenige Sekunden nach diesem Gedanken klopfte es an der Tür, und ich sprang wie von einer Tarantel gestochen auf. Schnell richtete ich mein Oberteil und versuchte, meine Nervosität hin unterzuschlucken. »Ja?«, fragte ich mit heiserer Stimme, und die Tür öffnete sich. Eine Frau, ebenso wie Frau Graves und Frau Dr. Henderson mittleren Alters, stolzierte in mein Zimmer, und noch bevor ich ihr zur Begrüßung meine Hand ausstrecken konnte, hatte sie mich schon in die Arme geschlossen. Sofort ließ sie mich wieder los und strahlte mich an.
»Herzlich willkommen, Faye! Ich bin Frau Benett, deine zweite Betreuerin. Fühl dich bitte frei, mir Fragen zu stellen, solltest du Probleme haben.«
Völlig perplex schaute ich sie an und konnte nicht fassen, wie viele unterschiedliche Charaktere hier tätig waren. »Danke«, brachte ich heraus und schenkte ihr ein kurzes Lächeln. Auch sie strahlte mich an, und ich sah sofort, dass es echt war, ganz anders als das von Frau Graves. Ihre langen dunklen Haare hatte sie zu einem Zopf geflochten, und ihre kleine Nase zuckte vor Vergnügen, als sie mich betrachtete. Diese Frau hatte wohl mehr Lebensfreude als die gesamte Klinik zusammen.
»Kommst du direkt mit mir mit? Wir haben jetzt wie jeden Tag ein Gruppentreffen. Den Tagesablaufplan der nächsten Monate werde ich dir während des Abendessens in dein Zimmer legen«, sagte sie fröhlich und legte einen Arm um meine Schulter, um mich aus dem Raum zu führen. Nun war es tatsächlich so weit: Ich musste die anderen Patienten kennenlernen. Unmut machte sich in mir breit, und ich hatte das Gefühl, dass ich kaum laufen konnte, so sehr zitterte ich. Frau Benett schien meine Aufregung gar nicht zu bemerken, sie ging mit mir schnurstracks in den großen Raum neben der Treppe zu Frau Dr. Hendersons Büro. Als sie die Tür öffnete, waren alle Augenpaare auf mich gerichtet, sodass ich mich kaum auf die restlichen Eindrücke dieses Zimmers konzentrieren konnte. Ich stellte mir in dieser Sekunde Tausende Fragen. Hatte ich meinen Pulli vernünftig angezogen? War mein Hosenstall zu? Hatte ich einen Fussel in den Haaren? Stand ich dort wie ein Volldepp, der vor wenigen Minuten Drogen genommen hatte? Hielten sie mich für eingebildet, wenn ich mich aufrechter hinstellte? Hielten sie mich für das klassische Opfer, wenn ich so eingesunken stehen blieb? Hatte ich etwas zwischen den Zähnen? Was war, wenn ich etwas zwischen den Zähnen hatte und lächeln würde? Was geschähe, wenn ich jetzt nicht lächeln würde? Würden sie denken, ich hätte keine Lust, sie alle kennenzulernen?
»Wir haben eine neue Freundin«, sagte Frau Benett, als hätte sie den anderen eine Millionen Euro mitgebracht, und katapultierte mich somit aus meinen Gedanken. Dann wandte sie sich mir zu und schaute mich mit ihrem grotesk breiten Lächeln an. »Magst du dich vorstellen?«
Im ersten Moment starrte ich sie völlig verdattert an. Freundin? Bitte was? Augenblicklich musste ich mich ein weiteres Mal fragen, ob wir hier in einer Klinik oder einem Kindergarten waren.
Dann wurde ich von den erwartungsvollen Blicken der anderen daran erinnert, dass ich nun an der Reihe war, mich vorzustellen. Schon vor mehreren Tagen hatte ich mir die perfekten, humorvollen Sätze zurechtgelegt, hatte sie auswendig gelernt, weil ich wusste, dass ich, sobald ich angestarrt wurde, sogar vergaß, ob ich männlich oder weiblich war. Dann wurde schnell aus »Schönen guten Tag, ich bin die Faye« ein »Tschüss, hallo, mein Name sein, ich meine, heißt Faye«. Nicht zu vergessen mein unfassbar extremer Stottermarathon, der bis zum Punkt meines Satzes quasi jeden Buchstaben undeutlich machte. Also schob ich meine auswendig gelernten Sätze beiseite und sprach die Dinge aus, die ich beinah unmöglich falsch sagen konnte. »Ich bin Faye Allington und 17 Jahre alt.«
»Und du bist gestört«, ergänzte eine dunkle und zugleich weiche Stimme; und als ich in die Richtung blickte, schaute ich in honigbraune Augen, die mich musterten. »So wie wir alle.« Schockiert starrte ich den jungen Mann an und fragte mich, ob er das wirklich ernst meinte oder ob ich mich verhört hatte.
»Cailan!«, schimpfte Frau Benett empört.
Dieser zuckte nur mit den Schultern und sah mich noch immer unverwandt mit einem intensiven Gesichtsausdruck an. Schwarze Strähnen hingen ihm ein wenig in die Augen, und er strich sie sich mit einer schnellen Bewegung aus dem Gesicht. Er war wunderschön, keine Frage, auf eine besondere Art und Weise, und trotzdem war er mir direkt unsympathisch. Menschen mit so einem Gesicht glaubten wohl immer, sie wären etwas Besseres.
Nach Sekunden des peinlichen Schweigens klatschte unsere Betreuerin munter in die Hände. »Nun gut, Faye, setz dich doch bitte neben Cailan auf den freien Platz. Ich würde vorschlagen, wir machen eine stille Runde. Wer mag denn Faye verraten, was damit gemeint ist?«, fragte sie und ließ sich ihre Verärgerung über Cailans Aussage nicht anmerken.
Widerstrebend ließ ich mich auf den Platz neben diesem unfreundlichen Typen nieder und redete mir ein, dass mich sein Geruch nicht zum Schwärmen brächte. Ein blondes Mädchen mit strahlend blauen Augen meldete sich eifrig, und als Frau Benett ihr ermunternd zunickte, blickte sie lächelnd zu mir. »In der stillen Runde darf sich jeder einen Partner suchen, mit dem er über seine momentanen Gedanken und Gefühle sprechen kann.« Ihre Stimme war so herzerwärmend sanft und ruhig, dass ich sie am liebsten sofort umarmt hätte. Die Worte, die aus ihrem Mund kamen, ließen mich jedoch erschaudern. Ich hatte weder das Bedürfnis, mit meiner Psychiaterin darüber zu sprechen, noch mit einen der Patienten hier.
»Äh, Frau Benett, wo ist denn Harry?«, fragte Cailan sofort an die Betreuerin gewandt, bevor ich mich überhaupt für die Erklärung des blonden Mädchens bedanken konnte.
»Harry ist noch in einem Gespräch mit Frau Dr. Henderson, aber das passt hervorragend, denn jeder hat somit einen Partner.« Die Meinung, dass das hervorragend passe, schien Cailan nicht zu teilen, denn er verzog das Gesicht und sah aus, als hätte man ihm gerade verkündet, dass man seinen Lieblingspudding aufgegessen hatte. Als die anderen sich einander zuwandten und leise redeten, fühlte ich mich vollkommen unwohl und rückte auf meinem Stuhl hin und her. War ja klar, dass ausgerechnet ich das Glück hatte, mit dem unsympathischen Kerl reden zu müssen. Zugegebenermaßen interessierte es mich schon, was er dachte und fühlte, einfach weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das auch nur ansatzweise mit meinen Empfindungen übereinstimmte. Aber der Gedanke daran, dass ich das Gleiche tun musste, brachte mich vor Aufregung beinah zum Übergeben. Ich musterte ihn verstohlen von der Seite und staunte nicht schlecht über die Figur, die sich unter seinem Pullover leicht abzeichnete. Der Kerl war wohl schon öfter einmal im Fitnessstudio unterwegs, wenn er nicht gerade in einem sterilen Gebäude gefangen war. Obwohl ich ihn noch nicht stehen gesehen hatte, war mir klar, dass er viel größer war als ich, und seine gesamte Präsenz machte deutlich, dass er das Selbstbewusstsein in Person sein musste. Gleichzeitig fragte ich mich jedoch, wieso er dann an diesem Ort sein mochte. Irgendetwas stimmte an der gesamten Fassade nicht.
Cailan schaute mich aus den Augenwinkeln an und verschränkte die Arme. »Na, dann fang mal an.« Ich zuckte bei seinen Worten zusammen und fühlte mich ertappt, denn ich war mir sicher, dass ihm meine Blicke nicht entgangen waren. Er sollte bloß nicht denken, ich würde ihn interessant finden.
Ich atmete einmal tief durch und sprach den einzigen Satz aus, der für mich in diesem Moment tragbar war: »Ich habe nichts zu erzählen.«
Prompt gab er seine abweisende Haltung auf, schaute mich direkt an und zog erstaunt seine Augenbrauen in die Höhe. »Okay.« Dann löste er seine Arme voneinander, drehte sich zu mir und stützte den linken Arm auf der Lehne seines Stuhls ab. »Dann erzähl mir, wie du Frau Benett findest.« Überrascht über seinen neugierigen Tonfall, starrte ich in seine honigbraunen Augen, bevor ich den Blick ruckartig nach unten richtete. Er guckte mich an, unbarmherzig und ohne Scheu, und vermutlich hatte er in diesen wenigen Sekunden bereits mein Gesicht studiert und jeden einzelnen Makel auf seine gedankliche Liste gesetzt.
»Ich war etwas verwirrt, als sie mich Freundin genannt hat«, gab ich schließlich zu und zuckte mit den Schultern. Was hätte ich sonst sagen sollen? Ich kannte sie ja überhaupt nicht. Verstohlen linste ich zu ihr hinüber und beobachtete kurz, wie sie kleine gebastelte Schmetterlinge an die Fenster hängte und dabei peinlichst genau vorging. Ich ging davon aus, dass sie das nur tat, um uns das Gefühl zu geben, ungestört zu sein, und das hielt ich für äußerst taktvoll.
»Das ist ihre Art, Patienten zu umschreiben, damit wir uns nicht so krank fühlen. Sie merkt dabei gar nicht, dass wir uns noch bescheuerter vorkommen, wenn sie so tut, als wären wir so krank, dass man uns mit so was beruhigen könnte. Ich glaube, sie ist selber gestört«, sagte er tonlos, ohne mich auch nur einmal dabei anzusehen. Sein Blick war auf Frau Benett gerichtet, und ich hatte das Gefühl, er mochte ihre Art ganz und gar nicht. Ich hätte darauf wetten können, dass Frau Graves und er die besten Freunde waren.
»Und du findest es okay, wenn du das Gegenteil tust und uns alle als gestört titulierst?«, fragte ich stirnrunzelnd und sah ihm ins Gesicht. Das war wirklich nicht böse gemeint. Ich war tatsächlich neugierig, warum er so abwertend über uns und sich selber sprach. Kurz starrte er mich genervt an, dann drehte er sich von mir weg und verschränkte wieder die Arme, als hätte es diesen kleinen Moment des Interesses nie gegeben. Ich beschloss, ihn als merkwürdig abzustempeln, und ließ das Gefühl der Zurückweisung nicht zu. Zumindest redete ich mir das felsenfest ein. Menschen wie ihm war ich schon oft begegnet, und genau diese Art von Mensch wollte ich strikt meiden, denn sie würden dafür sorgen, dass ich mich nur noch wertloser fühlte.
Während die anderen sich noch leise unterhielten, nutzte ich die Gelegenheit und schaute mich um. Viele der Patienten sahen recht zufrieden aus, während sie sich einander anvertrauten, als hätten sie bei dem Gedanken an ihre Gefühle immer ein Lächeln parat. Diese Tatsache verwirrte mich, und ich redete mir sofort ein, dass sie alle bestimmt über etwas ganz Anderes sprächen – zum Beispiel über mich –, und die Tatsache, dass sie dabei grinsen konnten, ließ mich wieder hoffen, sie würden über ihre Gefühle lächeln.
KAPITEL 3
Nach dem Gruppentreffen hatte ich Zeit für mich, und so nahm ich meine Kopfhörer und meinen MP3-Player, den mir meine Mutter geliehen hatte, weil sie wohl schon geahnt oder gewusst hatte, dass ich kein Handy mehr als Musikgerät würde benutzen können, legte mich aufs Bett und lauschte leise den Stimmen der Band Walking on Cars. Immer wieder dachte ich darüber nach, ob dieser Kerl mit den honigbraunen Augen nur hier sei, um den anderen das Leben noch schwerer zu machen, oder ob er hinter seiner Fassade ein ganz anderer Mensch sei. Vielleicht hatte er heute nur schlechte Laune oder empfand, dass ich es verdient hätte, so behandelt zu werden. Es konnte gut sein, dass er mich als etwas abstempelte, was ich nicht war. Mein Blick hatte auf ihn vielleicht arrogant gewirkt, meine Stimme zu genervt, oder irgendetwas anderes passte ihm an mir nicht. Diese Tatsache machte mich wütend; und als ich noch zorniger wurde, weil es mich überhaupt interessierte, was dieser herablassende Typ von mir dachte, versuchte ich, mich wieder auf den Songtext meines Lieblingsliedes zu konzentrieren.
Als es plötzlich klopfte, saß ich sofort senkrecht im Bett und realisierte erst dann, dass ich eingedöst war. Sekunden später öffnete sich zaghaft die Tür, und das blonde Mädchen, das mir die stille Runde erklärt hatte, streckte unsicher den Kopf ins Zimmer. Aufmunternd lächelte ich meine Besucherin an und stand vom Bett auf. Ich hatte das Gefühl, meine Hände wären schwitzig und zitterten, doch als ich ihren schüchternen Blick sah, wurde ich mutiger. »Du kannst reinkommen.«
Sie sah so unentschlossen aus, dass ich sie am liebsten in den Arm genommen hätte. Sie schenkte mir ein Grinsen und trat tatsächlich in den Raum.
»Hallo, ich bin Lucy. Ich wollte dir sagen, dass es gleich Abendbrot in der Cafeteria gibt.« Ihre Hände hatte sie ineinandergeschlungen, und ihre kleinen Augen waren aufmerksam auf mich gerichtet, als würde sie jede Regung meines Gesichts genau deuten wollen.
»Oh, danke, dass du Bescheid sagst«, erwiderte ich vorsichtig und hoffte inständig, dass sie mich mitnähme. Ich hatte zwar schon bei dem anfänglichen Marathonlauf, den Frau Graves als Führung betitelt hatte, die Cafeteria ausmachen können, aber der Gedanke daran, allein in diesen Saal zu schreiten und keine Ahnung zu haben, wohin ich mich hätte setzen sollen, ließ mich schwitzen. Natürlich hatte ich die letzten Jahre gelernt, dass man auch als Einzelgänger im Leben weiterkam und durchaus mehr Verantwortungsbewusstsein entwickeln konnte; und doch wusste ich ganz genau, dass niemand gern jederzeit alleine war. Jeder brauchte mal jemanden, an den er sich hängen konnte, damit er nicht vor Aufregung durchdrehte. Es war durchaus gut, wenn man auch allein durch das Leben kam, aber besser war es, wenn man das nicht musste.
»Möchtest du mitkommen? Wir könnten zusammengehen«, schlug sie vor, und abermals hätte ich sie am liebsten in die Arme geschlossen. Ich wusste in diesem Moment nicht, ob ich sie gefragt hätte, wenn sie nicht selbst die Initiative ergriffen hätte. Vermutlich hätte ich sie einfach ziehen lassen und wäre mit einem halben Kreislaufkollaps alleine in die Cafeteria marschiert. Das hätte mir ähnlichgesehen; schließlich würde ich nicht mal um Hilfe bitten, wenn mir zehn Hyänen in den Hintern beißen würden.
Hastig nickte ich, und so trotteten wir ohne ein weiteres Wort nebeneinanderher. War es unhöflich, sie nicht irgendetwas zu fragen, zumal sie mich doch schon netterweise aus meinem Zimmer geholt hatte? Aber was sollte ich sie schon fragen? Die Frage zu stellen, warum sie hier sei, erschien mir als hirnlos und taktlos zugleich. Sie würde wohl kaum »Weil ich überglücklich bin« antworten und mir als einer ihr völlig fremden Person sicherlich auch nicht ihre gesamte Lebensgeschichte auf die Nase binden wollen. Aber außer diese ätzenden Small-Talk-Fragen, die ich nicht mal stellen würde, wenn ich darum gebeten werden würde, fielen mir keine angebrachten Fragen ein, also schwieg ich einfach.
Zu meinem Erstaunen stand die große Tür, die uns von den anderen Abteilungen trennte, offen, und so gingen wir gemeinsam die große Treppe hinunter. Als wir unten ankamen und in die große Cafeteria gingen, wurde mir erst bewusst, dass alle Gruppen gemeinsam aßen. Schon oft hatte ich Szenen in Filmen gesehen, in denen sich alle in einer Schulkantine zu einer Person umgedreht hatten und diese in Zeitlupe und mit Wind in den Haaren durch den Raum marschierte. Erstens war das hier ein verdammtes Gefängnis. Wenn hier jemals Wind durch meine Haare fegte, dann nur, weil einer extreme Blähungen hatte und vor mir stand. Zweitens war ich kein supertolles und hübsches Mädchen, das jeder bewundert hätte. Ich hatte das Gefühl, alle starrten mich an und versuchten zu ergründen, weshalb ich hier sei, welches Problem ich mit mir herumtrüge und was ich erlebt hätte. Es war, als würden sie meine Seele abscannen wollen. Mein Herz pochte wie immer zu schnell. Nur Lucys beruhigende Aura neben mir ließ mich nicht den Raum verlassen. Und ganz ehrlich: Für wie bescheuert würden mich alle halten, hätte ich diesen Raum fluchtartig verlassen? Sie führte mich zu einem kleinen Tisch, an dem ein Mädchen saß, das ich im Gruppenraum neben Lucy hatte sitzen sehen. Lächelnd begrüßte diese mich und streckte mir die Hand entgegen.
»Hallo, ich bin Melanie.« Sofort schüttelte ich ihre Hand sanft und nahm neben Lucy Platz.
»Faye.«
»Das ist ein echt cooler Name«, kommentierte Melanie hochachtungsvoll und nahm sich ein Stück Vollkornbrot aus einer der Brotkörbe. Ihre Haare waren kurz geschnitten und auf der einen Seite komplett abrasiert. Ihre Lippen schmückten zwei Piercings, und irgendwie stand ihr das ausgesprochen gut. Ihre Kleidung war ausgefallen, an manchen Stellen am Bein blitzte ihre helle Haut durch die Löcher ihrer Strumpfhose, und ihr Nietengürtel saß so tief auf ihren Hüften, dass er auf dem Stuhl ratschte, wann immer sie sich bewegte. Sie wirkte authentisch und sympathisch, und ich glaubte, sie genauso mögen zu können, wie ich bereits Lucy mochte.
»Danke«, erwiderte ich schüchtern und schaute auf meinen Teller. Ich dachte an meine Zeit in der Schule zurück. Immer war ich diejenige gewesen, die alleine in einer der hintersten Ecke der Mensa gesessen und sich ihren Toast hineingestopft hatte, ohne dabei auch nur einmal aufzuschauen – und das, weil ich ganz genau wusste, welche Blicke mich erwartet hätten, hätte ich meinen Blick gehoben. Es hatte ihnen allen einen Heidenspaß gemacht, mich von den anderen Tischen aus zu belächeln. Manchmal hatte ich das Gefühl gehabt, ich hätte ihnen damit einen Zeitvertreib in den Pausen gegeben. Weil ich nie meinen Mund aufgemacht hatte, war ihnen vielleicht gar nicht bewusst gewesen, wie sehr das einen Menschen verletzen konnte, wenn sich die halbe Schule über ihn lustig machte, obwohl er ohnehin allein war. Diesen Gedanken hatte ich allerdings nach wenigen Monaten beiseitegeschoben, denn ich hatte mir beim besten Willen nicht vorstellen können, dass ein Lebewesen so beschränkt sein und nicht wissen konnte, dass dieses Verhalten verletzend war. Dafür brauchte man nun wirklich kein Einfühlungsvermögen. Ein Gehirn wäre allerdings von Vorteil, und da ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand mit Verstand jemanden fertigmachte, der sich nicht einmal wehrte, glaubte ich zu wissen, dass ihnen genau das fehlte. Sie lachten zwar alle über mich, aber im Endeffekt waren sie diejenigen, die zu bedauern waren.
»Das Essen ist dazu da, es zu essen, und nicht, um es anzustarren, bis es sich bewegt«, sagte Melanie plötzlich, und als ich aufblickte, grinste sie mich an – doch nicht auf die spöttische Art und Weise, eher so, als wollte sie bewirken, dass ich lockerer wurde. Der Kontrast meiner letzten Gedanken zu dieser Situation war so extrem, dass ich nicht anders konnte, als für einen kurzen Augenblick innerlich aufzublühen.
»Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis sich hier das Essen bewegt. Das Brot ist steinhart«, kommentierte Lucy lachend; und als wäre es das Einfachste der Welt, stimmte ich sofort mit ein. In dem Moment schaute ich an Melanie vorbei und begegnete einem Paar honigbrauner Augen, die mich neugierig musterten. Sofort hörte ich auf zu lachen und nahm mir wie beiläufig ein Brot aus dem Brotkorb. Warum starrte der Kerl mich so an? Suchte er nach Fehlern, worüber er sich direkt beim nächsten Gruppentreffen lustig machen konnte? War er der Typ Mensch, der ähnlich wie meine Mitschüler in der Mensa waren, die mich immer verachtend beobachtet hatten? Zugegebenermaßen sah sein Blick nicht abwertend oder spöttisch aus, sondern einfach nur interessiert und abschätzend, so, als könnte er mich und mein Verhalten nicht einschätzen.
Verwirrt über meine plötzlichen Stimmungsschwankungen, wandte sich Melanie um, um meinen Blick zu folgen, und als sie mich wieder ansah, zog sie die Augenbrauen zusammen. »Lass dich von Cailan nicht einschüchtern! Der mag sich im Grunde am wenigsten. Um das zu vertuschen, tut er so, als würde er jeden von uns verachten.«
Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er unzufrieden mit sich sein sollte. »Ich weiß nicht, ob er mir leidtun soll oder ob ich wütend darüber sein soll, dass er andere Leute darunter leiden lässt, dass er so unzufrieden mit sich ist«, murmelte ich aus Angst, er könnte mich vielleicht hören. Völlig unberechtigt, denn wenn er mich wirklich verstehen könnte, hätte ich mir Gedanken machen müssen, ob er aus einem meiner Vampirromane entsprungen sei.
Melanie schaute mich mit ihren schwarz umrandeten, braunen Augen an und legte dann ihr Brot beiseite. »Hör zu, Faye: Wenn du hier schnell wieder rauswillst, dann solltest du dich von allem fernhalten, was dich runterziehen könnte; und Cailan ist definitiv jemand, der dir das Gefühl geben kann, ein Haufen Scheiße zu sein.«
Sie glaubte doch nicht ernsthaft, dass ich vorhätte, mit ihm abzuhängen, nachdem ich bemerkt hatte, was er für ein Vollidiot war? Keiner konnte hier so dumm sein und sich mit jemandem freiwillig abgeben, der den Menschen ähnelte, derentwegen wir hier überhaupt festsaßen.
Ich nickte bloß und richtete den Blick abermals auf Cailan. Er saß neben vier anderen Jungen, die mit dem Essen herumblödelten. Er selbst saß nur mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl und beobachtete mich mit einer Intensität, die Melanies Aussage direkt untermauerte. Warum starrte er mich so an? Was hatte ich ihm getan? Es war wirklich so, als wäre er nur hier, um mein Leben noch mehr zur Hölle zu machen. Dieser Blick schüchterte mich ein, und ich war mir dessen bewusst, dass er genau das auch damit bezwecken wollte; doch aus welchem Grund, blieb mir schleierhaft. Nun gut, ganz ehrlich: Welchen Grund hatten schon Mobber an Schulen, andere Menschen zu beleidigen, außer den, ihre eigenen Schwächen zu kompensieren und sich mal so richtig stark zu fühlen?

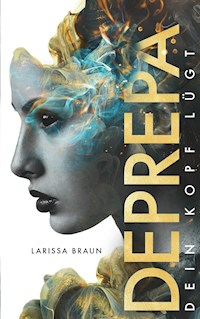













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













