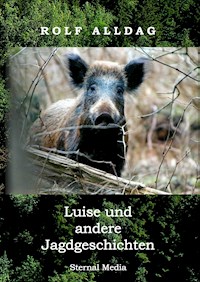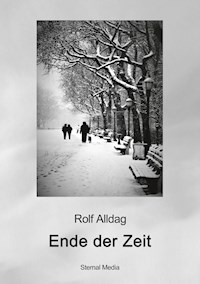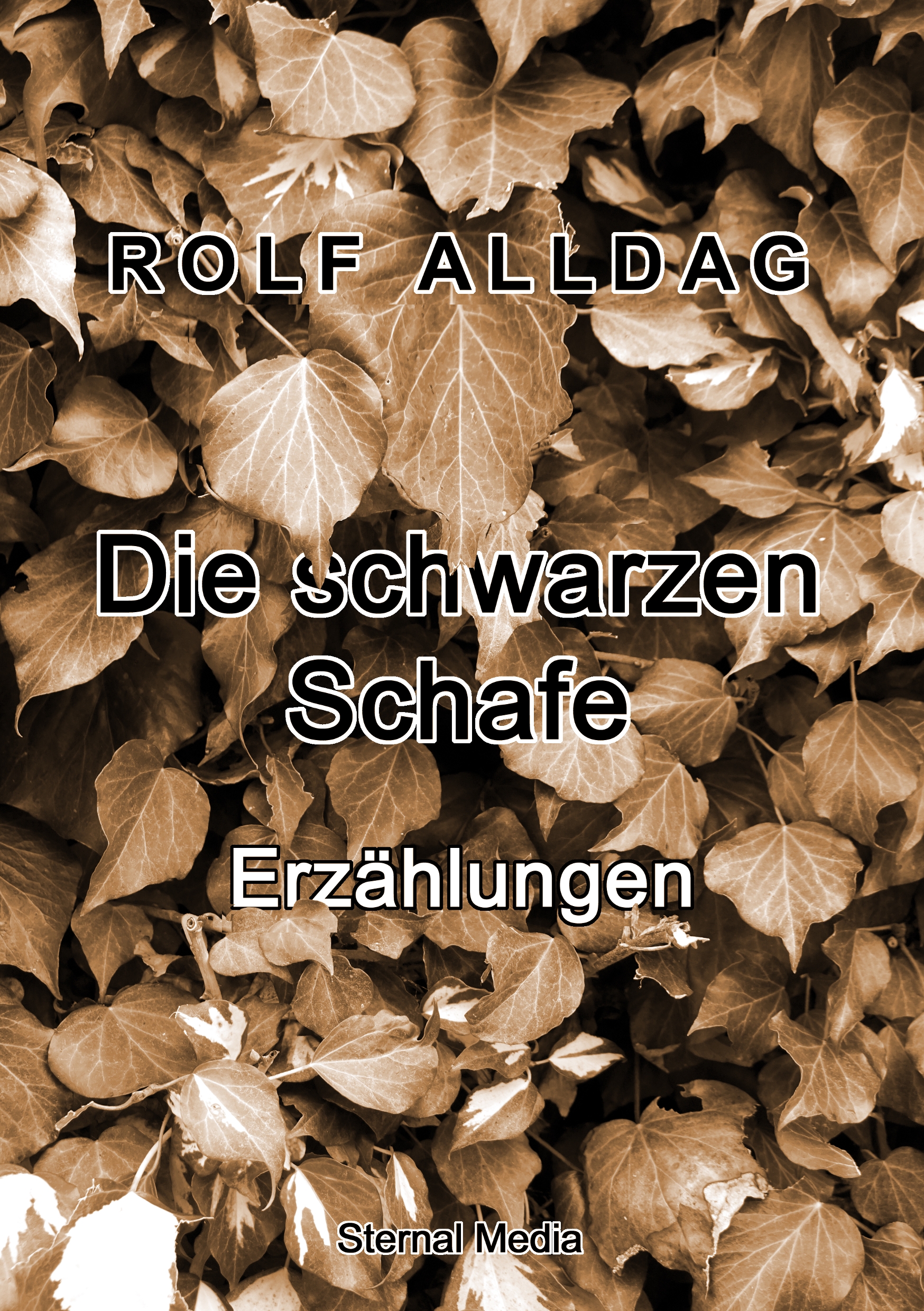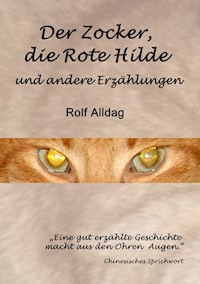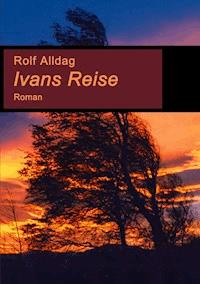
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wohl erstmals in der neueren Literatur beschäftigt sich ein deutscher Autor mit den Erlebnissen eines im Zweiten Weltkrieg aus Russland nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeiters. Der Autor (Jahrgang 1938) beschreibt eine fast wahre Lebensgeschichte in einem spannenden, nicht loslassenden Roman. Der 16-jährige Ivan erfährt die deutsche Besetzung 1941, kommt durch seine ehemaligen Schulkamera-den schnell mit Partisanengruppen in Berührung und erlebt auf seiner Reise als Zwangsarbeiter durch halb Europa, von Kursk über Mitteldeutschland bis in eine deutsche Großstadt den Krieg auf seine Weise. Seine erste Liebe kommt bei einem Überfall ums Leben, die keimende Zuneigung zu einer Bäuerin, deren Mann in Stalingrad kämpft, wird von der Abberufung zu seinem Arbeitseinsatz in eine Munitionsfabrik erstickt. Nach Ende des Krieges bleibt Ivan in Deutschland, geht eine lustvolle Beziehung ein, scheitert aber damit - der kulturelle Gegensatz und das Heimweh sind zu groß. Seit seiner Zwangsrekrutierung begleitet ihn ein Papier, das ihm die deutscherseits amtlich bestätigte Rückkehr nach Hause, in sein Dorf, verheißt. Wird der Traum der Rückreise wahr? Intensiv, detailgenau und ohne Brutalität schildert der Autor die Lebensgeschichte eines einzelnen Zwangsarbeiters und setzt ihm damit ein literarisches Denkmal - stellvertretend für viele Leidensgenossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sternal Media
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. Kapitel
An der Grenze Russlands zur Ukraine liegt das kleine, etwa 300 Einwohner zählende, unbedeutende Dorf Schewerniwo, zwanzig Kilometer von der großen Stadt Kursk entfernt. In einem Holzhaus, ganz am Ende des Dorfes, lebt die Familie Skorochodow. Ivan, der jüngste Sohn der Familie, erwacht in seiner Kammer, als das trübe Morgenlicht durch das über seinem Bett liegende Fenster scheint. Im Haus, gleich neben der Kammer, herrscht schon geschäftiges Treiben. Er hört die Geräusche aus dem Nachbarraum und weiß, dass die Mutter dort mit ihren täglichen Arbeiten bereits begonnen hat. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen, bleibt er noch verschlafen und sinnend auf dem Bett liegen.
In der vergangenen Nacht hat es im Dorf zum ersten Mal in diesem beginnenden Winter geschneit. Es war noch kein landesüblicher, starker, dichter Schneefall, doch damit hat sich der kommende erste Kriegswinter 1941 in diesem Teil Russlands angekündigt. Mit dem Winter wird nun eine Zeit kommen, die so schwer auf die noch ahnungslosen Bewohner lasten wird, wie es sich noch niemand in den niedrigen, kleinen Holzhäusern an diesem trüben Tag vorstellen kann. Die wenigen Fahrzeuge, wenn es in diesen Zeiten im Dorf überhaupt noch welche gibt, werden tiefe Furchen in den noch nicht festgefrorenen Boden der unbefestigten Dorfstraße ziehen. Die kurze Übergangszeit, zwischen dem Ende des Herbstes und dem Beginn des Winters, ist die alljährlich wiederkehrende Schlammperiode. Bis auf die befestigte Hauptstraße, die am Rand des Dorfes verläuft, sind die Wege und Nebenstraßen in dieser Zeit für schwere Fahrzeuge unpassierbar. Der Schlamm ist so zäh, dass Räder und Füße nur schwer wieder aus der scheinbar grundlosen Masse zu befreien sind.
Die Dorfbewohner sind an diese Verhältnisse seit undenklichen Zeiten gewöhnt und so bedeutet die Periode für sie kein besonderes Problem. Der wenige Verkehr in dem kleinen Dorf, im Oblast Kursk, unmittelbar bei der großen Stadt, ist nun völlig eingestellt. Schneefall Ende Oktober ist nicht ungewöhnlich, in manchen Jahren fällt er bereits am Monatsanfang, manchmal sogar noch früher.
Die noch dünne Schneedecke liegt auf der einzigen, nun schlammigen Dorfstraße, den wenigen kahlen Bäumen und Sträuchern und in den Vorgärten der Holzhäuser, die erhöht links und rechts die Straße säumen. Von den Häusern führen in die Erde gegrabene Stufen zur Dorfstraße hinab. Auf den blanken, geneigten Blechdächern der Häuser ist der Schnee teilweise schon wieder getaut, das Wasser tropft herunter und so glänzen die Bleche wie frisch gewaschen. Nur auf einigen anderen, rostigen Blechdächern liegt noch der Schnee und taut langsam. Wo die hölzernen Läden schon geöffnet sind, blinkt das Licht des aufgehenden Tages in die blankgeputzten Glasscheiben der Fenster.
Alles liegt noch friedlich da, doch das Jahr, wie es gerade abzulaufen beginnt, wird nicht nur den Bewohnern von Schewerniwo viel Grauen und Elend für die Zukunft bringen. An der einen Straßenseite stehen in regelmäßigem Abstand windschiefe Holzmasten in einer langen Reihe. Sie führen zwei tief durchhängende Stromleitungen und ein Telefonkabel, die bis zur entfernten Stadt reichen. Die Leitungen versorgen das Dorf und die zum Dorf gehörende Kolchose mit Elektrizität sowie den nun nicht mehr residierenden Dorfsowjet mit Nachrichten aus der Stadt am Telefon. Krähen haben sich auf die Mastspitzen gesetzt und schicken ihren krächzenden Ruf über das noch ruhende Land. Ab und zu erheben sich einzelne von ihnen und fliegen mit schwerem Flügelschlag über das Dorf. Ihr schwarzes Gefieder glänzt im ersten Tageslicht. Über den Dächern, aus den Schornsteinen der Häuser, stehen kerzengerade weiße Rauchfahnen in der windstillen Luft und kündigen an, dass die Bewohner der Häuser sich auf den neuen Tag vorbereiten.
Das Haus der Familie Skorochodow – Ivans Familie - liegt ganz am Ende einer Reihe von kleinen, massiven Holzhäuser mit bunt bemalten Fensterläden und reich geschnitzten Giebeln und ist, wie auch die anderen Häuser, mit einem Holzzaun umgeben. Hier am letzten Haus macht die Straße einen scharfen Bogen in westliche Richtung und führt nun dicht am trübe dahin fließenden Seim entlang. Dieser lässt seine schweren, dunklen Wassermassen nach Westen rauschen, vereinigt sich schließlich mit der Desna, um dann mit dem Dnjepr auf verschlungenen Wegen nach vielen tausend Kilometern das Schwarze Meer zu erreichen. Wie die meisten Flüsse in Russland, ist auch ein Ufer der Desna als Steilufer ausgebildet, es ist das dem Dorf gegenüberliegende. Das Ufer am Dorfrand ist flach und mit Buschwerk bewachsen.
Die tiefe Ufereinbuchtung in der Mitte des Dorfes, sowie ein Streifen heller Sand zwischen Wiesen und dem Wasser sind in den Sommermonaten der Ort für reges Leben. Kinder badeten, besonders gute Schwimmer wagen sich bis in die Flussmitte auf die darin befindlichen Inseln, und die Frauen des Dorfes waschen unter Austausch des Dorfklatsches hier ihre Wäsche. Zum Trocknen liegt das Leinenzeug dann im Sonnenschein ausgebreitet auf den Wiesen. Bedingt durch die jahreszeitliche Witterung und durch die Umweltverschmutzung im Fluss, liegt nun alles leer und verlassen im trüben Licht des neuen Tages.
Vor den Traktoren, vor der Zeit der Technik in der Landwirtschaft, so können sich die Alten im Dorf noch gut erinnern, wurden hier die Pferde und Rinder der Dorfbewohner zur Tränke geführt. Auch der Fischfang spielte auf der Seim früher im Wirtschaftsleben des Dorfes eine wichtige Rolle. Es gab Fischer, die vom Fang mit ihrer Familie davon leben konnten. In den letzten Jahren, mit dem Aufbau der Industrialisierung im Land, ist dieser Erwerbszweig jedoch völlig zum Erliegen gekommen. Das Wasser ist vom Oberlauf her, durch eine neu erbaute Chemiefabrik, stark verschmutzt, sogar das sommerliche Baden im Fluss birgt nun Gefahren. Der Dorfsowjet wiegelt diese zwar ab, aber rote, stark juckende Flecken auf der Haut der Badenden, beweisen das Vorhandensein giftiger Stoffe im Wasser.
Der einmal im Monat im Dorf erscheinende Arzt aus der Hauptstadt findet für die Hautrötungen eine plausible Erklärung: „Mit dem Wasser der Seim hat das nichts zu tun und mit der neuen Chemiefabrik erst recht nicht, ihr solltet euch sauberer halten“, so wiegelt er ab. Er hält seine Sprechstunde in einem gesonderten Raum der Kolchose und kann sich über mangelnden Besuch nicht beklagen. Schwere Fälle überweist er umgehend in die Stadt, doch sind diese äußerst selten. Es sei denn, ein Unfall ist passiert. Man kuriert sich, wo es geht, selbst.
Trotz des ersten Schneefalls ist der Seim mit seinen, zum Dorf hin, flachen Uferkanten noch eisfrei. In wenigen Wochen, vielleicht sogar in wenigen Tagen, wird er mit einer erst dünnen, dann immer dickeren Eisschicht bedeckt sein, die der Strom im späten Frühjahr des nächsten Jahres wieder verliert, um sich dann, in der Zeit der Schneeschmelze, in fasst doppelter Breite, bis an die ersten Häuser des Dorfes heranzuwagen. Nach seinem Rückzug in sein gewohntes Bett hinterlässt er eine Schlammschicht, auf der das Gras dann besonders saftig wächst. In der weiten Ebene, die über eine leichte Anhöhe links vom Dorf am Horizont verläuft, biegt die unbefestigte Dorfstraße nach einigen hundert Metern mit einen scharfen Knick in die befestigte Hauptstraße ein. In gerader Linie führt sie dann zwanzig Kilometer weit zur nächstliegenden Stadt. Zwischen der Stadt und dem Dorf liegen keine weitere Ansiedlung, nur Ackerland und ein dunkler Wald, in weiter Ferne.
Der hohe Holzzaun, mit einer schief hängenden Eingangstür aus verwitterten Brettern, der das Anwesen der Familie Skorochodow zur Straße hin umgibt, bietet so viel Abstand zum Haus, dass im Hof noch einige Holzverschläge und ein kleines, vom Alter schiefes Badehaus seinen Platz finden. Auf dem kümmerlich grasbewachsenen Hof scharren einige Hühner, es sind wohl noch sieben Stück, missmutig in den von Schnee freien Stellen nach Futter: nur so aus Gewohnheit. Zu finden ist da nichts. Die wenigen Eier aus dieser Schar sind aber ein wichtiger Bestandteil im Haushalt der Familie und manchmal auch Tauschobjekt mit den Nachbarn. Ein aufgeplusterter, feuerroter Hahn mit langen Schwanzfedern steht stolz auf einem umgekippten Holzkübel und beäugt aufmerksam die Umgebung sowie seine verbliebene Hühnerschar, die in Kürze bestimmt vollständig im Kochtopf landen wird. Ab und zu lehnt er den Kopf zurück, um dann mit einem lauten Kikeriki den neuen Tag anzukündigen. Aber auch seine Tage sind gezählt.
Hinter dem Haus, von der Straße nicht einsehbar, liegt ein leicht verwilderter Hausgarten mit angelegten Beeten, für nun schon längst geerntete Kartoffeln, Zwiebeln und Sonnenblumen. Außerdem gibt es einige Obstbäume, die nun ihre dürren, blätterlosen Zweige zum grauen, verhangenen Himmel strecken. Ganz am Rand des Grundstücks stehen, winterfest gemacht, auf vier runden Holzstützen, einem Bretterbelag und durch ein Dach geschützt, fünf Bienenkörbe. Die Bienenhaltung und somit die Honiggewinnung sind eine liebgewordene Beschäftigung des Großvaters der Familie. Erst vor wenigen Tagen hat der Alte aus zusammengesuchten Brettern das Dach über die Stände gebaut. Das, in den Gärten der Hausbewohner geerntete Gemüse und Obst dienen nicht nur zur Eigenversorgung, sie sind auch, wie die Hühnereier ein beliebtes Tauschmittel im Dorf. So gehen Tomaten gegen Kartoffeln und Sonnenblumenkerne gegen Kohlköpfe von einem Haus ins andere. Für einen Verkauf in der Stadt ist die Entfernung zu groß und der Ertrag zu gering. Sicher könnten die im Dorf erzeugten Lebensmittel auf dem Markt einen günstigen Preis erzielen, aber unter den gegebenen Umständen ist die Stadt, trotz der wenigen Kilometer, genauso weit entfernt wie der Mond.
Aber, die Straße selbst: Mit der Gründung der Kolchose, die vom Dorfsowjet einen klang- und kraftvollen Namen bekam, sollte dies auch mit der einzigen Straße im Ort geschehen. Man überlegte und hatte, ganz der Zeit entsprechend, auch eine politische Figur in Betracht gezogen, aber es blieb beim Überlegen. So heißt die einzige Straße im Dorf eben immer noch: „Die Straße.“
Ohne weitere Abgrenzung beginnt hinter dem Garten der Familie Skorochodow das Ackerland der Kolchose, auf dem noch die Stoppeln der diesjährigen Ernte stehen. Obwohl im Westen schon der Krieg tobte, wurde die Ernte im Sommer noch eingefahren. Zwischen den Stoppeln liegen jetzt Schneereste in den tiefen Mulden. Das Ackerland dehnt sich bis zum Horizont und endet in einem dunklen Streifen, der sich beim Näherkommen, wie eine dunkle Wand, als dichter, jetzt aber kahler Laubwald mit riesigen, alten Bäumen erweist. Seine Umrisse zeichnen sich deutlich und klar vom heller werdenden Horizont ab. Früher, noch zur Zarenzeit, reichte der Wald bis dicht an das Dorf heran. Dann benötigte die neu gegründete Kolchose Ackerland für die vorgegebene Planerfüllung. Riesige Maschinen und viele Arbeitskräfte sorgten dafür, dass der Waldrand nun in weite Ferne entrückt ist.
Auf dem freien Feld außerhalb des Dorfes liegen die Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude der Kolchose „Roter Oktober“. Hier ist der Arbeitsplatz für die männlichen und zum Teil auch weiblichen Dorfbewohner von Schewerniwo. Um den Namen der Kolchose wurde im Dorf lange gerungen: „Josef Stalin“, „Roter Kampf“ oder „Wladimir Lenin“ standen auf der Namenliste. Doch dann blieb es beim „Roter Oktober“.
Dem Dorf wollte man, gleich nach der Revolution, ebenfalls wie vor dem der Straße, einen schwungvolleren Namen geben. Es scheiterte aber ebenfalls am sturen, uneinsichtigen Widerstand der Bewohner.
Im Gebäude der Kolchosverwaltung, etwas außerhalb des Dorfes, ein stattliches Gebäude, mehr ein kleines Schloss, lebte vor der Revolution im Seitenflügel der großspurige Gutsverwalter. Der adelige Besitzer der Ländereien verbrachte jedoch seine Lebenszeit irgendwo im sonnigen Süden Frankreichs oder in den Spielkasinos Europas. Doch das sind längst vergangene Zeiten.
Zwei Monaten nach Kriegsbeginn, gleich nach der Ernte, hat die Kolchose ihren Betrieb eingestellt. Die breiten Tore zu den nun leeren Ställen und Maschinenhallen stehen weit offen, die kalte, nasse Luft weht durch die Gebäude und von den Maschinen und Geräten stehen nur noch die im Gelände, an denen Teile fehlen, oder jene, die mutwillig beim Rückzug der russischen Armeeeinheiten zerstört worden waren. Das Vieh wurde fortgetrieben, in östlicher Richtung. Wohin genau, wurde den Dorfbewohnern nicht mitgeteilt. Die Taktik dahinter: Den deutschen Okkupanten darf nichts Brauchbares in die Hände fallen.
Nun liegt alles verwaist im trüben Licht des neuen Tages. Ein LKW kam aus Kursk, kam an einem frühen Morgen und lud die Büromöbel sowie den persönlichen Hausrat des Leiters der Kolchose auf. Ohne noch einmal auf sein kleines Reich zurückzublicken, verschwand er mit seiner Familie und den durchziehenden Truppen in Richtung Osten.
Die Arbeiter, soweit im geeigneten Alter und einige sogar darüber hinaus, sind zum Militär eingezogen worden. Andere nicht mobilisierte, jedoch wehrfähige Männer waren plötzlich spurlos verschwunden. Man spricht im Dorf nicht über die Verschwundenen. Aber, sie sollen sich in den nahen Wäldern und Sümpfen westlich von Kursk versteckt halten. Es ist ungewiss, ob sie der Einziehung in die abrückende Rote Armee entgehen wollten, oder dem befürchteten, bevorstehenden Einmarsch der Deutschen in dieses Gebiet. Zusammen mit versprengten Rotarmisten und entlaufenen Kriegsgefangenen bilden sie jetzt die ersten Partisaneneinheiten, sammeln sich zu Kampfgruppen und werden zu einer ernsten Gefahr für die deutschen Nachschubtransporte. Handfeuerwaffen, Munition und Ausrüstungsgegenstände stehen den Partisanen durch den fluchtartigen Rückzug der regulären Armeeeinheiten reichlich zur Verfügung. Jedoch ist noch alles unkoordiniert. Das soll sich jedoch bald ändern.
Jetzt, zum Beginn der winterlichen Jahreszeit, steht es für die, als Partisanen kämpfenden Männer und wenigen Frauen in den Wäldern und Sümpfen jedoch schlecht. Alles geschah ohne Vorwarnung. So blieb ihnen keine Zeit, um Vorratslager anzulegen und winterfeste Unterkünfte einzurichten. Sie leben in der Wildnis unter erbärmlichen Umständen, hoffen aber auf baldige Unterstützung aus Moskau und auf die Hilfe der Bewohner der umliegenden Dörfer. In der ersten Zeit des Krieges kam Hilfe aus Moskau noch zögerlich, dann aber, als die Okkupanten ihr wahres Gesicht zeigten, lief sie bedeutend schneller und effektiver.
Gleich neben dem Verwaltungsgebäude der Kolchose steht angelehnt ein niedriger, unverputzter Backsteinbau. Es war der Einkaufsladen für den kleinen Ort und gleichzeitig die Kantine für die Arbeiter auf der Kolchose. Auch der liegt jetzt verlassen da. Mangels Versorgungsgüter ist er geschlossen, so stand es auf einem handgeschriebenen Pappzettel, der an der Tür klebte. Die einstige Verwalterin des Ladens hat sich in ihr Holzhaus im Dorf zurückgezogen. Da sie gut mit Nachrichten über die Lage im Land versorgt war, hat die flinke, kleine Person über Nacht die wenigen noch vorhandenen Lebensmittel in ihr Haus geschleppt. Dort hortet sie nun die restlichen Bestände, soweit sie nicht vergammeln. Eine Obrigkeit, die solches Treiben überwachen und verhindern kann, gibt es zum Bedauern der Dorfbewohner nicht mehr.
Der kleine Laden mit seinen wenigen Beständen und die daran anschließende Kantine waren das Kommunikationszentrum des Dorfes. Man traf sich dort und Neuigkeiten wurden ausgetauscht, sofern es welche gab. Manchmal lag dort sogar eine Zeitung aus der Stadt, meist schon viele Tage alt, aber dem dörflichen Leser immer noch aktuell genug. Dieser Mittelpunkt fehlt nun.
Der gerade 16-jährige Ivan hat sich aus seinem Bett erhoben und kommt aus dem kleinen Verschlag, der ihm zum Schlafen dient. Das kleine Fenster erhellt nun den Raum völlig, indem neben Ivans Bett sich noch die Schlafstelle seines Bruders befindet. Daneben ein grober Tisch und zwei Stühle. Auf dem Tisch liegen einige zerlesene Hefte und ein Buch aus der Kolchosbücherei, dass nicht mehr zurückgegeben werden braucht, die Bücherei existiert nicht mehr, die Bücher werden als Feuermaterial Verwendung finden. Das Bett neben ihm ist leer und unbenutzt. Es ist das Lager seines zwei Jahre älteren Bruders Stefan, der mit dem Vater nicht mehr im Hause weilt.
Eine Zeitlang hatte Ivan noch mit hinter dem Kopf verschränkten Armen auf seinem Lager gelegen und den Geräuschen der Mutter in dem Nebenraum und dem Plätschern des vom Dach herabfallenden Tauwassers gelauscht. Dabei hat er zur niedrigen Holzdecke geschaut, die er stehend ohne weiteres mit der Hand erreichen kann und überlegt, was er an diesem Tag zu erledigen hat. Er fühlt, dass eine Spannung in der Luft liegt, kann sie sich aber nicht erklären. Es ist wie eine Beklemmung, die einfach vorhanden ist, für die es aber zu dieser frühen Stunde noch keine Erklärung gibt. Etwas Besonderes kommt bei seinen Überlegungen nicht heraus. So erhebt er sich und schlurft in seinen ausgetretenen Latschen aus seinem Verschlag zum Waschtrog in den Küchenbereich, an dem die Mutter schon einige Zeit mit dem Geschirr hantiert.
Mit warmer Freude sieht Irina, seine Mutter, ihrem jüngsten Sohn entgegen, der in seiner beginnenden Männlichkeit, unverkennbar ihre Gesichtszüge trägt. Es sind keine weiblichen Züge welche die Ähnlichkeit mit der Mutter hervorheben. Es ist eine Ähnlichkeit, die man nicht beschreiben kann, aber augenfällig vorhanden ist. Ivan ist nicht der einzige Sohn, aber der absolute Liebling der Mutter. Seine Mutter ist ausgestattet mit den Charakterzügen und den Stärken aller russischen Mütter und Frauen in schweren Zeiten, die es gewohnt sind Arbeiten, Lasten, Leiden und Verantwortung auf sich zu nehmen. Frauen, die dabei nicht zerbrechen, sondern mit ihren Aufgaben immer stärker werden.
Der unselige Krieg ist für die Bewohner des Landes völlig überraschend in der Mitte des Jahres ausgebrochen. Erst als er schon einige Zeit im fernen Westen tobte, hat man hier im Dorf davon erfahren. Das Unheil hat den Verlust der Hälfte der Familie gebracht. Die Energie und Lebenskraft von Ivans Mutter und auch der anderen Mütter im Dorf jedoch nicht geschwächt, sondern hat sie gestärkt.
Die Statur der Mutter ist kräftig und von Arbeit geprägt, wenn sie nun auch schon in die sogenannten „Jahre“ gekommen ist. Ihr hellblondes Haar ist glatt, streng hinten zu einem Knoten zusammengebunden und nur im Ansatz zu sehen. Ein weißes Kopftuch bedeckt die Haare. Im Gesicht, um die grauen, klarblickenden Augen, zeichnet ein Kranz kleiner Falten ihr Gesicht und gibt ihm ein herbes, aber anziehendes Aussehen. Die dichten, im Gegensatz zu den blonden Haaren, dunklen Augenbrauen und der herbe Mund mit den prachtvollen, weißen Zähnen vervollständigen das Bild. Die sengende Sonne des russischen Sommers und die eisige Kälte des Winters haben Spuren hinterlassen, die jedoch ihrem Alter nicht entsprechen. Es ist zu erkennen, dass dieses Gesicht den wechselnden Jahreszeiten ausgesetzt ist.
Ivans Vater Alex und der ältere Bruder Stefan sind in den Krieg gegen die Deutschen gezogen. Das war vor etwa vier Wochen. Eine Nachricht rief sie nach Kursk. Dort absolvierten sie eine viel zu kurze Ausbildung. Eine längere Ausbildung wäre für einen Kampfeinsatz gegen die kriegserfahrenen Deutschen sicher von Nutzen gewesen, doch die Zeit reichte dafür nicht aus. Es gibt von den beiden bisher kein Lebenszeichen. Beunruhigend ist dies in dieser nachrichtenlosen Zeit jedoch nicht. Alle wehrdienstfähigen Männer sind im Krieg, oder bei den Partisanen in den Wäldern und Sümpfen.
Die Mutter hat nun das Geschirr weggeräumt und zur Seite schauend, sagt sie im gutmütigen Ton: „Na, du Faulpelz, hast du es geschafft, aus den Federn zu kommen?“
Ein leichtes Lächeln verschönt dabei ihr sonst so ernstes Gesicht.
Ivan streckt sich, brummelt etwas leise einen Morgengruß vor sich hin und zieht weitere Kleidungsstücke an, die er aus seinem Verschlag, über den Arm tragend, mitgebracht hat. Sein dunkelblondes Haar hängt ihm über die Stirn, der Hinterkopf ist kahlgeschoren und er hat die untersetzte, kräftige Gestalt, die allen Skorochodows zu Eigen ist.
Ivan drängt sich an der Mutter vorbei in den Vorraum.
„Was ist, soll ich Wasser holen oder ist noch genügend vorhanden?“ Ohne eine Antwort der Mutter abzuwarten, schlüpft er aus den Latschen in seine an der Tür zum Trocknen abgestellten Filzstiefel, nimmt den Wassereimer und macht sich auf den Weg zum Brunnen, den sich seine Familie mit dem nächsten Nachbarn teilt. Seine Stiefel hinterlassen tiefe Abdrücke im Schnee und aufgeweichten Boden des Hofes. Der Hahn flattert vor Schreck, über den plötzlichen Hofbesucher, von seinem erhöhten Standort auf. Am Brunnen angekommen, an der Grenze zum Nachbargrundstück, bleibt Ivan einen Moment lang lauschend stehen.
Schon seit einigen Tagen ist aus der Ferne dumpfes Grollen von Geschützen zu hören. Mit jedem Tag und jeder Nacht kommt es etwas näher. Die Luft vibriert, wie von einem fernen Gewitter. Flugzeuge, vordem nie in dieser Gegend am Himmel gesehen, überfliegen in unregelmäßigen Zeiträumen von West nach Ost das Dorf. Es ist wegen der Flughöhe aber nicht zu erkennen, welcher Nation sie angehören.
Ivan lässt den Eimer über ein am Seil über ein knarrendes Holzrad herunter, zieht ihn voll mit glasklaren, eiskalten Wasser wieder nach oben und geht vorsichtig, ohne etwas zu verschütten, ins Haus zurück.
Hinter dem großen, gemauerten Ofen, der die gesamte Mitte des größten Raumes im Haus einnimmt, hört man es husten und räuspern. Eine grobe Decke wird auf dem Ofen zur Seite geworfen und der Großvater der Familie, Mitka, der Vater von Ivans Vater, steht in Unterhose, verblichenem Hemd und dicken Socken an den Füßen, im Raum. Ein beeindruckendes Bild. Seine kräftige, immer noch imposante Gestalt dehnt sich und er macht einige Bewegungen, um die vom Schlaf und Liegen steif gewordenen Arme und Beine wieder gelenkig zu bekommen.
Sein zotteliger, am frühen Morgen noch etwas ungepflegter Bart, der die untere Gesichtshälfte bedeckt, ist bereits mit ergrauten Streifen durchzogen. Das Haar hat das rötliche Blond noch weitgehend behalten, wallt lose auf seinen markanten Kopf und fällt ihm von der Stirn bis in die Augen. Trotz seiner schon über 70 Jahre kann seine Statur noch als ziemlich stattlich betrachtet werden. Die Jahre des Alterns haben an seiner Größe nicht viel verändert. Geht er durch eine der wenigen Türen im Haus, muss er immer noch den Kopf einziehen, die Hauserbauer dieser Familie müssen wohl vor vielen Generationen bedeutend kleiner gewesen sein. Das Haus ist aber solide und fest, für viele Generationen gebaut. Die Außenwände sind aus uralten Holzbalken gefügt. Innen stehen feste Mauern und auch einige aus Lehm- und Weidengeflecht, in deren Mitte die Mäuse ungestört auf und ab laufen.
Bis zur Schließung der Kolchose vor einigen Monaten hatten dort sein Sohn sowie seine Enkel Stefan und Ivan ihre Arbeitsplätze. Eigentlich lebte das ganze Dorf von der Arbeit auf der Kolchose. Eine andere Verdienst- und Arbeitsmöglichkeit gab es im weiten Umkreis, bis zur großen Stadt hin, nicht. Auch als der Großvater schon Rentner war, wollte und vor allem konnte der Kolchose Leiter nicht auf dessen Wissen über Traktormotore und landwirtschaftliche Geräte verzichten und so arbeitete der Großvater auch im Alter noch nach Lust und Laune weiter. Seine geringe Rente und der zusätzliche Verdienst flossen in den Haushalt der Familie.
Aber nicht nur die Zahlungen von staatlicher Seite sind nun eingestellt, auch sämtliche Arbeiten auf der Kolchose. Alle im Dorf, und so wird es im gesamten westlichen Teil Russlands sein, leben von dem, was im Haus vorhanden ist. Eine Entschädigung oder einen Ausgleich hat keiner der Dorfbewohner bei der Schließung und auch danach erhalten; war die Kolchose doch ihr, von allen Dorfbewohnern zusammengelegtes, Eigentum. Der Krieg hat die Normalität verdrängt.
Ivan wendet sich seinem Großvater zu: „Du, Großvater, das Donnern ist näher gekommen. Auf der Hauptstraße ist seit gestern wieder ein nicht abreißender Verkehr. Da fahren Panzer, Lastwagen und dazwischen auch Pferdewagen.“
„Das ist Stalins Heldenarmee. Die sehen jetzt zu, wie sie ihr Fell in Sicherheit bringen können, die reißen aus statt zu kämpfen. Uns lassen sie zurück, übergeben uns den Deutschen. Diese Feiglinge!“
Die Mutter, noch am Sims beschäftigt, machte eine ängstliche und besorgte Geste zur Tür. „Wenn dich jemand hört. Sei mit deinen lauten Äußerungen etwas vorsichtiger. Du weißt doch, wie groß die Ohren der Nachbarn sind. Groß wie Teller, sie hören immer genau das, was sie nicht hören sollen. Du weißt ja nicht, wie alles noch kommen wird. Vielleicht sind unsere schneller wieder hier als die Deutschen. Außerdem: Ich war gestern mit den Frauen an der Straße. Wir haben Wasser an die Soldaten verteilt. Sie haben aus den Eimern wie die Tiere getrunken. Es geht ihnen sehr schlecht. Etwas anderes als Wasser haben wir ja auch nicht mehr. Unsere Leute hätten ja auch dabei sein können. Du hättest sehen sollen, wie sie sich gefreut haben. Zu Essen hatten sie auch nichts.“
„Ach, sollen sie doch. Es kommen bestimmt andere Zeiten, schlechter als es jetzt ist, kann es doch gar nicht mehr werden. Außerdem, was laufen sie, sollen sie doch kämpfen. Dazu sind sie doch da“. Die Mutter sieht den Großvater zweifelnd von der Seite an und ist sich nicht sicher, ob das seine wirkliche Meinung ist.
„Halt dich mit deinen Äußerungen doch etwas zurück. Ich, und nicht nur ich, weiß, dass du mit den Kommunisten nichts im Sinn hast, noch nie hattest. Bestimmt ist in diesem Regime nicht alles richtig. Ich denke da an die Hungerkatastrophe vor einigen Jahren, aber wie war es denn früher? Und denk doch an deinen Sohn, meinen Mann, und an Stefan, meinen Sohn. Beide stehen im Kampf gegen einen Feind, der unser Land angegriffen hat. Sicher, du hast andere Zeiten mitgemacht, aber waren die wirklich besser? Mit der Zeit verklärt sich alles, aber von meiner Familie weiß ich es, sie haben unter dem Zaren wie die Tiere gelebt. Erst mit dem Kommunismus ist etwas mehr Sicherheit eingekehrt. Gerade jetzt, wo die Zeit der Hungersnöte vorbei ist, bricht der Krieg aus. Denk auch daran, dass du erst lesen und schreiben unter den Kommunisten lernen konntest. Und, was wollen die Deutschen in unserem Land? Du hast doch selbst gesagt, dass Deutschland ein schönes Land ist, in dem alles vorhanden ist was die Menschen brauchen, hast es selber gesehen. Was wollen sie uns nehmen? Wir haben doch nur das für den täglichen Bedarf und nichts darüber hinaus.“
Für den Alten, der seiner Schwiegertochter unwillig zugehört hat, steht die Meinung felsenfest und die gilt auch für den geflohenen Dorfsowjet. Der Kommunismus ist für ihn vom Teufel persönlich erfunden und der Teufel selbst, der sitzt in Moskau, im Kreml. Mit diesem System kann und will er sich nicht anfreunden. Warum er den Kommunismus anlehnt, hängt sicher mit den Erinnerungen an der Hungerkatastrophe vor wenigen Jahren zusammen. Er brummelt etwas vor sich hin und muss aber im Inneren seiner Schwiegertochter Recht geben, wenn auch nicht in Worten.
Seit Tagen hatte sich das Donnern und Grollen in der beginnenden Winterluft noch weiter verstärkt. Nachts zucken Blitze am Himmel, steigen in weiter Ferne Leuchtraketen auf und in unregelmäßigen Abständen überfliegen in der letzten Zeit große Flugzeugverbände das Dorf in östliche Richtung, um nach einer Zeit auf der gleichen Route zurückzukommen. Dass es sich um deutsche Flugzeuge handelte, ist jetzt selbst ohne Fernglas an den Hoheitszeichen, nur mit den Augen, gut zu erkennen.
Auf der sonst so ruhigen, seitlich am Dorf vorbeiführenden Landstraße, rollen weiter in unablässiger Folge russische Panzer und Lastkraftwagen mit hinter gehängten Geschützen. Dazwischen auch Infanteriekolonnen und Pferdegespanne, die noch vor einiger Zeit in westliche, nun aber in schneller Fahrt in östliche Landesteile flüchten; dicht gefolgt von deutschen Einheiten, von denen aber im Dorf noch nichts zu sehen ist.
In den Wäldern, kurz vor der Stadt Kursk, sind die Deutschen auf heftigen Widerstand gestoßen. Dort haben sie vor dem Wintereinbruch noch einmal eine große Anzahl an Gefangenen gemacht, jedoch auch bereits die ersten Ausfälle durch den einsetzenden Frost. Von Kampfhandlungen ist die kleine Ortschaft Schewerniwo bisher verschont geblieben. Einen Bericht über den Stand der Kämpfe haben die Dorfbewohner bisher nicht erhalten. Das einzige Radio im Dorf hatte der Dorfsowjet in seinem Haus stehen und der ist längst verschwunden.
Auch im Haus der Skorochodows beginnt der Tag weiter mit seinen alltäglichen Verrichtungen. Die Mutter hat das Spülen der wenigen Teller und Tassen beendet und deckt den in der hinteren Ecke des niedrigen Raumes stehenden Tisch, mit dem Wenigen, was die schwere Zeit noch zu bieten hat. Da stehen neben dem Brot ein Schmalztopf, etwas Salz und ein Glas Honig aus dem eigenen Bienenstock als Zuckerersatz, auch noch ein Krug mit der nun mühsam zu beschaffenen Milch. Eine Flasche glasklarer Wodka aus vergangener Zeit steht für besondere Anlässe, gut versteckt von der Mutter, im hinteren Teil des Küchenschrankes.
Dieser größte Raum im Haus glänzt vor Sauberkeit. Hier spazieren keine Hühner durch die Stube, ganz im Gegensatz zu den anderen Häusern im Dorf. Neben dem mit weißer Farbe gestrichenen, fast raumhohen Ofen in der Mitte des Raumes, steht seitlich angesetzt noch ein kleinerer Küchenofen. Auf seiner Abdeckplatte brodelt ständig ein Kessel mit heißem Wasser. Das Feuerholz für die Öfen, die nun bis zum kommenden Frühjahr nicht mehr kalt werden, liegt als riesiger Stapel hinter dem Haus und ist über den Winter, bis zum Frühjahr, genauso geschmolzen wie der Schnee. Bis zur halben Türhöhe ist der Raum mit einer glänzenden, grünen Ölfarbe gestrichen, der Rest der Wand – bis zur Holzdecke – ist mit schon etwas verblichener, geblümter Tapete tapeziert.
Zwischen der Tür und dem Fenster hängt an der Wand ein Prunkstück, das im ganzen Dorf bekannt ist: Ein Pfau als Mosaik, aus mehreren Fliesen zusammengesetzt. Lebend gesehen wurde solch ein Exot von den Bewohnern des Dorfes noch nie.
Wer dieses Meisterstück jemals dort angebracht hat, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Es hat dort schon immer seinen Platz. Auffällig an diesem Prunkstück ist das Vorhandensein von Fliesen an den Wänden. In keinem Haus im Dorf findet man Fliesen, denn an den Holzwänden der Häuser hätten sie gar keinen Halt gefunden. Auf einem Sims entlang der Wand stehen Töpfe und Teller in geordneten Reihen. Der Samowar zischt und brodelt leise auf einem kleinen Nebentisch.
Aus einem für die Bewohner des Dorfes unbekanntem Grund, ist vor einigen Tagen, wohl kriegsbedingt, die Stromzufuhr im Dorf ausgefallen und so erhellt nur das Licht des neuen Tages den Raum durch zwei kleine Fenster.
Der Großvater setzt sich, nachdem er sich mit kurzer Handbewegung vor der Ikone bekreuzigt hat, auf die Holzbank. Die über ihm, etwas schräg hängende, alte, vom Kerzenrauch geschwärzte, Ikone mit dem brennenden Licht der kleinen Lampada, ist von der Mutter zuvor angezündet wurden und erhellt nun mit flackernden Licht die Raumecke. Dass dieses Sinnbild christlich orthodoxen Glaubens hier immer noch seinen Platz hat, verdankt es allein dem energischen Einsatz der Mutter. Schon als die längst verstorbene Großmutter noch lebte, und auch davor, hing die Ikone an diesem Platz. Wohl eigentlich schon immer. Dass der Großvater sich bekreuzigt, geschieht aus reiner Gewohnheit. So haben es die Alten immer gemacht und so wird es auch bleiben. Der Kommunismus, hier vertreten durch den Dorfsowjet konnte daran nichts ändern.
Trotz manch kleiner Einschüchterungen von Seiten des Dorfältesten, und davor schon viel stärker vom Dorfsowjet, setzt die Mutter, seit einigen Wochen, zusammen manchmal mit dem Großvater und vielen anderen alten und jungen Frauen, an den Sonntagen den Besuch in der kleinen, aus Steinen gemauerten, alten Dorfkirche am Ende der Straße, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, beharrlich fort. Nach einem Heiligen, oder einer Heiligen ist die Kirche nicht benannt. Sie heißt nur einfach: Die Kirche. Die ganz Alten im Dorf wollen aber wissen, dass die Heilige Barbara oft mit ihrer Kirche genannt wurde. Der von den Roten verjagte Gutsbesitzer oder dessen Vorfahren haben das Gebäude aufrichten lassen, zur besseren Unterweisung ihrer Leibeigenen. Fünfundzwanzig, manchmal sogar dreißig Frauen aus dem Dorf versammeln sich nun wieder zur Andacht, die jungen Männer fehlen vollständig unter den Gläubigen.
Der von Deutschland begonnene, dann von Stalin propagierte, nun schon mehrere Monate dauernde „Vaterländische Krieg“ hat die doppelflügelige Tür zu dem Gotteshaus wieder geöffnet, nachdem es lange Zeit als Abstellhalle für die nahe gelegene Kolchose genutzt wurde.
Das bis dahin dort gelagerte Stroh und die leeren Treibstofffässer für die Traktoren und Maschinen sind ausgeräumt und das undichte Dach repariert, wenn auch nur notdürftig; das erforderliche Material dafür ist knapp, eigentlich gar nicht vorhanden, oder nur über Tauschgeschäfte zu bekommen. Die durch die eindringende Feuchtigkeit beschädigten alten, bestimmt wertvollen, Wandmalereien sind jedoch unrettbar verloren und nur noch schemenhaft unter Nässe und Schimmel zu erkennen. Der Kirchenraum ist dunkel und wird nur durch die geöffnete Tür erhellt. Glasfenster waren früher vorhanden, wurden aber ausgebaut und anderweitig verwendet. Die glaslosen Öffnungen sind mit Bretter und Holzplatten verschlossen.
Einige Dorfbewohner haben ihre eigenen Ikonen und einige Kerzen gespendet. Diese geben der Kirche nun etwas Glanz und die erforderliche Festlichkeit. Der immer noch vorhandene Geruch von Dieselöl und stickigem Stroh wird mit jeder Andacht vom Duft der brennenden Kerzen und vom Geruch der Menschen verdrängt.
Der Geistliche, ein freundlicher alter Mann mit matten, kummervollen Augen und großen, von harter Arbeit geprägten Händen, aus einem Nachbarort, übt seit Kriegsbeginn mit stiller Duldung des Dorfältesten das heilige Amt in der halb zerfallenen, mehr einer Ruine gleichenden, Kirche aus. Er spricht viel von der Vergangenheit, von der Zeit vor dem Kommunismus, und klammert aber auch die gewonnenen Werte der gegenwärtigen Zeit nicht ganz aus. In seiner Predigt ist manchmal viel politisches, aber die Frauen hören ihm geduldig zu. Der Geistliche gibt Trost in diesen Zeiten, in denen niemand weiß, was der nächste Tag bringen wird. Die Litanei singt er mit seiner hohen Altmännerstimme und alle fallen zu bestimmten Zeiten darin ein.
Sein dabei getragenes Gewand entspricht allerdings nicht dem Ritual der feierlichen, orthodoxen Zeremonie. Die Jacke, der darunter getragene ausgefranste Pullover, die Hose, seine abgelatschten Schuhe und sein wild wuchernder, ungepflegter grauer Bart, ergeben mehr das Bild eines gerade vom Feld kommenden Bauern, als das eines heiligen Mannes. Die rote Nase und die geschwollenen Gesichtszüge deuten gar sein gesteigertes Bedürfnis auf Wodka hin. An besonderen Feiertagen kramt er aus einem Bündel ein verschlissenes Ornat, wirft es sich über und gibt dem Gottesdienst dann eine etwas feierlichere Form. Der versammelten Gemeinde ist das Äußere des Predigers gleichgültig, aber seine ritualen Handlungen berühren tief die Herzen der Menschen, in dieser schweren Zeit. Nicht einmal sein Name ist den Kirchenbesuchern bekannt, es hat ihn auch keiner danach gefragt. Einige sagen, er heißt Nicolai, soll auch verheiratet sein.
Im hinteren Teil der Kirche steht ein gemauerter Absatz, vielleicht die Mensa auf der früher einmal der Altar stand, von dem jetzt aber nicht ein Stück Holz mehr zu sehen ist. Dort stellt der Geistliche seine, unter dem Mantel, in ein Tuch gewickelte, eigene Ikone auf und führt den Gottesdienst nach seinen eigenen Regeln durch. Eine sonst in orthodoxen übliche Ikonenwand, die den Altar vom Kirchenschiff trennt, hat es in dieser kleinen Kirche nie gegeben. Weihrauch gibt es nicht, wird auch von keinem Teilnehmer vermisst. Mit heller Stimme liest er aus seiner ebenfalls mitgebrachten, schmuddeligen alten Bibel vor und alle sind ergriffen. Nach der Predigt nimmt er die Ikone, hält sie mit beiden Händen vor sich und alle Teilnehmer am Gottesdienst beugen sich vor ihrem Abgang darüber.
Wovon der Geistliche eigentlich lebt und seinen Lebensunterhalt bestreitet, ist für die Kirchgänger immer im Unklaren geblieben. Er kommt und führt den Gottesdienst aus, dann verschwindet er wieder. Auf einer Kolchose arbeitete er für seinen Lebensunterhalt jedenfalls nicht.
Glockengeläut ist nicht mehr zu hören, die einzige Glocke seit einigen Wochen spurlos verschwunden und ist bestimmt schon für militärische Zwecke verarbeitet. Trotzdem, auch ohne Glockengeläut wissen die Frauen, wann der Gottesdienst beginnt. Wer hätte sie auch läuten sollen, wenn der Pope doch aus einem ganz anderen Bereich kommt.
Man sagt im Dorf, wenn man sich über den heiligen Mann unterhält, dass er für seinen Lebensunterhalt Schafe züchtet und an die Juden verkauft, damit die koscheres Fleisch im Kochtopf haben. Seine Kunden sind aber in der letzten Zeit weniger geworden. Viele sind mit den abrückenden Rotarmisten in Richtung Osten gezogen und die geblieben sind, denen fehlt das erforderliche Geld zum Fleischkauf. Der Krieg hat wohl gerade ihm, und nur ihm allein, mit der Öffnung der Kirche Vorteile gebracht. Die Wenigen, die auch behaupten seinen Namen zu kennen, verbreiten das Gerücht, dass er seinen Handel schwarz betreibt, um der lästigen Steuer zu entgehen. Wenn die Frauen in die Kirche treten, legen sie ganz still und vielleicht auch etwas verschämt kleine Gaben, wie Eier, Kartoffeln oder auch mal einen Kohlkopf, seitlich am Eingang ab. Bevor der Prediger mit den heiligen Ritualen beginnt, wirft er einen Blick auf das Häufchen und dann kann es vorkommen, dass sich mit der Höhe der Gaben auch sein Stimmchen um einiges hebt. So hat das kirchliche Leben in Schewerniwo, gerade wegen des fürchterlichen Krieges, wieder seinen Anfang genommen. Ein kleiner Umschwung der Gefühle trat ein, als der heilige Mann die Fastenzeit erwähnte und darauf hinwies, dass auch dieses Ritual früher oder später wieder eingeführt werden soll. Nur die Alten können sich daran erinnern. Bei den Jüngeren besteht keine Aussicht, dass sechs Wochen Fasten zur Osterzeit noch zu ihrem Leben gehört. Von den Weihnachtsfasten ist gar nicht zu reden. Später erwähnt der Geistliche dieses Thema nicht mehr.
Die am Tisch des Hauses versammelte Familie ist um den Vater und Ivans Bruder geschrumpft, ihre Stühle stehen leer am Tisch. Die Stimmung ist bedrückt und kann durch nichts, auch nicht vom sonst so gesprächigen Großvater mit Erzählungen, aufgelockert werden. Die Brüder liegen zwar altersmäßig wenige Jahre auseinander - vier Jahre sind es - hatten aber, als alle noch zusammen waren, unterschiedliche Interessen. Der ältere Stefan war ganz der Sohn des Vaters, versuchte mit Erfolg ihm in allen Teilen des täglichen Lebens nachzueifern und war ständig um ihn herum und mit ihm zusammen. Ivans Lebenskreis lag beim Großvater und der Mutter, wenn er nicht mit den Freunden im Komsomol war, in dem der ältere Bruder nie gesehen wurde.
Der Großvater lehrte Ivan Fallen für die an den Uferböschungen lebenden Kaninchen zu stellen und mit Erfolg der Entenjagd mit Pfeil und Bogen am Ufer der Seim nachzugehen. Die vom Großvater für Ivan gebaute Angel steht in dessen Schlafkammer und wartet auf ihn zum Fang von Brassen und Karpfen an einer, nur den beiden bekannten Uferstelle der Seim. Nachdem der Fluss aber vom Oberlauf her stark verschmutzt ist, konnten die Angeltouren eingestellt werden.
In den langen Winterabenden hat der Großvater seinen Enkeln die Geschichte des Stenka Rasin, einem russischen Volkshelden, erzählt. Bei Ivan, als den Begeisterungsfähigeren der Brüder, blieb die Person so tief im Bewusstsein verankert, dass er sich bei Spielen mit anderen Dorfjungen nun stets Rasin rufen ließ.
Der Großvater sitzt noch immer auf seiner Holzbank.
„Großvater, was meinst du, kommen die Deutschen hierher?“ will Ivan wissen.
„Aber ganz sicher. Es wird gar nicht mehr lange dauern und sie klopfen hier ans Fenster.“ Bei diesen Worten sieht er seinen Enkel lächelnd von der Seite an.
„Großvater, der Verkehr auf der Straße hat wieder zugenommen. Seit die Deutschen sie bombardiert haben, ist alles wieder repariert.“
„Hast du noch etwas gefunden, was wir gebrauchen können?“
„Nein, da war nichts mehr.“
„Wieso, da war nichts? Es hat doch gekracht, dass die Scheiben geklirrt haben.“
„Die Löcher auf der Straße sind geschlossen und die ausgebrannten Autos zur Seite geschoben. Außerdem haben die Leute, die da arbeiten, mich weggejagt. Du kannst den Lärm, den die da machen, bis nach hier hören.“
Es wird still am Tisch. Vom Samowar auf dem Nebentisch kommen weiter leise, zischende Geräusche. Der Großvater löffelt aus der Tasse ohne Henkel seine angewärmte Milch mit eingeweichten Brotresten.
Ivan beißt mit seinen kräftigen Zähnen in sein Brot, die Mutter sitzt mit abgewandtem Gesicht am Tisch und ist in Gedanken versunken. Im Raum herrscht, außer den Geräuschen des Samowars, völlige Stille.
„Wo der Vater und Stefan jetzt wohl sein mögen?“ Sie sagt es mehr zu sich selbst. Eine Antwort bekommt sie darauf nicht.
Im Westen des riesigen Landes braute sich weiter das Unheil über die Menschen zusammen. Die deutschen Armeen näherten sich, über die Grenzen der Ukraine hinweg, Mittelrussland. Nur noch wenige Kilometer und trotz des heftigen Widerstands der zurück weichenden russischen Einheiten ist die Stadt Kursk durch deutsche Panzerspitzen erreicht.
Das kleine Dorf am Ufer der Seim hat außer dem Verlust einiger männlicher Einwohner vom Krieg noch nichts mitbekommen. Einmal, an einem strahlenden Sonnentag, sausten deutsche Tiefflieger über das Dorf, fanden aber kein lohnendes Ziel. Auch der Flüchtlingsstrom aus den Dörfern westlich von Kursk hielt sich in engen Grenzen. Es zogen einige Wagen an Schewerniwo vorbei, aber es waren nur wenige und sie machten im Dorf nicht einmal Rast. Nur eine einzige Flüchtlingsfamilie ist geblieben. Eine Frau mit kleinen Kindern ist im Haus des Dorfsowjets einquartiert. Der Mann, als Fahrer des Wagens, ist spurlos verschwunden und so blieb die Frau mit den Kindern zurück. Eine Gelegenheit zur Weiterfahrt hat sich für sie noch nicht ergeben. Es ist jetzt so gekommen, dass sie auch gar nicht weiter will. Ivans Mutter hat ihre Hilfe angeboten, konnte sich aber davon überzeugen, dass sie nicht benötigt wurde.
Der letzte Teil der noch verbliebenen Männer des Dorfes ist, mit den zurückweichenden russischen Einheiten, abgezogen. Die ganz Alten und die nicht mobilisierten Jungen sind geblieben und erwarten nun mit Spannung den Einmarsch der Deutschen. Langeweile breitet sich unter den Verbliebenen aus und der Wodka-Konsum, teils aus eigener Produktion und auch durch Tauschgeschäfte, nimmt unter den Alten beängstigend zu.
Der Dorfsowjet ist mit seiner vielköpfigen Familie, unter Mitnahme aller Akten, des einzigen Radios und einigen Möbelstücken, ebenfalls mit den zurückflutenden Rotarmisten, vor einigen Tagen, genau wie der Kolchosleiter, geflohen. Selbst das große im Goldrahmen gefasste Stalinbild, das die Wand hinter seinem Schreibtisch zierte, hat er mitgenommen. Zurückgeblieben ist ein weißer Fleck auf der schmuddeligen, von Fliegendreck und Rauch gefärbten, Tapete.
Für die Dorfbewohner ist seine fluchtartige Abfahrt ein sicheres Zeichen, dass die Deutschen in allernächster Zeit das Dorf erreichen werden. Sicher wusste er mehr über die militärische Lage im Land als alle anderen Bewohner im Dorf. In einer Wolke blauer Autoabgase ist er verschwunden und hat die ratlosen Bewohner zurückgelassen. Dass für seinen persönlichen Abtransport sogar ein Lastwagen zur Verfügung stand, während unzählige Soldaten auf den Rückmärschen über viele Kilometer zu Fuß gehen müssen, gehört wohl zu den Ungerechtigkeiten des Soldatenalltages. Nun wird das Haus, das gleichzeitig sein Büro war, im Seitentrakt von der hängengebliebenen Flüchtlingsfamilie bewohnt. Die Dorfbewohner machen um dieses große, massive Anwesen einen weiten Bogen. Das Hinweisschild über dem Eingang, mit dem roten Stern in der Mitte, ist von Unbekannten vor einigen Tagen abgebaut worden und liegt nun hinter dem Haus. Eine unerklärliche Scheu hält die Dorfbewohner davon ab, es zu Feuerholz zu verarbeiten.
Der Verkehr von Motorfahrzeugen auf der Hauptstraße ist im Dorf, und nun gerade im Winter bei der klaren Luft, gut zu hören; das war auch in Friedenszeiten schon so, nur hielt der Verkehr sich da in Grenzen.
Zwar haben die deutschen Truppen vom Schwung der ersten Wochen und Monate viel verloren, setzen den Vormarsch aber bis zum Jahresende immer noch fort. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und der Witterung, wann die grundlosen Wege eine langsamere Gangart einleiten, wenn nicht sogar den Stillstand. Der Hauptgrund für das langsamere Vorrücken ist aber auch der sich versteifende Widerstand der zurückweichenden Rotarmisten. Der Überraschungseffekt des Überfalls ist verklungen. Die, als Siege der Deutschen über den Feind, gefeierten Kesselschlachten mit riesigen Gefangenenzahlen, binden ganze Armeeteile der vorrückenden Deutschen, die nun aber auch bei deren Vorwärtsstrategie fehlen. Wovon die vielen eingebrachten Gefangenen aber ernährt werden sollen, darüber haben sich die sonst so logisch denkenden Okkupanten zu Beginn des Feldzuges sicher keine Gedanken gemacht. Das wird sich blutig rächen.
Im Haus der Skorochodows ist der Frühstückstisch abgeräumt, Großvater und Ivan bleiben sitzen, auch die Mutter setzt sich wieder mit an den Tisch. Ivan wendet sich an den Großvater: „Sag mal Großvater, wie sind die Deutschen? Du kennst sie doch.“
„Na ja, wie sollen die schon sein. Sie sehen aus wie alle Menschen. In unserem Land leben viele von ihnen, ganze Landesteile haben sie besiedelt. Zur Zarenzeit waren das angesehene Leute. Kaufleute und manchmal sogar Beamte.“
Der Großvater war als Teilnehmer im Ersten Weltkrieg in der für Russland so schlecht ausgegangenen Schlacht bei Tannenberg in Ostpreußen, in deutsche Gefangenschaft geraten und erinnert sich selbst nach so vielen Jahren mit angenehmen Gedanken an diese Zeit. Zwei Jahre verbrachte er auf einem Gutshof in Ostpreußen und war dort, unter vielen Völkerschaften, wie Kassuben, Polen, Litauern und natürlich Deutschen, mit den gleichen landwirtschaftlichen Arbeiten beauftragt, wie er sie auch zu Hause ausgeführt hatte. War die erste Zeit der Gefangenschaft im Lager auch mit Entbehrungen und Hunger verbunden, hatten die Deutschen doch selbst kaum etwas zu essen, so wurde es, als er aus dem Lager kam, mit seiner Tätigkeit auf dem Gutshof doch erträglicher.
In der Zeit seiner Abwesenheit hatte Ivans Großmutter, die nie das Dorf an der Seim verlassen hatte, keinen Tag an die Rückkehr ihres Mannes gezweifelt.
Schreiben konnte er ihr nicht, das war nicht seine Stärke. Diese hohe Kunst lernte er erst, wenn auch nur notdürftig, als erwachsener Mann in seinem Dorf unter dem neuen, kommunistischen Regime.
Dass er aber lebte und auch wiederkommen würde, daran zweifelte, mit der Großmutter, keiner in der Familie.
In der mehrjährigen Zeit seiner Gefangenschaft lernte der Großvater, zu jener Zeit noch ein verhältnismäßig junger, wissbegieriger Mann, das typisch ostpreußische Deutsch, welches er in all den Jahren danach jedoch nicht sprechen konnte. Gesprächspartner in dieser Sprache gibt es im Dorf nicht, ganz verlernt hat er sie aber nicht völlig. Diese angeeigneten Kenntnisse der deutschen Sprache sollen dem Großvater in der kommenden Zeit, ohne dass er es jetzt auch nur im Entferntesten ahnt, noch sehr von Nutzen sein.
Die Großmutter starb vier Jahre nach der Rückkehr des Großvaters aus der Gefangenschaft. Sie liegt nun auf dem kleinen Dorffriedhof, unter einem vom Großvater selbst gezimmerten Holzkreuz, begraben. Ivan kann sich an seine Großmutter nicht erinnern, sie starb ein Jahr vor seiner Geburt. Von ihren Kenntnissen in der Pflanzenkunde und verschiedenen Heilmethoden - frei nach der Natur - ohne die es in solch einem abgelegenen Dorf, weit und breit ohne Arzt, nicht geht, sprechen die Bewohner noch heute. Eine Nachfolgerin in diesem Metier hat sich leider in den moderneren Zeiten, unter den Frauen des Dorfes, nicht gefunden.
Von dem nun geflohenen Dorfsowjet, dem Herrscher über das kleine Dorf, wurde der Alte in den vergangenen Jahren zwar nicht belästigt, aber immer mit einem gewissen Misstrauen beobachtet. Die Kenntnisse über andere Lebensverhältnisse, die er in der Zeit seiner Gefangenschaft in Deutschland gemacht und sich sogar etwas angeeignet hatte, waren dem Vertreter der Sowjetmacht für die Lebensverhältnisse im eigenen Dorf suspekt und gefährlich. Er wagte es jedoch nicht, den Großvater der Parteileitung in Kursk wegen kleiner Vergehen zu melden, was für den Dorfsowjet eigentlich kein großes Problem gewesen wäre. Die Autorität des Alten und sein Rückhalt unter den Dorfbewohnern waren dazu doch zu stark. Mit seinen Kenntnissen über andere Lebensverhältnisse konnte und wollte er allerdings nicht viel bewegen. Die Bewohner waren mit ihren eigenen Problemen völlig ausgelastet und so sollte alles so bleiben, wie es war.
Der Einmarsch deutscher Truppen, der Heeresgruppe Mitte, in diesen Landesteil vollzieht sich in den nächsten Tagen schnell und fast geräuschlos. Vom Geschützdonner der vergangenen Tage war nicht mehr viel zu hören, er hat sich weiter nach Osten verschoben und ist an dem Dorf seitlich vorbeigegangen, ohne dass Kriegsschäden im Dorf zu vermelden waren.
Gelegentlich kracht aber noch ein Schuss in Dorfnähe und das Überfliegen der Flugzeugverbände in immer kürzeren Abständen verstärkt sich zunehmend. Anfang November wurde die zwanzig Kilometer entfernte große Stadt Kursk von den Deutschen eingenommen. Schwache Nachhutkräfte der Russen haben die Stadt eine kurze Zeit verteidigt, was die Deutschen veranlasste, große Teile der Stadt in Schutt und Asche zu legen. Sie wurde aus der Luft bombardiert und war sogar dem Häuserkampf ausgesetzt.
Was nun besonders schmerzt, ist der Nahrungsmangel bei der verbliebenen Bevölkerung. Bedingt durch die Kollektivierung war die Versorgung auf zentrale Punkte zusammengezogen worden. Nachdem diese zerstört worden waren, ist die gesamte Versorgung zusammengebrochen. Die Landbevölkerung ist da etwas besser dran, bleibt für die Selbstversorgung doch immer noch ein kleines Gartenstück und etwas Kleinvieh übrig. Für die Städter ist die Lage aber katastrophal. Die deutschen Besatzer denken gar nicht daran, die Stadtbevölkerung aus ihren Beständen zu versorgen, wenn diese nicht unmittelbare Dienste für sie erledigt.
An diesem Nachmittag, der Großvater ist in einem seiner alten, nur vom dämmrigem Licht erhellten, Schuppen mit dem Ausbessern der Gartengeräte beschäftigt, kommt der Dorfälteste Pantelej, der nun nach der Flucht des Dorfsowjet die erste Amtsperson im Dorf ist, in abgetragenen Filzstiefeln und einen mehrfach geflickten Mantel auf den Hof gehumpelt. Wegen der jahreszeitlich kühlen Witterung, hat er sich eine Pelzkappe aufgesetzt und die Seitenteile weit über die Ohren gezogen.
Er hört, als er den Hof betritt den Großvater hantieren, geht erst gar nicht ins Haus sondern gleich in den Schuppen, stellt sich neben ihn und tritt vor Ungeduld von einem Bein aufs andere.
Der Großvater hat ihn kommen gehört, lässt sich in seiner Beschäftigung aber nicht stören und hantiert ruhig weiter. Er weiß genau, wenn der Dorfälteste zu Besuch kommt, hat er immer etwas auf dem Herzen. Also lässt ihn der Alte noch etwas zappeln. Die Skorochodows sind weitläufig auch mit dem Dorfältesten verwandt, sowie fast alle Dorfbewohner von Schewerniwo in irgendeiner Weise miteinander verwandt sind. Diese nachbarschaftliche Nähe zueinander hat dazu geführt, dass sich die Alteingesessenen alle irgendwie ähnlich sehen. Das fällt besonders Fremden auf, wenn sie mehrere Dorfbewohner beieinander sehen. Außerdem: Der Großvater und der Dorfälteste haben zur Zarenzeit im gleichen Regiment gedient, sind aber bei den Kämpfen in Ostpreußen getrennt worden.
Die Auswahl zum Heiraten ist im Dorf nicht besonders groß. Kommt aber ein Fremder oder eine Fremde in die eingeschworene Gemeinschaft, dauert es oft Jahre, bis die Kluft überwunden und die Eingliederung gelungen ist.
Ivans Mutter, Irina, stammt aus einem nicht weit entfernten Ort mit einigen windschiefen Häusern und Bewohnern, von denen man nicht weiß, wovon sie ihren Lebensunterhalt beziehen. Ivans Vater hat Irina auf einer Versammlung kennengelernt und mit nach Schewerniwo genommen. Es war die so genannte Liebe auf den ersten Blick. Die beiden sahen sich an und waren sich umgehend einig, ein Leben miteinander zu gestalten. Der Dorfsowjet in Schewerniwo hatte die Vollmacht, sie zu trauen. Es fand eine kleine Familienfeier statt, nur mit einigen Nachbarn, dem Dorfältesten Pantelej mit seiner Familie, der zur Verwandtschaft gehört. Irina hatte am Anfang keinen leichten Stand. Nur mit Hilfe ihres Mannes und der überragenden Autorität vom Großvater, gelang ihr ein schneller Einstieg in die Dorfhierarchie. Man verstand allerdings im Dorf nicht, warum dieser so begehrte Junggeselle ausgerechnet eine Frau aus einem anderen Dorf ehelichte, gab es im Dorf doch genug heiratswillige Frauen, die ihn nicht abgewiesen hätten. Der Großvater half Irina bei der Einbürgerung, sah er doch nach dem Tod seiner Frau den dringenden Bedarf nach weiblicher Hilfe im Haus. Anfangs war der Beitrag des Alten zur Eingliederung in die Dorfgemeinschaft wohl etwas egoistisch gemeint, doch als er den wahren Charakter von Irina erkannte, schlug er schnell in stille Bewunderung um. Er kann sich ein Leben ohne seine Schwiegertochter nicht mehr vorstellen.
Einmal im Jahr wird es im Haus der Skorochodows turbulent. Dann hat Irina Namenstag und ihre Familie aus dem Heimatdorf trifft ein. Einen Teil des ausgeschenkten Wodkas bringen die Verwandten mit, der größere Teil kommt aus der Verkaufsstelle im Dorf. Die Verwandtschaft besteht meist aus sieben Personen, die selbst Irina nicht alle verwandtschaftlich einordnen kann. Das Haus ist nicht groß, aber für zwei Nächte Übernachtung reicht es doch. Irina ist dann vom frühen Morgen bis zum späten Abend ununterbrochen mit ihrer Verwandtschaft beschäftigt und froh, wenn diese Tage wieder vorüber sind. In diesem Jahr 1941 fand die Feier aus verständlichen Gründen nicht statt.
Der Dorfälteste, immer noch im Schuppen stehend, wird ungeduldig. „Na, Mitka Skorochodow wie geht’s? Das wird ein Winter, wie wir ihn schon lange nicht mehr hatten. Ich kann mich da noch an den Winter im Jahre....“. Früher redeten sie sich stets mit Väternamen an, das änderte sich mit der Revolution.
„Nun hör schon auf, herum zu schwafeln. Du hast doch etwas auf Lager, was du loswerden willst. Wie solls schon gehen? Immer so dahin. Nun los, sag’s schon, was hast du Besonderes auf dem Herzen?“
„Na ja, die Deutschen sind nicht mehr weit. Der Lärm und das Geschützfeuer kommen immer näher, ist ja schon vorbeigezogen. Lange kann es nun nicht mehr dauern und sie sind hier im Dorf. Wie stellst du dich dazu?“
„Wie soll ich mich schon dazu stellen. Verhindern kann ich es ja doch nicht. Soweit ich orientiert bin, sind sie sogar schon da. Kursk soll ja schon gefallen sein.“
„Hast du Nachricht von deinem Sohn erhalten?“
„Keine Nachricht. Du weißt doch wie es mit Nachrichten aussieht. Aber sag, was willst du, was hast du auf dem Herzen? Du kommst doch nicht ohne Grund. Der Wodka steht bei meiner Schwiegertochter unter Verschluss, aber für eine Tasse Tee wird die Zeit schon reichen.“
„Nein, lass man, später mal. Na ja, du weißt schon, wenn jetzt die Deutschen kommen, muss sie doch jemand begrüßen. Du bist der Einzige im Dorf, der sich mit den Deutschen unterhalten kann.“
„Und was habe ich mit den Deutschen zu tun. Über was soll ich mich mit denen schon unterhalten? Und außerdem, du bist doch Dorfältester. Es ist doch deine Aufgabe zur Begrüßung anzutreten, wenn du meinst, dass sie erforderlich ist. Um die zu begrüßen, braucht man keine besonderen Kenntnisse. Du stellst dich an den Straßenrand, hältst Brot und Salz bereit, machst ein freundliches Gesicht und alles andere wird sich finden. Entweder die Deutschen knallen dich ab, oder nehmen dein Geschenk an. Du bist der Repräsentant des Dorfes.“
„Was bin ich schon für eine Respektperson und ein Repräsentant schon gar nicht. Dorfältester bin ich nur geworden, weil der Dorfsowjet getürmt ist. Außerdem bin ich von den Alten der Einzige, der ein wenig schreiben und lesen kann und der, dem man nicht vorwerfen kann, besonders viel für den Kommunismus getan zu haben. Aber du könntest sie begrüßen, mit Salz und Brot am Ortseingang stehen. Es muss ja nicht aus Freude über ihr Kommen sein, aber fürs Dorf wäre es doch bestimmt nützlich und wir würden dir sehr dankbar sein.“
Plötzlich ist Geschrei zu hören. Während die beiden Alten noch im Schuppen stehen, läuft aufgeregt der alte, schon ganz in sich zurück gewachsene Valerie, der Trottel des Dorfes, die schlammige Dorfstraße entlang und ruft mit seiner krächzenden und vom häufigen Wodka trinken entstellter Stimme: „Die Deutschen, die Deutschen!“ Er zeigt dabei mit seinen schmutzigen Fingern über seine Schultern, so als würde der Feind sich schon direkt hinter ihm befinden.
An den Zäunen entlang der Straße versammeln sich die Frauen, wie auch die noch verbliebenen alten Männer des Dorfes. Es sind meist nur noch Frauen und die ganz Alten des Dorfes, nur einige, wenige jüngere Männer, die plötzlich wieder aufgetaucht sind, sich den abrückenden russischen Einheiten aus verschiedenen Gründen nicht angeschlossen haben, stehen unter den Schaulustigen. Es sind Kranke und Körperbehinderte dabei, die nicht einmal eine leichte Waffe tragen können.
Der Dorfälteste wendet sich wieder an den Großvater, beide sind an die Dorfstraße getreten, sie haben den Trottel im Schuppen gehört:
„Nun, wie ist es, ich glaube, der alte Trottel hat sie irgendwo gesehen. Gehst du nun hin, wenn sie kommen?“
„Ja, ich gehe, wenn kein anderer geht. Aber nicht allein. Ich nehme Ivan mit. Und dann will ich dir noch etwas sagen. Ich gehe da nicht hin, weil ich mich freue, dass die Deutschen kommen, sondern, weil ich glaube, dass ich damit nicht nur dir, sondern dem ganzen Dorf einen Gefallen tue. Auf kriegerische Taten können wir uns nicht einlassen. Wir sind schließlich keine Soldaten und Waffen, ich meine, richtige Waffen mit denen man Krieg machen kann, gibt es, so wie ich es weiß, im ganzen Dorf nicht eine einzige. Ich will nicht, dass mir dieser Gang eines Tages angerechnet wird.“
„Meinetwegen nimm mit, wen du willst, aber sieh zu, dass du zum Ortseingang kommst, bevor sie im Dorf sind. Ich verstehe schon, was du meinst.“
Der Großvater geht ins Haus zurück, während der befreit aufatmende Dorfälteste durch den Schlamm auf der Straße zu seinem Haus zurück humpelt.
Ivans Mutter war in der Zwischenzeit, während die beiden Alten sich unterhielten, aus dem Haus getreten und hat die letzten Worte des Gesprächs der beiden am Gartenzaun mit angehört. Schnell eilt sie zurück ins Haus und berichtet dem noch am Tisch sitzenden Ivan vom Entschluss des Großvaters, was der mit überraschtem Gesichtsausdruck zur Kenntnis nimmt. Auf ein sauberes Holzbrett legt sie ein kleines rundes, gerade erst gebackenes Brot, rundum mit einen geflochtenen Kranz aus Teig und daneben ein Keramikschälchen mit grobem Salz.
Ächzend, schwer atmend zieht der Alte seine dicke Winterjacke an und setzt die Pelzkappe auf. In der Zwischenzeit hat sich auch Ivan mit einer dicken Jacke, seiner Fellmütze und den Filzstiefeln vollständig angekleidet und so machen sie sich auf den kurzen Weg zum Ortseingang.
Am schiefhängenden Tor zu ihrem Anwesen bleibt der Alte stehen. „Das reparierst du noch am Nachmittag. Es ist ja eine Schande wie das aussieht. Was sollen die Deutschen von uns denken?“
Ivan balanciert vorsichtig auf dem trockenen, seitlichen Wegstreifen und hält das mit einem Tuch, in dem die Begrüßungsgaben eingewickelt sind, bedeckte Brett vor sich, kann aber nicht verhindern, dass seine Füße immer wieder im Schlamm einsinken. Der Großvater, sich seiner wichtigen Aufgabe voll bewusst, geht aufrecht und weder nach links noch nach rechts blickend, hinter Ivan her. Am anderen, entgegengesetztem Ende des Dorfes, neben dem letzten Haus, bleiben sie stehen und schauen zur Einmündung der nach Kursk führenden Hauptstraße. Niemand ist zu sehen. Der Himmel ist mit dichten Schneewolken bedeckt, von Osten her weht ein feuchter, kühler Wind. Seitlich auf dem leeren Acker hat sich ein Schwarm Krähen niedergelassen und lässt sich durch die Wartenden bei der Futtersuche nicht stören.
Der Großvater versucht, verdeckt mit seiner Jacke, sich eine selbst gedrehte Zigarette anzuzünden. Es gelingt ihm nicht, ärgerlich stopft er sie wieder in seine Tasche.
„Ob sie überhaupt kommen. Vielleicht hat Valerie, der Trottel, in seinem besoffenen Kopf auch nur Gespenster gesehen.“
„Sie werden schon kommen. Wenn sie Kursk haben, sind sie auch bald hier. Einen wahren Teufel sollen sie als General bei ihren Panzern haben. So wie ich es gehört habe, soll er Guderian heißen, oder so ähnlich. Du hörst doch, dass das Donnern der Geschütze weiter gezogen ist. Zu unserem Glück am Dorf vorbei, und lass den Valerie ruhig auch nicht ganz dicht im Kopf sein, gesehen hat der bestimmt die Deutschen.“
Ivan sehnt sich nach der warmen Stube zurück und bedauert schon, überhaupt mitgegangen zu sein. Doch gegen den Großvater hätte er sich doch nicht verweigern können.
Da sind von der Landstraße her Motorengeräusche zu hören. Der Großvater wird hellwach und schaut angestrengt in die Richtung, aus der die Geräusche zu hören sind. Das Geräusch erstirbt hinter einer Anhöhe und wieder breitet sich die Stille über die Landschaft aus. Aus dem Dunst des Frühnebels sehen der Großvater und Ivan nun einige Gestalten auf sich zukommen.
„Die Deutschen.“ Ivan flüstert die Worte.
Der Großvater tritt unruhig von einem Bein auf das andere und kaut nervös auf den Enden seines Bartes. Die näher tretenden Gestalten sind jetzt gut zu erkennen. Es sind zehn Soldaten, die mit vorgehaltenen Waffen an die beiden Wartenden herantreten.
Ivan macht eine hastige Bewegung, als er dem Großvater das Tuch mit den eingewickelten Begrüßungsgaben reicht, was dem vordersten der Soldaten veranlasste, sofort seine Maschinenpistole in Ivans Richtung zu halten.
„Deutsche gutt, wir nix Feind.“ Der Großvater wickelt schnell das kleine Brot aus dem Tuch, Ivan hält mit seiner frostklammen Hand den Topf mit Salz hin.
Die Soldaten treten näher an die beiden Abgesandten des Dorfes, so dass Ivan die ersten Deutschen in seinem Leben nun genauer betrachten kann. Etwas enttäuscht stellte er fest, dass er eigentlich heldenhaftere Gestalten erwartet hatte.
Die nun vor ihm stehen, in fast sommerlicher Bekleidung, in Lehm und Dreck beschmierten Lederstiefeln und den mit Tuch bespannten Stahlhelmen können doch kaum die sein, vor denen seine eigenen Landsleute, auch sein Vater und Bruder, geflüchtet sind. Aber die erste Überraschung ist schnell überwunden. Einer der Soldaten nimmt verlegen das Brot und hält es unschlüssig in seinen von der Kälte roten und klammen Händen, stopft es in die Tasche seiner Uniformjacke, sagt aber kein einziges Wort. Das Salz lässt er unbeachtet.
Der Großvater kramt blitzschnell in seinem Gedächtnis nach weiteren deutschen Worten.
„Hier alles gutt. Nix Soldaten. Alle weg.“ Dabei macht er eine weit ausholende Handbewegung, über das Dorf hinweg nach Osten.
Der Soldat, der das Begrüßungsbrot in seiner Tasche gestopft hat, geht um die beiden Abgesandten herum und gibt den anderen ein Zeichen ihm zu folgen. Sie marschieren durch den schlammigen Boden der Straße in Richtung Dorf. Nur der Vordere trägt eine Maschinenpistole, seine Kameraden sind mit Karabiner bewaffnet, die sie etwas nachlässig im Anschlag halten.
Ivan steht mit seinem Salztopf völlig unbeachtet noch immer auf der Stelle und zwischen den dichten, zusammengewachsenen Augenbrauen des Großvaters bildet sich eine Falte, die seinen Unmut über diese Begrüßung deutlich zum Ausdruck bringt. Beide schauen hinter den Soldaten her und machen sich auf den Weg, ihnen zu folgen. Die sowieso nicht euphorische Stimmung des Alten ist durch den kühlen, wortlosen Empfang der Deutschen auf dem Tiefpunkt angelangt.