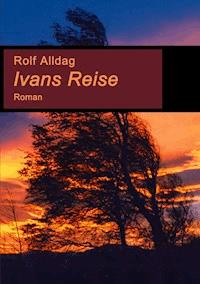Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Deutschland nach der furchtbaren Katastrophe in seiner Aufbauphase. Mit dem( fast) autobiografischen Roman hebt der Autor für einen Moment die Anonymität auf, und erzählt auf wunderbarer und realistischer Weise nicht nur seinen Weg zum Erwachsenwerden, sondern auch den Weg seiner Familie, seiner Freunde und vieler, die ihn auf seinen Lebensweg begleitet haben. Es ist auch ein Führer durch die Zeit nach dem furchtbaren Krieg mit all seinen Folgen. Der Neuaufbau mit den Konsequenzen für die sogenannten kleinen Leute und den Willen, aus einer begrenzten Lebensweise heraus ein Leben zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
I
Vom geschäftigen Leben habe ich mich nicht abgewandt, ich lebe nur seit einiger Zeit allein. Wenn ich sage nicht abgewandt, so meine ich damit, dass ich durchaus Umgang mit Bekannten aus meiner näheren Umgebung pflege. Mein unmittelbarer Hausnachbar, ebenfalls ein Ruheständler wie ich, war im Arbeitsleben Polizeibeamter in der Kreisstadt. Ich kann mich entsinnen, dass er was von Kripo gesagt hat. Ich besuche ihn und seine Frau hin und wieder. Wir trinken dann eine Flasche Wein, worin er ein wirklicher Kenner zu sein scheint. Er hat einen Weinkeller der sich sehen lassen kann. Natürlich zeigt er den keinen außer mir. Ich trinke zwar auch hin und wieder ein Gläschen, manchmal auch etwas mehr, aber daraus solch einen Kult zu treiben wie mein Nachbar, das fällt mir nicht ein.
Gelegentlich besuche ich auch unsere meist gut besuchte Dorfkneipe, trinke dort ein oder zwei Biere und unterhalte mich mit den Leuten. Hierher, zu mir ins Haus, lasse ich jedoch außer meine Putzfrau, die auch gelegentlich für mich einkaufen geht, niemand. Die ältere Dame kontrolliert den Kühlschrank, prüft den Bestand und sichert somit meine Ernährung. Meine Verwandtschaft ist weitläufig, aber von meinem jetzigen Wohnort doch weit entfernt. (was man durchaus auch positiv sehen kann). Das Haus, in dem ich nun wohne, habe ich erst gemietet, dann vor einigen Jahren von einer alten Dame im Dorf gekauft und mit den Möbeln meiner verlassenen Stadtwohnung ausgestattet. Von der Umgebung, in der ich nun lebe kann ich nicht viel berichten. Wenn das Wetter es in nächster Zeit erlaubt, werde ich mich weiter in der Gegend umsehen. Das Alleinsein bereitet mir keine Probleme, ich bin es gern. So hätte es auch an diesem einen Tag sein können, aber es kam anders. Davon möchte ich nun hier berichten.
Als es am Vormittag an der Haustür klingelt, bin ich versucht, nicht zur Tür zu gehen. Besuch war an diesem Tag nicht zu erwarten, es hatte sich auch niemand angekündigt. Das Telefon, selbstverständlich habe ich eines, hat keinen Ton von sich gegeben. Seit einiger Zeit habe ich es so eingerichtet, dass Besucher sich vorher bei mir anmelden, ich habe mich, wie es so heißt, von der Welt etwas zurückgezogen, lebe allein in meinem Haus und fühle mich auch ganz gut aufgehoben. So ganz unbeweibt und allein bin ich natürlich nicht durch das lange, nun zurückliegende, Leben gegangen, aber das ist alles lange her und hat jetzt keine Bedeutung mehr. Davon erzählen will ich aber erst später. Aber auch warum ich das alles, was jetzt kommt erzählen will.
Dass es an diesem Morgen schon mehrfach an der Tür geklingelt, habe ich ignoriert, bin gar nicht aufgestanden und im Bett liegen geblieben. Schon am Vorabend hatte ich das Gefühl krank zu werden, konnte mein Unwohlsein aber keiner Krankheit zuordnen. Außerdem, ich wohne weit vom nächsten Arzt entfernt, ganz am Rand der kleinen Ortschaft, mehr ein Dorf, das ich mir als sogenannten Alterssitz ausgewählt habe und ein Auto, um in den Ort zu kommen, habe ich nicht mehr. Nicht dass ich mich zum Fahren zu alt fühle, ich will es einfach nicht mehr. Mit meinem Eintritt in das Rentnerleben, zwischenzeitlich habe ich das achtzigste Lebensjahr überschritten, was sich auch immer eindringlicher bemerkbar macht, da war es auch bei mir mit dem Autofahren vorbei. Einige tausend Kilometer waren es sonst im Jahr. Fast einmal um die Erde. Nun ist Schluss damit. Meinen Beruf habe ich eigentlich ganz gern ausgeführt. Meiner Sekretärin, in den letzten Tagen meiner beruflichen Tätigkeit, hatte ich die Versicherung abgegeben, dass ich nun für Wochen im Bett bleibe. Na ja, wenigstens für eine Woche. Es ist aber nichts daraus geworden, irgendetwas kam immer dazwischen. Die wenigen Gänge, die nun zu machen sind, erledige ich zu Fuß. Bekannte haben mich schon oft gefragt, ob ich mich in meiner Höhle, so nennen sie mein Haus, langweile. Ich konnte sie beruhigen; ich habe keine Langeweile, habe sie in meinem langen Leben nie gehabt, nicht einen einzigen Tag. Hier, um mich herum stehen Bücher, ohne die ich gar nicht leben könnte und die seit ewigen Zeiten darauf warten endlich gelesen zu werden und irgendwelcher Kleinkram, den ich so am Wege aufgesammelt habe. Außerdem habe ich Erinnerungen die mich begleiten. Von Langeweile ist hier nichts zu spüren. Meine Welt besteht aus vertrauten Dingen. Nach einem Leben voller Siege und Niederlagen, in dem ich Menschen glücklich und bestimmt auch einige unglücklich gemacht habe, ist nun die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit gekommen.
Doch dieses Klingeln an der Tür lässt nicht nach. Etwas mühsam angele ich mir den Morgenmantel vom Haken, durchquere in den Latschen schlurfend das Wohnzimmer und bin an der Tür. Durch den Türspion sehe ich einen wahren Riesen vor der Tür stehen, kann das Gesicht im Schatten des Überdaches aber nicht erkennen. Erst bin ich versucht wieder zurückzugehen, doch dann siegt die Neugier und ich öffne die Tür. Die hohe Gestalt hatte sich schon wieder von der Tür abgewandt und war im Begriff zur Straße, zum Eingangstor zurück zu gehen. Als ich die Tür mit quietschendem Geräusch öffne, kommt der Mann mit schnellen Schritten zurück.
„Ich dachte schon, du bist gar nicht zu Haus. Bernd ist mein Name. Vielleicht erinnerst du dich an mich, ich bin dein Neffe. Meine Mutter, deine Schwester, hat mir deine Anschrift gegeben und, da ich gerade in dieser Gegend bin, wollte ich dich unbedingt besuchen. So schnell komme ich hier in der nächsten Zeit nicht wieder vorbei.“
Mit diesen Worten reicht er mir seine große, feste Hand zum Gruß. Ich nahm sie gerne an.
Das also war ein Neffe von mir, von dem ich nicht mehr viel in der Erinnerung behalten hatte. Zu überlegen, von welcher Tante oder Onkel er herstammen könnte, dazu blieb mir im ersten Moment keine Zeit. Doch dann fiel es mir blitzartig ein und ich erkannte, oder glaubte ihn wieder zu erkennen. Meine noch lebende Schwester, seine Mutter, kannte ich mehr von Hörensagen, ich habe sie über einen leider viel zu langen Zeitraum nicht mehr gesehen und auch keinen Kontakt gehalten. Woran diese Entfremdung lag, weiß ich nicht mehr, sie liegt bei uns wohl in der Familie.
„Komm rein. Bei mir sieht es etwas unordentlich aus, die Frau aus dem Dorf kommt erst morgen zum Saubermachen. Also, komm rein und sieh dich nicht so genau um.“
Ich habe nur so nebenbei erwähnt, dass es auch in meinem Leben eine Frau gegeben hat. Oben nur ganz kurz angesprochen. Aber, seit sieben Jahren bin ich Wittwer. Meine Frau, mit der ich drei Kinder, zwei jungen und ein Mädchen habe, ist an einer rätselhaften Krankheit verstorben. Ich will darüber nicht viel von mir geben. Eigentlich gar nichts. Doch wieder zurück zum heutigen Tag. Von meinen Kindern will ich später mehr erzählen.
Von meiner ersten Überraschung habe ich mich schnell erholt, schon auf dem kurzen Weg, von der Haustür zum Wohnzimmer kam doch so etwas wie Freude in mir auf. Gerade an diesen Neffen habe ich in der Vergangenheit oft gedacht. Sein Lebensweg, das war mir bekannt, war nicht einfach, er war wahrhaftig nicht auf Rosen gebettet, wie man so sagt. Aber, ganz offensichtlich hatte er seinen beruflichen Weg gemacht, das hatte ich in der Vergangenheit doch in Erfahrung gebracht.
„Setz dich her, ich gehe ins Bad und bin gleich wieder da. Gefrühstückt hast du schon?“
„Nein, noch nicht. Ich hatte noch keine Zeit. Im Hotel, in dem ich abgestiegen bin, gab es zur Zeit meiner Abfahrt noch nichts. In einer Stunde habe ich hier, ganz in der Nähe einen Termin. Vorher wollte ich dich aber besuchen.“
„Weißt du was, ich mache uns jetzt auf die schnelle ein spätes Frühstück, du nimmst Deinen Termin war und kommst danach wieder her. Ich freue mich wirklich dich zu sehen.“
Meinem Neffen sieht man die Zufriedenheit an, als ich ihm den Vorschlag machte.
„Wenn es dir keine Umstände macht, bin ich gern heute, am späten Nachmittag wieder hier. Aber, mach dir keine Umstände. Ich will deinen täglichen Ablauf nicht stören. Ich frühstücke an dem Ort, wo unsere Besprechung stattfindet.“
Mit diesen Worten stand er auch schon wieder auf und war mit wenigen Schritten an der Tür.
„Ich bin bald wieder da.“
Damit klappte die Haustür zu und ich hörte ein Auto abfahren.
Dieser kurze Besuch hat meinen täglichen Ablauf nun doch etwas durcheinander gebracht. Natürlich freute ich mich gerade diesen jungen Verwandten wieder zu sehen. Einiges über seinen Lebensweg war mir zu Ohren gekommen und das war durchwegs positiv, obwohl sein Start ins Leben alles andere als rosig war. Aber, ob er verheiratet war und eine Familie hat, das war mir nicht bekannt und so freute ich mich auf den Nachmittag, neugierig war ich schon und eine Abwechslung im täglichem Einerlei war es außerdem.
Einen Blick in den leeren Kühlschrank und ich machte mich nun selbst auf den Weg ins Dorf, um ihn etwas aufzufüllen. Bis meine Haushaltshilfe morgen kommt, konnte ich nun nicht warten.
Die Zeit bis zu seiner Rückkehr verging wie im Fluge. Die Sonne stand noch hoch am Horizont, es war früher Nachmittag, da rollte ein Auto vor die Eingangspforte und mein Neffe war wieder da. In der Hand trug er eine Einkaufstüte, an der zu erkennen war, dass der Inhalt aus Flaschen bestand. Unsere Begrüßung war kurz aber herzlich.
„Ich habe mich frühzeitig aus der Besprechung verabschiedet, was noch an Themen kam, hat mich ohnehin nicht mehr interessiert. Alles nur Nebensächlichkeiten. Ich denke, wir können uns einen schönen Nachmittag und Abend machen, wenn du nichts anderes vorhast.“
„Nein, ich habe nichts vor. Wenn du nicht unbedingt im Hotel schlafen musst, kannst Du es ebenso hier, bei mir. Ich wohne zwar nicht gerade komfortabel, wie du siehst, aber ich denke für einen Schläfer findet sich auch hier ein Platz. Wann musst du wieder nach Haus?“
„Zeit habe ich schon. Da ohnehin Wochenende ist, fällt die Firma aus. Familie habe ich nicht. Noch nicht. Also, es wartet auch niemand auf mich.“
Mit dem Blick auf seine mitgebrachte Flaschentüte war mir klar, dass er den Nachmittag auf jeden Fall bei mir und mit mir verbringen wollte. Er nahm mir aber weitere Überlegungen, wie wir den Rest des Tages verbringen konnten, ab.
„Ich habe einige Flaschen Bier mitgebracht, wir könnten uns einen schönen Nachmittag machen. Verträgst du in deinem Alter noch Alkohol?“
„Wenn du hier bleibst und kein Auto mehr anrührst, können wir daraus eine Flasche leeren. Über meine Gesundheit lieber Neffe, mach dir bitte keine Gedanken.“ Klar war ich etwas pikiert über seine Anspielung auf mein Alter und den Alkohol.
Da die Sonne noch Kraft hatte und meine kleine Terrasse hinter dem Haus im vollem Licht lag, schleppte ich einige Kissen zu den Stühlen, mein Neffe brachte die Flasche und ich holte die Gläser.
Nachdem er eingeschenkt hatte, machten wir es uns bequem und ich fühlte mich in seiner Gegenwart, trotz der kurzen Zeit unseres Beisammenseins wieder richtig wohl.
„Wie soll ich dich eigentlich nennen? Du bist zwar mein Onkel, aber bei jeder Anrede den Onkel rauszulassen, fällt mir doch etwas schwer.“
„Ich bin zwar der Ältere, ganz ohne Zweifel, aber ich habe ebenfalls schon daran gedacht. Sag einfach Rudi zu mir. Das ist dann in Ordnung.“
„Danke, ich weiß das zu schätzen. Aber, wenn wir uns in dieser kurzen Zeit soweit näher gekommen sind, will ich dir auch nicht verhehlen, dass mein Besuch bei dir nicht so ganz selbstlos erfolgt ist. Wie du sicher weißt, haben wir noch einen Verwandten in Bremen. Vor etwa einem Jahr war ich bei ihm, genauso überraschend wie jetzt bei dir und er hat mir eine Idee in den Kopf gesetzt, die ich einfach nicht wieder loswerde. Von unserer gemeinsamen Familie hat er erzählt. Vielleicht kennst du ihn genauer, aber der hat ein Redetalent, das hat mich einfach begeistert. Aber, ganz so viel konnte er mir von der Familie dann doch nicht erzählen. Er sagte ich soll dich suchen und besuchen, du könntest mir mehr erzählen.“ So ein richtiges Redetalent habe ich bestimmt ebenfalls nicht, aber auf Grund meines Alters und eines ausnehmend immer noch gutem Erinnerungsvermögens kenne ich natürlich unsere weitverzweigte Verwandtschaft sehr gut und könnte ihm einiges erzählen. Im ersten Moment war ich aber mehr zur Abwehr geneigt. Dass sich jemand für unsere Familiengeschichte interessiert war mir neu und überraschte mich völlig, zumal Bernd noch gar nicht das Alter hat, im dem die Familiengeschichte von Interesse ist.
Flaschenöffner und Gläser waren bereit. Bernd machte sich daran eine Flasche zu öffnen und schenkte ein.
„Ich habe zwar vorhin gefragt, ob du Alkohol trinkst. Aber ein Glas kann bestimmt auch in deinem Alter nicht schaden.“
Etwas pikiert war ich immer noch, wegen der erneuten Anspielung auf mein Alter.
„Mach dir wegen meines Alters keine Gedanken. Du hast schon einmal danach gefragt. Klar trinke ich ein Glas und von mir aus auch ein weiteres auf unser Zusammenkommen. Prost, auf deinen Besuch, wenn er auch mit einen Zweck verbunden ist. Klar, ich kann dir von der Familie erzählen, aber was willst du mit den Erkenntnissen anfangen? Hast du vor ein Buch zu schreiben? Da muss ich dich enttäuschen, so spannend ist und war das alles nicht. Außerdem, es ist schon schwierig zu beginnen. Soll ich in der Mitte beginne oder am Anfang oder vielleicht vom Ende nach vorn?“
„Ja, vielleicht schreibe ich einmal. Ich habe eine wunderbare Frau kennen gelernt. Sie schreibt selbst an einem Gedichtband. Wir haben lange über unsere, also meine Familie gesprochen und sie meinte, dass hier der Stoff für einen ganzen Roman verborgen liegt. Sie und der Onkel in Bremen haben in meinem Kopf etwas hinein gesetzt, was ich nicht wieder loswerde. Wenn du mir hilfst und meine Bekannte, ich sage lieber: meine Braut, noch dazu, dann könnte aus meiner Idee doch vielleicht etwas werden.“
Wir haben unsere Gläser ausgetrunken, als er nachschenken wollte hielt ich die Hand auf mein Glas.
„Es ist hier draußen bereits zu kalt geworden und wir gehen in mein Wohnzimmer. Hier richten wir uns ein und die Gläser können dann erneut gefüllt werden.“
Ich bin nun langsam aber stetig, bedingt durch das Bier, das nicht von schlechter Qualität ist, langsam in eine gute Stimmung versetzt und freue mich weiter aufrichtig über den unverhofften Besuch. Meine selbstgewählte Einsamkeit für einige Zeit aufzugeben bedeutet mir nun gar nichts mehr und es ist völlig klar, dass mein Neffe die Nacht über bei mir bleibt. Also, kommt umgehend noch eine weitere Flasche auf den Tisch.
„Also, mein lieber Bernd, wenn ich dir von unserer gemeinsamen Familie erzählen soll, muss ich erst einmal fragen wie du das alles im Kopf behalten willst? Machst du Dir Notizen oder hast du solch ein gutes Gedächtnis, das du alles behältst? Außerdem, wenn ich von der Familie erzähle, steht meine eigene Person natürlich ganz im Mittelpunkt. Das hat wenig mit mir zu tun, sondern ganz einfach von der Sache her. Ich kann alles nur so erzählen wie ich es erlebt habe und die Familie ist dann dabei.“
„Erzähl einfach nur, das Wichtigste werde ich sicherlich behalten. Außerdem, ich bin zwar gekommen um etwas über die Familie zu erfahren, aber der Hauptgrund ist der; ich wollte dich kennen lernen. Ich sagte ja schon, dass ich jemand kennen gelernt habe und dabei bin, nun selbst eine Familie zu gründen.“
Ich nahm einen tiefen Zug aus meinem Glas, lehnte mich im Sessel bequem zurück und wandte mich ihm wieder zu.
„Na gut, dass dein Interesse der Familiengeschichte zugewandt ist höre ich natürlich gern, aber dass du so viel im Gedächtnis behalten kannst, ist zu bezweifeln. Ich mache dir daher einen Vorschlag. Wir unterhalten uns heute und dabei kannst du mich über verschiedene Dinge befragen. Wenn du wieder weg bist, ich habe ja viel Zeit, setze ich mich hin und schreibe das auf, was in meiner Erinnerung noch vorhanden ist. Steht der Text, treffen wir uns hier wieder und lesen oder besprechen alles in Ruhe durch.
Ich mache mir diese Sache aber noch einfacher. Unten im Schrank steht ein Computer. Ich hole ihn wieder ans Tageslicht. Zeit habe ich ja ausreichend. Also, setze ich mich hin und bringe das hinein, was mir einfällt. Dass ich das aber nicht in Romanform kann, ist doch hoffentlich klar. Alles was ich niederschreibe bekommst du und kannst dann damit machen was du willst. Bist du damit einverstanden?“
„Ja, natürlich bin ich mit deinem Vorschlag einverstanden. Du hast einen Computer?“
„Hab ich, er steht verpackt in einer Ecke. Wenn ich das Gerät auch kaum noch in Tätigkeit habe. Ich bin auch nicht besonders schnell im Schreiben, habe aber zum Glück auch keine besondere Eile. Wenn ich nun aber wieder damit schreibe, werde ich vielleicht geübter und etwas schneller. Mit meiner Rechtschreibung musst du aber vorlieb nehmen, dafür hatte ich im Berufsleben meine Schreibdamen. Beim Lesen des dann von mir geschriebenen Textes musst du aber beachten, dass ich kein Literat bin. Was ich in den Computer bringe ist aus meinem Gedächtnis geschrieben, so wie es mir, vor vielen Jahren erlebt, nun wieder einfällt.“
Mit diesen Worten beschlossen wir das Thema und verlebten noch einen angeregten Abend mit Gesprächen über die verschiedensten Dinge des Lebens. Am frühen Morgen war mein Neffe wieder verschwunden. Ich machte mich nun an die Arbeit, wobei Arbeit wohl nicht das geeignete Wort für diese nun beginnende Tätigkeit das richtige Wort ist. Am Beginn hatte ich tatsächlich meine Probleme. Meine sporadische Tätigkeit mit solch einem Gerät liegt nun auch bereits einige Jahre zurück. Mühsam suchte ich auf der Tastatur die Worte und bildete Sätze, die ich aber wieder verwarf. Was auf solch einem Gerät ja kein Problem bedeutet.
Aber dann wurde es doch besser und ich denke, dass nun alles gut lesbar ist. Wenn nicht, kannst du mich über alles befragen und so steht es jetzt hier geschrieben. Doch, wo fange ich an, wo höre ich auf?
Irgendwann kommen einem ja die Erinnerungen an frühere Zeiten. (Ich meine hiermit mich selbst) Sie kommen wie dunkle Punkte aus der fernsten Erinnerung durch die Luft geflogen, setzen sich fest und blühen zu den schönsten auf, was man sich denken kann. Manchmal nur durch einen ganz nichtigen Anlass. Mir geht es nun so. Der Gedanke, alles noch einmal in meine Erinnerung zurückzuholen hat aber auch etwas Faszinierendes. Man wird zurückgeführt in eine Welt, von der man lange nichts gehört und nicht gedacht hat und die doch in einem selbst noch vorhanden ist. Und so beginne ich eben mit meiner Geschichte.
Vielleicht ist dir die Straße bekannt, warst schon einmal dort, in der wir, ich meine hiermit, wo meine Familie, die ja auch im weitesten Sinne unsere gemeinsame Familie ist, gelebt hat. Es war eine Prachtstraße. Eigentlich schon mehr eine Allee. Große, wirklich alte Platanen fassten eine mittlere, breite Fahrbahn ein, die uns Kindern der angrenzenden Häuser ausreichend Platz zum Spielen gab. Das Alter und die Größe der Bäume passten irgendwie nicht zum Alter der Häuserreihen. Autos, für die diese Prachtstraße gedacht war, gab es in der Zeit, von der ich nun erzähle, nicht. Es war so, dass man annehmen konnte, sie – die Autos- waren noch gar nicht erfunden. An bestimmten Plätzen standen, der schlimmen Zeit entsprechend, ausgeräumte Schrottwagen, doch davon will ich erst später etwas schreiben. An den Seiten führten einspurige Fahrbahnen den wenigen Verkehr mit Fahrrädern und Karren vorbei, dann kam der breite Fußweg mit den mehrgeschossigen, roten Klinkerbauten. Die Pläne zum weiteren Ausbau der Straße lagen wohl vor, der unselige Krieg verhinderte jedoch die Ausführung und so endete unsere breite Prachtstraße am Ende in einer Schrebergartenkolonie. Hinter der Straße und den Gärten kam noch ein kleiner Wald, auf den dann nur noch Felder und Wiesen folgten. Für uns Bewohner der Straße war die Stadt und somit auch die Welt in dieser Himmelsrichtung zu Ende. Zur anderen Seite hin wurde die Allee zum anderen Stadtteil von der schmalen Durchfahrt einer Eisenbahnbrücke in der Breite regelrecht eingeschnürt. So war sie über viele Jahre hinweg ein Torso.
Die zu beiden Seiten der Straße stehenden Häuser galten in der Mitte der 30er Jahre noch als Neubauten, hatten aber trotz der vielen kinderreichen Familien nur, nach unseren heutigen Begriffen, winzig kleine Wohnungen. Unser Land wurde in diesen Zeiten durch bestimmte Maßnahmen immer größer, die Lautstärke der Politiker immer lauter und der Führer dieses Landes immer furchtbarer. Aber, unser Leben blieb klein und unscheinbar. Der Vater ging jeden Tag seiner Arbeit nach, unsere Mutter umsorgte uns, Wünsche, in die Welt hinaus zu wollen, waren nicht vorhanden.
An einem kalten, eisigen Wintertag, so wurde mir das später gesagt, an einem Montag (das konnte ich später nachlesen) wurde ich in dieser Straße, im Schlafzimmer unserer Wohnung geboren. Besondere Ereignisse fanden an diesem Tag nicht statt. Der „Führer“ hielt an diesem Tag wieder eine seiner Reden, die unser Vater ganz sicher gehört hat. Denke ich in diese Jahre zurück, setzte mein Erinnerungsvermögen ein und einige Details erschließen sich mir.
So kann ich mich zum Beispiel an die beengten Räumlichkeiten in dieser Wohnung noch einigermaßen gut erinnern. Eine kleine Küche, ein Toilettenraum, von Badezimmer konnte man nicht sprechen (Bademöglichkeiten gab es außer der kleinen Zinkwanne in der Küche nicht), dann folgten ein schmaler Flur und ein Schlafzimmer in der üblichen Ausstattung. Wie das Leben und Schlafen bei so vielen Personen in ruhigen Bahnen möglich war, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber irgendwie muss es ja funktioniert haben. Dass es eng war, wurde mir erst viel später bewusst, als die Wohnungen größer und die Familien immer kleiner wurden.
Im April des Kriegsjahres 1943 wurde meine Schwester, deine Mutter, in einer Klinik in unserem Stadtteil geboren, so dass wir nun mit Vater, Mutter, meinem bereits vor mir geborenen Bruder, meiner Schwester und ich, zu fünft in dieser kleinen Wohnung lebten. Ein leichter Beginn wurde deiner Mutter mit diesem Geburtsjahr leider nicht beschert. Besonders im Jahr ihrer Geburt erlebte unsere Stadt ein Inferno. Die Geburt und ihre ersten Lebensjahre waren von heftigen Luftangriffen auf ihr junges Leben begleitet. Der Krieg tobte auch in unserer Straße, in unserer nächsten Umgebung mit voller Wucht und große Mächte setzten alles daran, ihrem gerade begonnenen, kleinen Leben im Bombenhagel ein Ende zu setzen. Ein Glücksengel musste seine Flügel über sie und natürlich auch über uns ausgebreitet haben, wir überlebten alles auf wunderbarer Weise.
Mit meiner Familie wohnten in unserem Haus, in den kleinen Wohnungen neun Familien; im Erdgeschoss Familie Heinke mit zwei Jungen. Einen in meinem und der andere im Alter meines Bruders. Gerade mit dieser Familie und deren zwei Söhnen hielt die Freundschaft noch über viele Jahre nach dem Krieg, bis auch unsere Familien sich aus den Augen verloren.
So richtig interessant ist es vielleicht nicht für dich, aber gerade diese Familie hat mich als Kind sehr beschäftigt und so will ich meine Erzählung gerade damit so ausführlich beginnen, wenn es auch nicht gerade in den Zeitablauf hinein passt.
In dieser Familie tobte einige Jahre nach dem Krieg eine Scheidungsschlacht (Vielleicht ist das ein etwas übertriebener Ausdruck) an der ich voll beteiligt wurde. Die genaue Vorgeschichte habe ich nicht erfahren, aber die Situation, die ich erlebte, war die Folgende, ich will sie mit wenigen Worten berichten: Herr Heinke hatte eine Kellnerin in irgendeiner Kneipe in der Innenstadt kennen und lieben gelernt. Mit seinen wenigen Habseligkeiten zog er aus der gemeinsamen, ehelichen Wohnung aus und bei Frau Lebermann, der Kellnerin, ein. Da bewohnte seine Familie schon nicht mehr die Wohnung im Haus, aus dem meine Eltern sie kannten. In der Zeit der Trennung lebten sie in einer noch kleineren, die zwar im gleichen Stadtteil war, sich aber auf einem dunklen Hinterhof befand. In dem Haus befand sich ein Schlachterladen und auf dem Hof, vor dem Hauseigang, wurde an bestimmten Tagen in der Woche geschlachtet und so konnten auf dem Hof, am Bodeneinlauf, die getrockneten Blutlachen besichtigt werden. Ich musste immer sehen, dass ich mit einen Sprung darüber hinweg, mit sauberen Schuhen ins Haus kam. Mit leisem Grauen sah ich stets über diese, dunkelroten Stellen hinweg.
Die neue Frau im Leben von Herrn Heinke, etwas größer und noch dicker als Frau Heinke selbst, bewohnte im ersten Obergeschoss in einem einzeln stehenden Haus eine kleine Wohnung im nächst gelegenen Stadtteil. Ich wusste so genau über ihre körperliche Beschaffenheit Bescheid, weil die Söhne von Herrn Heinke diese Frau kannten. Einmal sahen wir sie auf einer Straßenseite und einer der Beiden flüsterten mir zu: „Das da ist die Lebermann, bei der wohnt nun unser Alter“.
Die temperamentvolle, quirlige Frau Heinke war von dieser, ihr aufgezwungenen Situation natürlich nicht besonders erfreut und so bekamen die Söhne Hubert und Gunther sowie auch ich als Mitläufer den direkten Auftrag, die Rivalin ihres ehelichen Glücks so richtig zu ärgern. Ich glaubte aber, dass die Söhne den „Alten“ nicht besonders vermissten. Ihre Freiheit außerhalb der Wohnung wurde durch seine Abwesenheit nun wesentlich vergrößert. Frau Heinke hatte ganz andere Sorgen, als auf ihre beiden Söhne acht zu geben Durch unsere halbherzigen Aktionen sollte seine Aufmerksamkeit jedoch wieder auf das häusliche Glück gelenkt werden. Was wir auch immer am Küchentisch gemeinsam lange überlegten, um den „Chef“ der Familie zu einer reumütigen Rückkehr zu veranlassen, es war in meinen Augen nichts Dramatisches dabei, es war einfach nichts. Die beiden Söhne waren auch gehemmt, hatten sie doch immer noch Respekt vorm „Alten“. Von allen gemeinsam gemachten Vorschlägen blieb nur noch einer, der Harmloseste, übrig. An mehreren Abenden im beginnenden Herbst sammelten wir kleine Steine und warfen sie gegen das zur Straße liegende, erleuchtete aber verhangene Fenster. Das Anprallen der kleinen Steine an die Scheiben sollte wie ein Klopfen an das Gewissen des im Hintergrund des Raumes befindlichen Vaters wirken. Ich warf ebenfalls fleißig Steine, denn nach diesen großen Taten richtete die Auftraggeberin jeweils ein Abendessen aus, an dem ich als Werfer und Kenner der Situation teilnehmen durfte. Besonders groß war Frau Heinkes Freude, wenn wir ihr berichteten, dass „die Lebermann“ sich ärgerlich am Fenster gezeigt hatte (Manchmal stimmte das gar nicht) Wobei ich wegen meines vollen Mundes beim hastigen Essen nur immer bestätigend mit dem Kopf zu nicken brauchte. Großes Interesse am Werfen hatte ich ohnehin nicht, ich kannte Frau Lebermann gar nicht. Sie stand meiner eigenen Familie nicht nahe und was Herr Heinke tat oder nicht tat, war mir im Grunde auch völlig gleichgültig. Aber was macht man nicht alles, wenn man Hunger hat. Am Ende war die Aktion und auch andere Aktionen, von denen ich aber nichts berichten werde, alle erfolglos, Herr Heinke ist nach meinem Wissensstand nie wieder in den Kreis dieser, seiner Familie zurückgekehrt. Was Frau Heinke selbst in die Wege geleitet hatte, davon wurde mir nichts mitgeteilt.
Einen weiteren, besonderer Grund für mich bei Familie Heinke zu sein, war das auf dem Küchenschrank stehende Radio. Nur ein großer Erwachsener, lang wie Herr Heinke selbst, konnte es auf seinem hohen Standort bedienen. Frau Heinke war klein und korpulent, nicht einmal so groß wie ich selbst. Also stand immer ein Stuhl als Bedienungshilfe vor dem Schrank. Warum das Gerät nicht umgesetzt wurde, nachdem Herr Heinke Familie und Wohnung verlassen hatte, konnte ich nicht ergründen. Erklang aus dem Radio Musik: Musik, egal in welcher Form mit welchem Klang; ich liebe Musik über alles bewunderte ich das sprechgenaue Mitsingen meiner Freunde und ihrer Mutter. Sie kannten alle die gespielten Lieder und Schlager. Traurigkeit wegen den Abgang des Oberhauptes war hier nicht zu bemerken. Trotz unserer nächtlichen Einsätze war hier in der dämmerigen Küche stets Hochstimmung. Unser Gerät zu Hause war defekt und blieb es auch für alle Zeit, dank meiner „Reparatur“, von der ich aber erst später berichten werde. Die kleine, dunkle Wohnung der Familie war bei Herrn Heinkes Abgang vollgestellt mit Kisten und Kartons, in denen sich das Spielzeug befand, über dessen Herkunft striktes Schweigen herrschte. Mitgenommen hat er bei seinem Auszug nicht eine Kiste. Ein mir geschenktes Spielauto, aus einer der vielen Kisten, fiel dabei gar nicht ins Gewicht.
Worüber ich mir aber erst viel später Gedanken gemacht habe, war das Bild, das Herr Heinke abgab. Beide Frauen, Frau Heinke und auch Frau Lebermann, übertrafen den schmalen, sogar dünnen und hageren Herrn Heinke im Gewicht ganz beträchtlich, wenn nicht sogar um das Doppelte. Das Charakteristische an ihm war aber das ständige Wackeln mit dem Unterkiefer. Es sah aus, als würde er ständig einen Kaugummi im Mund haben oder auf etwas herum kauen. Warum er das tat, wusste ich nicht, fand es aber so interessant, dass ich es vor dem Spiegel einstudierte, nachmachte und das so lange, bis unsere Mutter mich fragte, ob ich zum Zahnarzt muss. Mein Respekt vor diesem Arzt war auch damals schon so ausgeprägt vorhanden, dass ich das Wackeln sofort beendete. Ob dieser Mann am gerade vergangenen Krieg teilgenommen hatte, konnte ich nicht ergründen, er war immer da.
Als Herr Heinke noch im Kreise seiner Familie weilte, trafen seine Söhne und ich ihn einmal in der Innenstadt. Er hatte seine Besorgungen erledigt und die Heimfahrt sollte mit der Straßenbahn angetreten werden. Herr Heinke lächelte mich freundlich an und sagte: „Ich habe leider nur Fahrgeld für uns. Du kommst doch sicher auch so nach Hause.“
Sicherlich, ich kam auch ohne Herrn Heinkes Hilfe nach Hause, aber ein kleiner Stachel der Enttäuschung und Wut über diese, für mich so schmähliche, Zurückweisung blieb bei meinem nachtragenden Charakter doch über einen langen Zeitraum in mir verankert. Dieser kleine Stachel, verbunden mit einem sehr guten Gedächtnis, sollte mir auf meinem weiteren Lebensweg noch viel zu schaffen machen. Aber, diese Familie habe ich deshalb so ausführlich beschrieben, weil sie besonders in meiner Erinnerung geblieben ist. Meine Eltern hatten mit dieser Familie schon in „Friedenzeiten“ einen engen Kontakt gepflegt, den ich als kleiner Junge nun fortsetzte. Unsere Mutter beteiligte sich an dieser Kontaktpflege allerdings nicht im Geringsten.
Die Brüder Hubert und Gunther, meine Freunde aus alten Zeiten, sollten mir viele Jahre später unter besonderen Umständen noch einmal begegnen. Davon werde ich aber später berichten. Von Familie Heinke soll nun keine Rede mehr sein.
Der unselige Krieg hielt auch in unserem Stadtteil, unserer Straße Einzug und so verbrachten wir die erste Zeit der Bombenangriffe im hauseigenen Luftschutzkeller. Im hinteren Bereich des Kellerganges befand sich der gesonderte Raum, abgestützt mit Balken, sodass er wie ein kleiner Wald aussah und auch so roch. Einige, nicht alle Hausbewohner, versammelten sich beim Aufheulen der Sirenen in diesem Raum. Sie saßen beim Schein der mitgebrachten Kerzen auf Stühlen und Bänken. Ich neben der Mutter, die meine kleine Schwester auf dem Schoß hielt. Ob neben meinen Geschwistern noch andere Kinder mit in dem Keller waren, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Gesichter konnte ich in der Dunkelheit nicht erkennen. Gesprochen wurde, so wie ich mich erinnere, nicht ein einziges Wort. Alle verharrten im stillen Schweigen. Das eine Fenster vor diesem Keller war von außen mit Sandsäcken und Betonklötzen gesichert und sollten weiteren, erforderlichen Schutz bieten. Mein Erinnerungsvermögen ist hier, bedingt durch mein damaliges Alter, nicht sehr groß. Es sind alles nur Bruchstücke, die zurück geblieben sind.
Unser Vater, bedingt durch seine kriegswichtige Arbeit in den Metallwerken, dort wurden Flugzeugteile aus Aluminium hergestellt, lange Zeit vom Soldat sein zurückgestellt, konnte bei Alarm die wenigen Schritte vom Werk nach Hause schnell laufend zurücklegen und den Transport von uns Kindern und auch von gebrechlichen Mitbewohnern in den, wie alle glaubten, verhältnismäßig sicheren Schutzraum beaufsichtigen. Während der Angriffe blieb er meist bei uns, manchmal, aber ganz selten, musste er aber gleich wieder ins Werk. Erst wenn die Sirenen Entwarnung geheult hatten, ging er mit seinen Holzschuhen klappernd ins Werk zurück. Wir erkannten ihn immer an seinen klappernden Schuhen, so hörten wir ihn kommen und gehen.
Die Erinnerung bringt aber noch Bilder hervor, die sich tief eingeprägt haben. Der Vater stand am oberen Teil der Kellertreppe und sah bei einen Alarm zur offenen Haustür heraus auf die dunkle Straße. Dort krachte und blitzte es in ununterbrochener Folge. Alles hatte eine starke Ähnlichkeit mit einem kräftigen Gewitter. Das Krachen kam von der Flak, die auf dem Dach eines Gebäudes im Gelände der nahen Metallwerke stand. (Der Aufzug für die erforderliche Munition steht heute noch darauf) Ich stand unten am Treppenansatz und schaute zum Vater hinauf. Da alles dunkel war, konnte ich im Blitzschein nur seine Konturen erkennen. Was dachte er, was macht er dort oben? So überlegte ich mit meinem Kindersinn. Wer mich aus dem Luftschutzkeller, in dem eine Kerze die Dunkelheit etwas verdrängte, in den Gang und zur Treppe laufen ließ, ist mir entfallen. Es war wohl die Dunkelheit ringsum, die mich zu einen kleinen, unbemerkten Ausflug verleitet hatte. Ich war froh, als der Vater mich bemerkte und in den Luftschutzraum zurückbrachte. Anfang des Jahres 1944 zogen wir um, auf die andere Straßenseite in das letzte Haus des langen Häuserblockes, in eine Wohnung mit einem Raum mehr. Dieses Haus war, wie der Vorgängerbau den wir verließen, ebenfalls mit neun Familien bewohnt. Von dem Umzug selbst habe ich nichts mehr in Erinnerung behalten, aber viel zu transportieren gab es sicherlich nicht. Nun hatten wir auch ein Wohnzimmer, das aber infolge von allgemeiner Möbelknappheit nur sehr dürftig eingerichtet war und dann auch für alle weiteren Zeiten so blieb. Was da drin stand passte irgendwie gar nicht zu einander. An der Wand hing ein großes Ölgemälde, auf dem in stürmischer See ein Kahn fuhr. Kinder klammerten sich an die Reling, alles sah sehr dramatisch aus. Jahre später war es von der Wand spurlos verschwunden. Dann gab es eine weiße Wäschetruhe mit Rückenpolster und eine weitere Truhe zum Aufbewahren von Gegenständen, die keiner benutzte. Ein Sofa oder Sessel gab es nicht, was ja eigentlich zu einem Wohnzimmer gehört. Neue, weitere Möbel zu kaufen war in dieser Zeit völlig unmöglich. Was produziert wurde in den noch heilen Werkstätten kam den Ausgebombten zu.
Vom Treppenhaus der im Erdgeschoss liegenden Wohnung kam man in einen Flur, von dem die Türen in den Toilettenraum, zur Küche und in das Wohnzimmer abgingen. Vom Wohnzimmer führte wiederum eine Tür ins Schlafzimmer. Dieses Zimmer sollte später noch eine besondere Bedeutung erlangen. Im Toilettenraum befand sich, ausgerechnet über der Tür, in über zwei Meter Höhe die Gasuhr. Das System der Gasversorgung funktionierte nur, wenn man ein Geldstück in einen Schlitz der Zähluhr warf, um den Herd in Betrieb nehmen zu können. War die Gasmenge für die eingeworfene Münze verbraucht, erlosch die Flamme und sie musste erneut in Gang gesetzt werden. Einmal im Monat kam ein Mann von den Gaswerken und entleerte den Geldkasten. Erst in späteren Jahren habe ich diese Art des Verbrauches zu schätzen gelernt. Diese Eigenart der Gasversorgung ist besonders in meiner Erinnerung haften geblieben, weil der Einwurf der Geldmünze nur mit einer kleinen Leiter, und dies mehrmals täglich, zu bewerkstelligen war. Wie alte Leute in ihren Wohnungen die Münzen einwarfen, blieb mir ein Rätsel.
Auch wenn der Toilettenraum als Badezimmer beschrieben und bezeichnet wurde, heißt dies nicht, dass man darin auch baden konnte. Eine Wanne gab es nicht, so musste unsere alte Zinkwanne, die wir schon in der vorigen Wohnung hatten, weiterhin als Badewanne dienen. Ein ‚Badezimmer‘ war somit nur existenziell vorhanden, hatte ein WC und ein Handwaschbecken. Der Raum wäre aber groß genug für den Einbau einer Wanne gewesen. Beheizt wurde die Küche, als einziger Raum in der Wohnung, vom gleich hinter der Tür stehenden Küchenherd mit Ringen auf der Herdplatte und einer Bratenröhre. Anzumerken ist noch, dass in meiner gesamten Kindheit nur ein einziger Raum in der Wohnung mit einer elektrischen Lampe ausgestattet war, und das war die ständig bewohnte Küche. Die Anschlüsse waren zwar auch an anderer Stelle vorhanden, hingen aber ohne Funktion nur mit zwei Drähten nutzlos unter der Zimmerdecke. Kühlschränke waren noch kein allgemeines Küchenmöbel, dafür gab es in diesen Wohnungen eine Speisekammer. Das war ein in die Wand eingelassenes Regal, das mit einer schmalen Tür verschlossen wurde. Zur Kühlung von Lebensmitteln war diese Konstruktion nicht gedacht. Es hätte ja auch kaum etwas zum Kühlen gegeben, denn es wurde täglich nur das eingekauft, was auch benötigt wurde und das kam nach Möglichkeit auch sofort auf den Tisch. In die ‚Speisekammer‘ kam alles, was nicht sofort und täglich gebraucht wurde und jeder wusste, was mit der Bezeichnung gemeint war. Bei uns war sie vollgestellt mit allem, was man zum täglichen Bedarf nicht benötigte.
Zur Speisekammer fällt mir noch eine Geschichte ein. Einige Jahre später, an einem glutheißen, sonnigen Tag im Sommer kam ich spät am Abend bei völliger Dunkelheit nach Hause und brachte den Appetit eines ganzen Tages mit. Meine Suche nach Essbarem in der Speisekammer hatte natürlich keinen Erfolg. Auf der äußeren Fensterbank in der Küche entdeckte ich eine mit einem Deckel abgedeckte Schale. Ohne Licht zu machen, aß ich den darin befindlichen Käse auf und konnte feststellen, dass er sehr gut schmeckte. Da es draußen kühler war, stellte unsere Mutter in der warmen Jahreszeit öfter etwas dorthin. Am nächsten Morgen fragte sie mich: „Sag mal, wo ist der völlig vergammelte Käse geblieben? Ich habe ihn zum Wegwerfen auf die Fensterbank gestellt.“ Mein bleich gewordenes Gesicht verriet ihr, wo der Gesuchte verblieben war. Dass bei uns ein Lebensmittel überhaupt schlecht werden konnte, war schon ein kleines Wunder. Erst viele Jahre später habe ich mich an ein derartiges Lebensmittel wieder herangewagt.
Diese Wohnung war unser Lebensbereich und der Ort, der meine Kindheit prägte. Aus der schwachen Erinnerung heraus und aus den Gesprächen der Erwachsenen wusste ich wohl, dass wir einmal woanders, auf der anderen Straßenseite, gewohnt hatten, aber das verblasste und ich glaubte immer dort in dieser Wohnung gelebt zu haben. Aber, wieder zum Vater zurück.
Die Arbeit im Werk muss ihn stark in Anspruch genommen haben, oft arbeitete er gleich mehrere Schichten ohne Unterbrechung. Die Arbeiten, die er ausführte, waren kriegswichtig, wie wohl die meisten Arbeiten in dieser wirren Zeit. Der Vater hatte sicherlich das, was in den heutigen Tagen als Stress bezeichnet wird. Diese Wortschöpfung war damals zwar noch unbekannt, aber sicherlich schon vorhanden. Als Berufsbezeichnung für des Vaters Tätigkeit hörte ich stets das Wort: Gießer. Damit konnte ich nichts anfangen. Maurer, Bäcker, Straßenfeger oder Friseur, das waren Berufe, die der Tätigkeit ihren Namen gaben. Unter Gießer konnte ich mir nie etwas vorstellen und so blieb die Tätigkeit unseres Vaters für mich die gesamte Kindheit über ein Rätsel.
Eine starke Hand rüttelte an meiner Schulter: „ Aufstehen, los. Zack, zack. Es ist Alarm.“
Schlaftrunken richtete ich mich auf.
„Beeile dich, alle anderen sind schon fertig“, es war die Stimme des Vaters. Von meinem Bett aus eilte ich im kurzen Hemd in die Küche zur Wasserleitung, hatte gerade die Hand zum fließenden Wasser ausgestreckt, um mir das Gesicht zu waschen, als ich eine gepfefferte Ohrfeige erhielt.
„Dafür haben wir jetzt keine Zeit, zieh dich schnell an“, hörte ich ihn sagen.
Minuten später war ich angezogen und rannte mit der Mutter und den Geschwistern in die dunkle Nacht und dem rettenden Bunker entgegen. Der Vater machte sich auf den Rückweg zum Werk, wo für ihn wohl Schutzmöglichkeiten bestanden. Es waren schon bewegte Zeiten, und diese Zurechtweisung war der letzte körperliche Kontakt, den ich mit unserem Vater hatte und der in der Erinnerung verblieben ist. Wie gerne hätte ich in der darauf folgenden Zeit vom Vater diesen Klaps noch einmal empfangen oder auch mehrere.
Mir den Vater als Person vorzustellen fällt sehr schwer. Ich sah ihn als einen Mann, mit einer gedrungenen Figur und sehr männlichen Gesichtszügen, wobei es bezüglich der Körpergröße zwischen der Mutter und ihm keinen Unterschied gab. Meine Erinnerungen an ihn beziehen sich weitgehend auf Fotos und aus Berichten von Leuten in unserer Umgebung, die ihn gekannt hatten.
Dann kam im September 1944 doch noch der lange erwartete Einberufungsbefehl. Als der Vater in einer Arbeitspause nach Hause kam, legte ihm die Mutter das ungeöffnete Schreiben neben den Teller auf den Küchentisch. Er schlitzte den Umschlag auf, las den Inhalt und sah uns alle, der Reihe nach am Tisch sitzend an, sprach kein einziges Wort und verließ den Raum. Viele Jahre später erzählte uns unsere Mutter, dass ihm die Einberufung nicht ganz ungelegen kam. So glaubte er doch wirklich durch seinen Einsatz noch etwas an der drohenden Niederlage ändern zu können. Vielleicht fühlte er sich auch schuldig, weil andere in den Krieg zogen und er immer noch zu Hause bleiben musste. Dass er sein Land, das ihn so wenig geliebt und ihm so wenig gegeben hatte, selbstlos liebte, steht noch heute für mich völlig außer Zweifel. Er war ganz gewiss ein guter Patriot, der sein Land über alles liebte. Die einzige Ausnahme, die noch über dem Vaterland stand, war seine Familie. Er zog in einen Krieg, in dem es für ihn nichts zu verteidigen gab. Es waren keine Ländereien oder andere materielle Werte in Gefahr, die ihm gehörten. Seinen Status als Arbeiter hätte er durchaus auch nach einem gewonnenen Krieg nicht verloren. Was er hatte, war eine schutzbedürftige Familie mit drei kleinen Kindern in einer spärlich eingerichteten kleinen Wohnung.
Die Zeit, in der wir damals lebten, genannt die Groß-Deutsche-Zeit, hatte auf unsere Wohnsituation und auf die in den vielen kinderreichen Familien unserer Umgebung nicht den geringsten Einfluss. Heute und auch schon bedeutend früher war mir klar, dass unser Vater dem nationalsozialistischen System dankbar für Arbeit und Wohnung war, denn dies bedeutete für ihn die Gründung einer eigenen Familie. Von den politischen Zielen und Praktiken des Systems hatte er allerdings nicht den geringsten Durchblick. Als der „Heilsbringer“, der „Führer“ auftauchte, gab es für ihn gar keine andere Perspektive, nach jahrelanger Perspektiv- und Arbeitslosigkeit, als sich gerade diesem neuen System anzuschließen. In unserer jetzigen Zeit gibt es allerdings Lautsprecher, die von Anfang an dagegen gewesen wären. Leider waren diese aber damals noch nicht auf der Welt. Er machte im September 1944 eine kurze Ausbildung zum Rekruten und bekam seinen sofortigen Fronteinsatz in Schlesien. Was konnte der Vater seinem bisher unbekannten Gegner entgegensetzen?
Allein durch seine viel zu kurze Ausbildungszeit schied er als Soldat gegen seine Kontrahenten von vornherein aus.
Das schmähliche Wort „Kanonenfutter“ traf hier sicherlich zu. Er selbst schon 42 Jahre alt, von der körperlichen Konstitution stark, aber Gegnern, denen er an der Front gegenüberstand nicht gewachsen. Wenn ich in späteren Jahren bedachte, dass allein eine Ausbildung zur Jagd, wenn sie denn gründlich sein soll, schon neun Monate beansprucht, dann weiß ich, dass mein Vater nie eine Chance gehabt hätte, seine Waffe so zu führen, wie es erforderlich war, um diesem Gegner erfolgreich gegenüber zu treten. Ich will aber auf keinem Fall die Jagd mit Krieg vergleichen. Nur die Handhabung einer Waffe.
Seine nun erfolgte Reise (besser ist wohl das Wort Transport) nach Schlesien, zu seinem Einsatzort, war bestimmt die weiteste und längste Reise, die er in seinem Leben jemals gemacht hat. Leider war es auch seine letzte, sie war ohne Wiederkehr. Von dort verliert sich die Spur seiner gesamten Kompanie, die als Teil der 17. Armee im Kampf mit den vordringenden Russen stand. Wer die Geschehnisse der letzten Kriegstage in Schlesien kennt oder nachzuvollziehen versucht, versteht, warum kein Lebenszeichen von ihm zu uns gedrungen ist. Selbst das Abnehmen der Erkennungsmarke wird in dem Chaos nicht immer möglich gewesen sein. Ein Großteil der Kameraden in seiner Kompanie kam aus dem südlichen Niedersachsen, der Heimat unserer Mutter. Dadurch waren gute und intensive Kontakte zu den Angehörigen in des Vaters Kompanie gegeben, aber auch von denen fehlt noch heute jedes Lebenszeichen. Er gilt ab dieser Zeit, im Januar 1945, mit seiner gesamten Kompanie als vermisst. So hat seine Zeit als Soldat, einschließlich der Ausbildung, ganze fünf Monate gedauert. Einen einzigen Brief aus einem winzigen Dorf in Schlesien, das ich viel später vergebens auf allen Karten gesucht habe, hat die Mutter bekommen. Es war das letzte Lebenszeichen. Viele Jahrzehnte später übersandte das Rote Kreuz einen Bericht über die Kämpfe in Schlesien, an denen der Vater teilgenommen hatte und aus dem hervorging, dass die Verluste dort sehr groß gewesen waren und der Tod eines Einzelnen keine besondere Bedeutung gehabt hatte.
Nach dem Umsturz, der Niederlage, oder doch besser der Befreiung 1945, zahlte es sich für uns aus, dass der Vater bei den im Werk beschäftigten und nun freigelassenen Fremdarbeitern nicht unbeliebt war. Nach der späteren Aussage unserer Mutter nahm er stets mehr belegte Brote mit zur Arbeit als er selbst brauchte. Diese muss er dann offensichtlich mit den Fremdarbeitern geteilt haben, denn wir blieben von allen Repressalien verschont. Dieses Glück hatten nicht alle in unserer Straße. Bei Leuten, die etwas mit der Partei oder einer ihr näher stehenden Organisation zu tun hatten, plünderte man Wohnungen und Keller. Den in den Wohnungen lebenden Personen geschah allerdings kein körperlicher Schaden. Auf der unserer Wohnung gegenüber liegenden Straßenseite wohnte eine Familie, dessen Familienoberhaupt in der SS rekrutiert war. Er selbst war nach dem Zusammenbruch nicht zu Hause, ich habe ihn aber auch in der Folgezeit nicht mehr wieder gesehen. Gerade diese Wohnung und der Keller wurden sehr schwer heimgesucht. Mit Unverständnis beobachteten wir das Zerschlagen der Einweckgläser und das Verstreuen des Inhaltes auf der Straße.
Die freigelassenen Fremdarbeiter konnten aber nur durch Denunziation von den Mitgliedschaften in der nun so geächteten Partei und deren Organisationen erfahren haben.
Von den Vorgängen im nahen Lager der Fremdarbeiter, auf das wir aus unseren Fenstern gut sehen konnten, mussten die Straßenbewohner gewusst haben. Mit meinem kindlichen Sinn und Verstand sah ich ausgemergelte und in den Abfalltonnen stochernde Fremdarbeiter und Gefangene in zerrissener Kleidung. Viel fanden sie nicht. Die Erwachsenen sahen diese Elendsgestalten ganz sicher ebenfalls.
Was uns allerdings nach dem Krieg von der eigenen Verwandtschaft entgegenschlug war nicht weniger als das von Feinden. Wer solch eine Verwandtschaft hatte wie wir nach dem Krieg, der musste hart im Nehmen sein. Aber das ist ein anderes Kapitel und darüber will ich dir an anderer Stelle noch erzählen. Aber weiter.
In der Nazipartei war unser Vater eingetragen, ich konnte das Anhand einer zerfledderten Zahlkarte, die ich unter anderen Papieren gefunden habe ermitteln. Seine Zugehörigkeitsnummer lag schon sehr weit oben, was klar auf einen späten Beitritt hindeutete. Vielleicht war sein Eintritt in diesen Verein auch verbunden mit Vergünstigungen, wie etwa der Arbeitsstelle und der kleinen Wohnung. Ich habe ein Foto, das ihn in der Uniform der SA in einer Marschformation und in sehr militärischer Haltung zeigt und ein weiteres in der Uniform des Werkschutzes der Metallwerke, als Bewacher einer Herrentoilette mit geschultertem Gewehr. Zur Handhabung einer Waffe muss unser Vater doch ein besonders gutes Verhältnis gehabt haben. Für kriegerische Aktivitäten aber bestimmt zu viel wenig. Was ich über unseren Vater, also deinen Onkel, sonst noch in Erfahrung gebracht habe, ist leider nicht viel. Aber er war ganz sicher ein Familienmensch mit einem ungeheuren Arbeitseifer.
In seiner knappen Freizeit widmete er sich mit Vorliebe der Fotografie. Hierfür besaß er eine Boxkamera im Filmformat sechs mal neun cm und hatte bei dieser Negativgröße auch die Möglichkeit, die Bilder ohne großen Aufwand und ohne Gerätschaften selbst entwickeln zu können. So kann ich mich gut erinnern, dass zu bestimmten Zeiten im Toilettenraum auf einer Wäscheleine aufgereiht die fertiggestellten Fotos, mit einer Wäscheklammer befestigt, zum Trocknen hingen. Durch eine glückliche Fügung habe ich einen, wenn auch leider nur kleinen Teil, davon über die Zeiten retten können, wobei auffällig ist, dass leider kein einziges Foto von meiner nach mir geborenen Schwester dabei ist. Ganz sicher hat er aber auch Fotos von ihr angefertigt. In der ersten Zeit, nach seinem Auszug zur Beihilfe zum Endsieg, existierte im Haushalt noch ein Fotoalbum. Es war ein längliches Album mit dicken, schwarzen Kartonseiten, in denen die Fotos sauber in Hoch- und Querformat eingeklebt waren. Die jeweilige Beschriftung stand mit weißer Tinte geschrieben daneben. Aber mit der Zeit wurde dieses Album immer dünner, die Fotos verschwanden auf nimmer wiedersehen. Bis auf die wenigen, die ich über die Zeiten retten konnte. Aber, das erwähnte ich bereits.
Das Hobby des Fotografierens habe ich später von ihm übernommen. Aber auch mein zweiter Sohn, du wirst ihn nicht kennen und meine Tochter haben das Fotografieren zu ihrem Hobby gemacht. Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit, dass du Fotos von ihnen besichtigen kannst. Er lebt übrigens in Berlin und die Tochter in Hamburg. Also Beide weit entfernt von mir. Außerdem goss der Vater Bleifiguren und bemalte sie. Es waren, wie sollte es zu der Zeit wohl anders sein, alles Soldaten. Leider sind keine der Figuren oder Formen erhalten geblieben.
Die Zeit nach dem Fortgang unseres Vaters und der damit verbundenen Umstellung für die Familie war für unsere Mutter eine schwere Zeit. Hatte der Vater doch alles geregelt, unserer Mutter alle Dinge des täglichen Lebens abgenommen, was sich nun nach seinem Fortgang als nicht besonders vorteilhaft erwies. Sie konnte sich nur schwer in die täglichen Dinge einfügen, die gerade in dieser Zeit weit über das sonst übliche Maß hinausgingen.
Das zeigte sich besonders deutlich, wenn das Heulen der Sirenen den Fliegeralarm und somit den erforderlichen Gang zum schützenden Bunker, den wir nun statt des Luftschutzkellers im Haus aufsuchten, erforderlich machten. Wir kamen fasst regelmäßig zu spät und die Mutter machte unsere Ankunft durch heftiges Klopfen an die stählerne Bunkertür bemerkbar. Der von uns zurückzulegende Weg zu diesem schützenden Ungetüm aus Beton war der Weiteste von den Bewohnern unserer Straße. Durch das schon obligatorische Zuspätkommen am Tage war es mir auch möglich, die Bombenflugzeuge bei schönem Wetter als silbern blitzende Punkte mit langen Kondensstreifen am blauen Himmel zu sehen. Wenn wir nachts die Straße entlang zum Bunker liefen, standen oft schon die den Bomberpiloten als Leuchtmarkierung dienenden „Tannenbäume“ über der Stadt und Suchscheinwerfer tasteten den Himmel ab. Wenn die Situation nicht so Ernst gewesen wäre, hätte man den Anblick als romantisch und schön bezeichnen können. In den Bombern saßen Piloten mit der Aufgabe unser Leben, das noch nicht einmal richtig begonnen hatte, mit dem Inhalt ihrer Flugzeuge zu beenden. Viele Jahre später, in den amerikanischen Kriegsfilmen, sah ich dann Piloten in diesen Rollen, die gar nicht in die Rolle derer passten, die ich in meiner kindlichen Erinnerung hatte.
Wir wohnten im letzten Haus der langen Häuserreihe, der Bunker stand ebenfalls am Ende, aber entgegen gesetzt zu unserer Wohnung. Das bedeutete, dass wir somit auch am schnellsten laufen mussten. Die Schwester lag im Kinderwagen, ich hielt mich an dessen Griff fest und mein Bruder lief allein nebenher. Alles im geschildert schnellen Lauf und das bei fast jedem Alarm. Der Kinderwagen meiner Schwester blieb auch in späteren Jahren noch erhalten. In Ermangelung einer Kinderkarre wurde sie in diesem Gefährt noch in den Zeiten nach dem Krieg durch die Straßen unseres Stadtteils, oft in rasender Fahrt, von meinem Bruder und mir kutschiert. Das Verdeck war abgebaut worden und sie saß aufgerichtet in dem Gefährt mit wehenden Haaren. In unserem jugendlichen Übermut haben wir auf ihre Ängste bei diesen Fahrten keine besondere Rücksicht genommen. Vielleicht haben wir die Ängste sogar im Übermut vergrößern wollen.
In der letzten Phase des Krieges häuften sich die Angriffe in solch einem Maße, dass an ein Verlassen des Bunkers nicht mehr zu denken war. Kaum waren wir zu Hause angelangt, heulten die Sirenen erneuten Alarm. Alles wurde wieder eingepackt und das Rennen begann erneut. Wir bekamen, vielleicht auf Grund einer noch vom Vater eingeleiteten Initiative, eine eigene Kabine und übersiedelten aus unserer Wohnung zusammen mit den Habseligkeiten des täglichen Bedarfs vollständig in den Bunker.
Die Kabinen waren klein und muffig. Der Luftstrom zog im Treppenbereich an den Türen vorbei und ließ die verbrauchte Luft in den Räumlichkeiten zurück.
Mein Lieblingsplatz war daher nicht in unserer Kabine, sondern im Untergeschoss des Bunkers. Dort, in dem großen Raum, der die Biegung des runden Bauwerkes annahm, standen Holzbänke, auf denen sich die Menschen drängten. In diesem Raum, den es gleich zweimal im Bunker gab, war bei den Angriffen immer etwas los, was den sonstigen Alltag auflockerte. Ich strolchte zwischen den Leuten und den Bänken herum und horchte auf die Gespräche der Erwachsenen, aber ohne deren Sinn zu verstehen. Da der Raum meist nur von Frauen mit ihren Kindern bevölkert war, herrschte hier ein Stimmengewirr, das nur kurz vom Detonieren der Bomben unterbrochen wurde. Von den Wasch- und Toiletteneinrichtungen habe ich nichts in der Erinnerung zurück behalten. Bedingt durch diesen Wohnungswechsel lernte ich unsere neue, massive Behausung in allen Ecken und Winkeln, vom Untergeschoss bis zur im Dachgeschoss befindlichen Lüftungsanlage, sehr gut kennen. Das sollte mir in den darauf folgenden Jahren, beim Sammeln von Altmetall, als der Bunker noch zugänglich war, manchen Vorteil einbringen. Unsere Mutter hatte sich mit anderen Frauen angefreundet, meinen Bruder sah ich im Bunker gar nicht und so hatte ich in dem Betonkasten unbeschränkte Bewegungsfreiheit.
Mit dem Bruder zusammen begann im Jahr 1943 eine Reise zur Kinderlandverschickung nach Fredelsloh, einer kleinen Ortschaft am Solling, in der Nähe von Moringen. Während auf Hannover in fast ununterbrochener Folge die Bomben fielen, gerade in diesem Jahr, herrschte in dem kleinen Dorf der absolute Frieden. Wie wir in diesem Kriegsjahr den Ort erreichten, kann ich nicht mehr in Erinnerung bringen. Es war, wie konnte es anders sein, mit Bus und Bahn. Meine Unterkunft bezog ich beim Küster der Ortskirche, der Bruder schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite bei einem Bauern, dessen Haus noch bis in die heutigen Tage unverändert dort steht. Einige Erinnerungen aus dieser Zeit sind bei mir als damals Fünfjähriger zurückgeblieben. Dass die erwachsene Tochter des Küsters auf der Kirchenorgel spielte, hatte für mich ganz natürliche Vorteile. Wenn sie am Instrument hantierte und arbeitete, hatte ich immer Zugang zur Empore, schlich um die Orgel herum und sah mich in allen Ecken der Kirche um. Für das Treten der Pedale, um die Orgel in Gang zu bringen, war ich zu klein und zu untergewichtig. Versucht hat sie es mit mir, brachte aber keinen Ton zustande. Auch der Glockenturm wurde in die Beobachtungsgänge eingeschlossen. Die Glocken läutete der Küster per Seilzug. Durch kräftiges Ziehen kamen die für mich so riesigen Glocken in Bewegung. Es dauerte eine ganze Weile bis der erste Ton erklang, aber dann schallte es in der kleinen Dachstube gewaltig. Ich hing mit am Seil und wurde im lustigen auf und ab mit jedem Glockenschlag in die Höhe gezogen und schwebte, wie mit Flügeln getragen, wieder nach unten.
Gleich hinter dem Haus des Küsters am Ortseingang und dem anschließenden Friedhof lag ein Hügel, von dem aus die Dorfbewohner im Oktober des Jahres, gerade als wir dort waren, dicht gedrängt die Rauchwolken über dem entfernten Hannover beobachteten. Ob die Bewohner des Dorfes wohl im Entferntesten geahnt haben, was sich dort für eine Katastrophe abspielte? Hannover brannte an allen Ecken und das war selbst auf die weite Entfernung noch gut sichtbar.
Als eine besonders angenehme Erinnerung ist in mir verblieben, dass unser Vater uns einmal besucht hat. Den weiten Weg von der Bahnstation Moringen bis Fredelsloh ging er Fuß. Die Strecke, 14 Kilometer bei schlechtestem Wetter, hat er in Anbetracht des Wunsches, seinen hoffnungsvollen Nachwuchs wieder zu sehen, bestimmt gerne in Kauf genommen.
Ich hatte aber noch einige Erlebnisse, die mir den späteren Abschied aus diesem Dorf doch etwas leichter, wenn nicht sogar sehr leicht gemacht haben. Neben der, für das kleine Fredelsloh gewaltigen Kirche im Mittelpunkt des Dorfes, befand sich ein Teich, eingefasst mit dicken Quadersteinen. Der Wasserspiegel stand weit unterhalb der umrandenden Einfassung. Wie das Ganze zu Stande kam ist mir entfallen, aber so viel ist in mir verblieben, ich trieb in meiner Unbedarftheit die auf dem Dorfplatz umher laufenden Gänse ins Wasser. Die Geschichte trug sich so zu: Mit einigen der Jungen im Dorf kam ich ins Gespräch.
„Weißt du denn, was das für Tiere sind? Habt ihr bei euch in der Stadt auch so welche?" Wir hatten natürlich keine Gänse, aber dass es welche waren, wusste ich schon aus Kinderbüchern.
„Die gehören in den Teich. Tu ihnen den Gefallen und treib sie rein.“
Diese freundlich gestellte Aufgabe erfüllte ich, ohne Nachfragen, gewissenhaft. Für die Dorfkinder von Fredelsloh war ich sicherlich der gleiche Typ Mensch, der ein Fredelsloher in unserer Straße gewesen wäre. Im Nu war die quäkende und schnatternde Schar vom Dorfplatz verschwunden und im Teich gelandet. Zurück konnte die flügelgestutzte Gänseschar nicht mehr und musste nun mit viel Aufwand von den Erwachsenen, im kniehohen, schlammigen Wasser eingefangen und wieder nach oben gebracht werden. Das Donnerwetter, das auf mich kleinen Jungen herab fiel und das sofort doppelt und dreifach entstandene Heimweh, ließen mich fast verzweifeln. Das sollte aber noch nicht alles gewesen sein. Meine zweite Niederlage erlebte ich in der Kirche. Die erwachsene Tochter meiner Wirtsleute nahm mich, wie an jeden Sonntag, mit zum Gottesdienst in die Kirche. Sie bestieg, auch wie immer, den erhöhten Standort der Orgel, mich entließ sie in die mittlere Reihe, zwischen einige Dorfjungen, die ich ja nun zwischenzeitlich von meiner „Gänsetour“ kannte. Der Gottesdienst begann mit dem Orgelspiel, danach folgte die Ansprache des Pfarrers. Dessen Stimme dröhnte durch die Kirche, vom Wortlaut verstand ich gar nichts. Da sah ich zur Seite auf meine Nachbarn und konnte beobachten, dass sie unter einander flüsterten und sich dabei die Hand vor den Mund hielten, um das Lachen zu verbergen. Von dieser Geste wurde ich so angesteckt, dass ich, ohne einen triftigen Grund zu haben, selbst lachen musste. Erst konnte ich es noch hinter der vorgehaltenen Hand zurück halten, aber dann brach es mit elementarer Gewalt los. Ich lachte laut in die Predigt des Pfarrers hinein, der so etwas wohl in seiner Gemeinde noch nicht erlebt hatte. Er sah wie die anderen Kirchenbesucher zu mir herüber und steigerte seine Stimme um einiges. Ich sank auf meinem Platz zu einem winzigen Fleck zusammen. Später, wieder im Haus angekommen, war mir das grundlose Lachen längst vergangen und ich hätte am liebsten geweint. Meine Pflegeeltern zeigten erst Verständnis, als die Tochter ihnen Vorwürfe wegen ihrer vielleicht etwas überzogenen Schelte machte.
Den Grund für meine Lachkanonade konnte ich gar nicht nennen. Mein Ansehen bei der Dorfjugend hatte durch diesen, eigentlich ungewollten Zwischenfall, jedoch eine ungewollte Steigerung erhalten.
Zum Ende des Jahres müssen wir aber schon wieder in Hannover zurück gewesen sein. Der Krieg setzte sich fort und wir waren wieder mitten darin. Die Luftangriffe hatten sich so gehäuft, dass ein Verlassen des schützenden Bunkers nicht mehr ratsam war. Unsere Kabine hatten wir immer noch und uns darin häuslich eingerichtet. Wir lebten darin wie in unserer Wohnung. In dem dreistöckigen Etagenbett hatte ich den oberen Platz erobert und konnte von dort auf das Geschehen im täglichen Bunkerleben herabsehen. Das Bett stand direkt an der Tür und die war ständig einen Spalt geöffnet. Alles musste an mir vorbei, unsere Kabine lag ganz am Anfang der gewendelten Treppe nach oben. Nach jeder Entwarnung war der erste Gang die Straße hinunter um zu schauen, ob unser Haus noch stand. Nach einem besonders schweren Tagesangriff heulten die Sirenen Entwarnung und unsere Mutter war in Sorge wegen unserer beim Schuster Kawatt in der Lotten Straße, im anderen Stadtteil zur Reparatur abgegebenen Schuhe. Es waren wohl gleich mehrere Paare und die waren zu der Zeit so gut wie unersetzlich. Es konnte durchaus sein, dass sein Haus einen Treffer bekommen hatte, alles wäre verloren gewesen. Vielleicht wären wir bis in bessere Zeiten hinein ohne Schuhe gewesen. Mein Bruder, älter als ich und nun in der wichtigen Rolle des Vaterersatzes, bekam von der Mutter den Auftrag nachzusehen und ich durfte mit.
Wir verließen den Bunker, überquerten eine Straße und gingen unter der vordem schon genannten Eisenbahnbrücke am Ende der Straße hindurch, um in den anderen Stadtteil zu gelangen. Hier stießen wir auf etwas, was noch viele Jahre in meiner Erinnerung haften blieb. Fremdarbeiter oder Gefangene, die zu bestimmten Arbeiten herangezogen wurden, hatten keinen Zugang zu den Bunkern oder anderen Luftschutzeinrichtungen. Hier unter der Brücke hatten einige dieser Menschen Zuflucht gesucht und beim vorangegangenen Luftangriff den Tod gefunden. Verstreut lagen 15 Männer teils auf dem Fußweg und einige mitten auf der Straße. Alle lagen in den sonderbarsten Stellungen und Verrenkungen. Äußere Verletzungen konnte ich nicht beobachten. Ihre Gesichter waren nicht entstellt. Wenn die verrenkten Stellungen nicht gewesen wären, hätte ich annehmen können, sie schliefen. Mit dabei lag ein Pferd mit