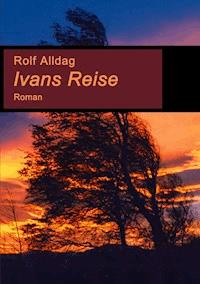Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Autor Rolf Alldag - Jahrgang 1938 - kam erst spät mit der Jagd in Berührung. Der Umzug von der Stadt in eine Landgemeinde, östlich von Hannover und die damit verbundene Nähe zur Natur, gaben den Ausschlag zur Erlangung des Jagdscheines. Die Passion zur Jagd und die damit verbundene Kenntnis von Werden und Wesen von Wild und Natur entwickelten sich aber schnell. Nach einigen Jahren intensiven Lernens, unter erfahrenen Jagdgenossen, übernahm er selbst ein Revier als Pächter und bekam für sein unermüdliches Engagement in der Hege von der Jägerschaft eine Auszeichnung, die nicht oft vergeben wird. Neben der Jagd als Pächter im heimischen Revier erfolgten Reisen mit Büchse, Kamera und Notizbuch unter anderem nach Russland, Polen, Afrika und Ungarn. Diese Jagdreisen hatten vielmehr das Ziel, nicht nur ferne Länder, deren Sprache und Kultur kennen zu lernen, sondern auch auf wunderbare Menschen zu treffen. Die Jagdgeschichten berichten, nein sie erzählen, von Erlebnissen auf und neben der Jagd. Die Geschichten zeugen von fachlichem Wissen und Jagdverstand, sie zeigen aber auch mit welcher Liebe zur Natur, zu den Menschen und zum Leben der Autor seiner Passion nachgeht. Die Jagdgeschichten sind mit 2 Zeichnungen und 35 Farbfotos illustriert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einige Worte zur überarbeiteten Auflage
Reichliches Nachdenken, Recherchieren und das Befragen von Jagdfreunden aus früherer und neuer Zeit brachte mir so manch neue Erkenntnis zu der vorigen Auflage von „Luise und andere Jagdgeschichten“. Auf stolze „Erlegerfotos“ habe ich bewusst verzichtet. Ich bin der Meinung, dass die Geschichten ihre eigene Sprache sprechen. Es sind aber Fotos eingefügt, die hoffentlich Freude beim Betrachten bereiten. Mein ganz besonderer Dank gilt der Tierfotografin Christel Freitag, die mit ihren wunderbaren Fotos zum Gelingen dieses Buches beigetragen hat. Aber ansonsten ist Luise „Luise“ geblieben. Dieses Buch ist, wie bereits seine Vorgänger, kein Lehrbuch der Jägerei. Es soll vielmehr einen Eindruck vermitteln und weitergeben, wie viel Freude man an der Jagd haben kann, die mitunter auch abenteuerliche Begebenheiten aufweist. Dass von Leuten, die es wissen müssen, behauptet wird, dass die Jagd für viele Menschen das letzte Abenteuer in unserer schnelllebigen Zeit bedeutet, ist jedem in der Beurteilung selbst überlassen. Ganz verkehrt ist diese Ansicht sicher nicht. Die Freude zur Jagd wird sogar noch gesteigert, wenn man sich relativ spät im Leben dieser Passion gewidmet hat. Von großen Strecken soll auch in diesem Buch keine Rede sein, nach der Einsicht des von mir hochverehrten Jagdschriftstellers von Gagern kommt es auf den Geist der Ausbeute, nicht auf die rohe Menge an. In den Jahrzehnten, seit meiner Jägerprüfung bis zum heutigen Tag, hat sich in der Jagd viel getan. Die Technik hat auch vor dieser Passion nicht Halt gemacht. Wieweit und wieviel Technik ein Jäger auf sich zukommen lässt, mag jeder für sich entscheiden. Wie schon beim Lesen der vorangegangenen Auflagen wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Vergnügen und dem Jäger unter Ihnen vielleicht sogar neue Anregungen.
Rolf Alldag Mai 2019
Inhaltsübersicht
Der „Weiße“
Mutter Dachs
Hirschjagd in der Schorfheide
Im heimischen Revier
Vom Hasen
Auf Elch in Nordrussland
Sibirien
Im Kleinen Walsertal
Die Sau Luise
Maraljagd in Sibirien
In Polen
Afrika
Eine Steinbockjagd in Kasachstan
Tagebuch einer Jagdreise in Sibirien
Ungarische Jagden
An der Ostsee
Der „Weiße“
Unser Jagdherr, meine beiden Jagdkollegen und ich hatten unsere Plätze auf den Drückjagdböcken eingenommen. Sicht untereinander hatten wir nicht, jeder hockte verteilt im Revier und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Unser Jagdherr war meinem Wunsch gefolgt, und hatte mich ganz am Rand des recht kleinen Reviers ansitzen lassen. Warum ich ausgerechnet hier ansitzen wollte, konnte ich mir selbst nicht erklären, es war wohl ein instinktives Gefühl, gerade hier sitzen zu wollen.
In unserem Revier herrschte absolute Ruhe, dafür war in den umliegenden Revieren umso mehr Betrieb. Drückjagden waren der Jahreszeit entsprechend rundum angesagt, wir dagegen bevorzugten die Stille.
Der kluge Plan unseres Jagdherrn ging dahin, das vielleicht zu uns überwechselnde Wild scharf im Auge zu behalten und wenn ein richtiges, passendes Stück dabei sein sollte, es auch zu strecken. Interessant wäre, wenn Damwild, hier die Hauptwildart, vorbei käme. Außer führende Muttertiere, war vom Damwild alles frei. Schwarzwild gab es auch, aber leider nur auf der Wildkamera, die natürlich als technische Errungenschaft auch in unserem Revier längst Einzug gehalten hatte. Und die kamen und kommen nur in der Nacht. Selbst bei vollem Mondschein in der Nacht ist es hier im Revier so dunkel, dass nichts zu erkennen ist. Außerdem ist dieses Revier für die Schwarzkittel nur ein Durchwechselgebiet zu den etwas entfernt liegenden Äckern. Südlich von unserem Revier liegen Dickungen und morastige Niederungen, da befinden sich ihre Einstände.
Hier im Wald steht Kiefer an Kiefer, wie künstlich in den Boden gerammt, sodass selbst am hellen Tag das Ansprechen und Schießen schon gewisse Fähigkeiten erfordert. Bisher hatte ich an diesem Tag nur Rehwild zu Gesicht bekommen, das sollte jedoch geschont werden, sonst tat sich wenig, eigentlich gar nichts. Ich saß also auf meinem „Wunschbock“ und betrachtete etwas gelangweilt die mich umgebenden Bäume. Kleine Lücken gaben die Sicht auf ca. achtzig bis einhundert Meter frei, das war´s dann auch. Das Wetter konnte an diesem Tag gar nicht besser sein. Die Sonne zeigte ihr strahlendstes Gesicht am wolkenlosen Himmel, es war völlig windstill und trotz der schon späten Jahreszeit, noch angenehm warm.
Nach etwa zwei Stunden Wartezeit, in der sich einfach nichts ereignete, außer dass in unterschiedlicher Entfernung, manchmal auch etwas näher, vereinzelt Schüsse fielen und auch Hundegebell zu hören war. Meine Füße waren inzwischen mit kribbelndem Gefühl in einer etwas verqueren Haltung eingeschlafen. Ich verließ entgegen den Vorschriften meinen sicheren Platz, um mir etwas Bewegung zu verschaffen. Meine Waffe nahm ich zur Vorsicht mit nach unten.
Nur wenige Minuten später fühlte ich mich wieder gut und nahm auf meinem nach allen Seiten offenen Sitz erneut Platz. Da glaubte ich, aus den rechten Augenwinkeln heraus, in naher Entfernung, eine Bewegung zwischen einigen dicht stehenden Kiefern gesehen zu haben. Die Stelle mit den herunter hängenden Zweigen behielt ich scharf im Auge. Durch das schnell erhobene Fernglas war nichts zu sehen. Schade, dachte ich, doch dann trat dort eine Erscheinung hervor, wie ich sie in meinem Jägerleben noch nicht gesehen hatte.
Weißer Hirsch
Ein schneeweißer Damschaufler überquerte die kleine Lichtung in etwa dreißig Meter Entfernung vor meinen Sitz, sicherte mit seinen deutlich erkennbaren rötlichen Lichtern zu mir herüber, ich konnte es deutlich sehen, nahm aber von meiner Anwesenheit keine weitere Notiz und verschwand in gemächlicher Gangart hinter den nächsten Kiefern.
In diesem Moment gilt der Ausspruch: „Er war wie vom Donner gerührt.“ Ich holte tief Luft und schaute auf meine Büchse, die im Anschlag lag. Wie von Zauberhand stand der „Weiße“ noch einmal vor meinem geistigen Auge auf der kleinen Lichtung. Zum Schießen hätte es ja nur den Bruchteil einer Sekunde bedurft. Ich hätte ohne weiteres schießen können, tat es aber nicht. Eine abergläubische Scheu hielt mich davon ab. Schon in der Vergangenheit hatten Jagdkollegen in den umliegenden Revieren von einem weißen Damhirsch in dieser Gegend berichtet. Einige hatten ihn gesehen, auf ihn geschossen hat jedoch keiner. Egal ob Rothirsch oder Damschaufler, gerade die Sage vom weißen Hirsch zieht sich wie ein roter Faden durch die Jagdmythologie. So die Sage, dass der, der ohne Notwendigkeit der Nahrungsbeschaffung einen Albino erlegt, binnen Jahresfrist selbst einen tragischen Tod findet. Vielleicht ist ja da etwas dran, dachte ich in diesem Moment.
Ich bin kein Experte für diese Wildart, habe mich aber soweit damit beschäftigt, dass ich, selbst für die Kürze der Beobachtungszeit sagen kann, der hatte mindestens schon seine sieben bis acht Jahre unbeschossen hinter sich. Eine beachtliche Leistung für diese lebende Zielscheibe. Warum sollte gerade ich der Erste sein, der ihn zu Boden streckt?
Das vereinbarte Signal zum Sammeln zeigte sich auf der Uhr und ich verließ meinen Ansitz. In Gedanken wählte ich meine Worte, wie ich meinem Jagdherrn erklären sollte, dass ich zwar ein kapitales Stück vor mir hatte, aber trotzdem nicht geschossen habe. Ich beschloss, ihm nichts von dem wunderbaren Anblick zu sagen. Aber dann, kurz vor dem Sammelplatz, kam mir die Gewissheit, dass die Wahrheit wohl doch das Beste wäre. Zumal ich bei ihm jederzeit mit Verständnis rechnen konnte. Als wir einen Moment allein an der Seite standen, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen.
„Du, ich habe den weißen Damhirsch vor mir gehabt.“
„Und, warum hast du nicht geschossen?“
„Ich konnte einfach nicht. Niemand, der ihn bisher gesehen hat, konnte oder hat auf ihn geschossen.“
„Ich kann dich verstehen, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gekonnt.“
Damit war das Thema für ihn erledigt. Genauso hatte ich mir die Reaktion meines Jagdherren und Freundes vorgestellt.
Sooft wir danach im Revier waren, hielt ich Ausschau nach dem weißen Schaufler. Ich habe ihn nie mehr gesehen und auch nicht gehört, dass er erlegt worden ist. In meinem Kopf geisterte lange danach noch herum, wie ich mich verhalten würde, wenn ich ihm noch einmal begegne. Würde ich dann wohl schießen, nein, ich bin mir da ganz sicher, der Finger am Abzug bliebe gerade. Wild, das wir gesehen aber nicht erbeutet haben, bleibt doch länger und nachhaltiger in der Erinnerung und so verweilen meine Gedanken oft gerade bei diesem Albino.
Mutter Dachs
In unserem heimischen Revier, mit sandigen, wasserdurchlässigen Böden, ist der Dachs eine eher seltene Wildart. Die weiten Kartoffel- und Spargelfelder und der gut durchforstete kleine Waldstreifen im Revier sind nicht gerade der ideale Einstand für Meister Grimbart. Im Revier hatte ich in einem Zeitraum von zwölf Jahren daher nur ein einziges Mal die Gelegenheit, ihn nicht nur im Anblick, sondern auch vor die Büchse zu bekommen.
Der Abendansitz war für mich (erfolglos) beendet und ich war im hellen Mondschein auf dem Weg zum Fahrzeug, um die Heimfahrt anzutreten. Da stand etwa vierzig bis fünfzig Meter vor mir, auf einem schmalen, mit kurzem Gras bewachsenen Wiesenweg zwischen Wald und Wildacker, ein Dachs gegenüber. Er kam in geradem, humpeligen Lauf direkt auf mich zu. Sicher war er genau so überrascht wie ich, nur reagierte ich schneller als er. Meine Büchse war noch unterladen, wurde aber nun blitzschnell repetiert und bevor der Überraschte, als er mich im letzten Augenblick sah, seitlich im Wald verschwinden konnte, lag im Knall der erste, aber nicht der letzte Dachs meines Jägerlebens. Er musste einen langen Anmarschweg hinter sich gehabt haben, in unserem Revier war von einem Dachsbau nichts zu sehen. Über diese seltene Beute habe ich mich allerdings nicht besonders gefreut. Gern hätte ich den einsamen Wanderer wieder zum Leben erweckt. Warum ich aus dem kurzen Moment heraus die Büchse gegen ihn erhoben habe, wurde mir nach diesem Schuss nicht klar. Die Schwarte des Ersten aber ziert nun mein Jagdzimmer, das Schmalz kam zu Eberhard, unserem Jagdaufseher, von dem im Folgenden die Rede sein wird. Bei ihm verblieb aber auch der gestreifte Wildkörper. Was damit geschah, habe ich nicht erfahren, konnte es mir aber denken. In den Abfall ist er gewiss nicht gekommen.
Den zweiten Dachs streckte ich anlässlich einer Gemeinschaftsjagd in Mecklenburg-Vorpommern. Die wenige Freude wie beim Ersten in unserem heimischen Revier kam nun aber erst recht nicht mehr auf. Im Gegenteil, ich bereute den Abschuss schon in dem Moment, in dem der Schuss brach. Was hatte ich mit den Dachsen in einem fremden Revier zu tun. Aber er war nun einmal erlegt und ich konnte ihn nicht wieder lebendig machen. Frei zum Abschuss war er nun einmal. Das war es dann auch. Nicht, dass ich keine Gelegenheit hatte, ich habe einfach keinen mehr erlegt.
Ein Jagderlebnis, oder besser eine Begebenheit der besonderen Art erlebte Eberhard, von dem noch in anderen, weiteren Erzählungen oft die Rede sein wird. Er ist die Seele unseres Reviers, aber nicht nur bei uns, auch in den Revieren unserer Nachbarn. Seine Hilfe ist oft gefragt, zumal alles was mit Arbeiten im Revier zu tun hat, prompt und zuverlässig erledigt wird.
Eberhard hat mir dieses Erlebnis selber berichtet. Wir saßen dabei in der kleinen Küche seines Hauses und während Eberhard erzählte, schaute ich immer wieder zu seiner mit Kochen beschäftigten Frau Elsbeth, der Seele des Hauses, hin. Wenn sie dann bestätigend mit dem frisch ondulierten, weißen Lockenkopf nickte, am Nachmittag hatte sich Kaffeebesuch angemeldet, wusste ich genau, dass das, was Eberhard mir gerade erzählte, die volle Wahrheit war. Nicht, dass mein alter Jagdfreund schwindelte, das wollte ich ihm nicht unterstellen, er überspannte nur manchmal etwas. Er steigerte sich in Dinge, die so gewesen sein konnten, aber nicht immer so waren. Doch nun zu Eberhard und seiner wirklich wahren Geschichte.
Es war Mittagszeit und wie gewohnt stand für ihn pünktlich das Mittagessen auf dem Tisch (Punkt zwölf Uhr, zu jeder Jahreszeit!). An diesem Tag musste aber alles etwas schneller gehen, denn Eberhard hatte einen Arbeitsauftrag vom Förster der Staatsforst, unserem Nachbarrevier, bekommen.
An einem Hochsitz auf der großen Lichtung, einem ihm gut bekannten Ansitzplatz, sollte und musste eine neue Leiter gezimmert, oder vielleicht auch nur ausgebessert werden. Kaum war der Teller geleert, stand Eberhard auch schon in der Garage und machte seinen Wagen mit all dem erforderlichen Werkzeug klar. Ob Elsbeth mit wollte oder sollte, war hinterher nicht mehr so genau feststellbar. Der Abwasch musste jedenfalls warten. Eberhard drängelte auch schon, denn bevor es ans Bauen und Ausbessern ging, musste ja noch die Länge und Anzahl der maroden Stufen ermittelt werden und natürlich der Rundumblick in die Umgebung stattfinden.
Dass Elsbeth ihren Mann ins Revier begleitete, kam sicher nicht oft vor. Ihr bevorzugtes Revier ist nicht unbedingt der Wald, es ist das Haus, die Küche und der große Garten. Aber los ging nun die Fahrt. Der Weg in den Staatsforst war nicht weit, nach wenigen Minuten waren sie am Ziel. Am Rande der Lichtung angekommen, stieg Eberhard aus und marschierte mit Zollstock, Papier und Schreiber bewaffnet zum Hochsitz. Seiner guten Hälfte fiel das Gehen im Wald auf dem unebenen Boden etwas schwer, sie schaute sich derweil die Umgebung der Lichtung lieber aus dem Autofenster an. Das Ganze sollte ja nicht allzu lange dauern. Am Hochsitz angekommen, prüfte unser Jagdfreund nun eingehend und genau die marode Leiter.
Ganz so selbstlos war sein Arbeitseifer allerdings nicht. Der Lohn für seine Tätigkeit konnte schon ein kostenfreier Abschuss auf einen geringen Bock, eine Ricke oder sogar ein Stück Schwarzwild sein. Bargeld gab es vom Forstamt für kleine Arbeiten wie diese sowieso nicht, aber ein Abschuss, von dem man auch noch etwas hatte und die Kühltruhe füllte, machte den handwerklichen Einsatz natürlich lohnenswert.
Ist ein gestandener Jäger wie Eberhard schon einmal im Wald, bleibt es nicht aus, dass er seinen Blick auch in die Umgebung wirft, das war wie schon erwähnt, auch seine Absicht. Und so spähte Eberhard in die Runde, zum Ansitz und anschließenden Abschuss wäre es noch zu früh gewesen. Erst einmal musste die angepeilte Arbeit getan und dann auf die Mitteilung des Försters gewartet werden, ob es die erwartete Belohnung auch gab. Außerdem saß ja Elsbeth wartend im Auto.
Während Eberhard weiter das Gelände musterte, fiel sein prüfender Blick auch auf eine seitliche Buschgruppe. Er glaubte nun, im hohen Gras eine Bewegung gesehen zu haben. Hatte das Auge des Jägers etwas gesehen, was seinen Blick fesselte, so musste er dem auch nachgehen und zwar sofort.
Die Vorarbeit, das Aufmaß und die Besichtigung am Hochsitz, waren ja erledigt und so machte Eberhard sich auf den nicht allzu langen Weg zu dem Ort, an dem er das sich bewegende Gras gesehen hatte.
Sein Erstaunen beim Nähertreten war groß, was sich da bewegte und nun erschrocken zu ihm aufblickte war ein etwa 30 Zentimeter großer Jungdachs. Der Kleine hatte seinen Schrecken überwunden und machte Anstalten, im Gebüsch zu verschwinden. Aber mit Eberhards Schnelligkeit hatte das Dachslein nicht gerechnet. Blitzschnell packte er die Hinterläufe des Flüchtenden, hielt ihn fest und hoch. Den laut schreienden Zappelphilipp vor sich haltend, trat Eberhard nun den Rückweg zum Auto an. Elsbeth, eine Jägerfrau seit vielen Jahrzehnten, hatte noch nie einen Dachs „in natura“ gesehen. Das sollte heute anders werden. Eberhard hatte noch nicht die Hälfte des Weges zurückgelegt, da öffnete sich die Autotür. Elsbeth sprang aufgeregt heraus und rief Eberhard so laut sie konnte entgegen: „Hinter dir, sieh dich um“.
Das tat Eberhard dann auch. Er glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Was er da sah, war ein ohne jede Scheu auf ihn zukommender, ausgewachsener Dachs. Ganz offensichtlich war es die Mutter des laut schreienden Kleinen in seinen Händen. Im schwerfälligen Trott, aber trotzdem in ziemlichem Tempo näherte sich die Dächsin den Beiden. Unser Jagdfreund, stark gehbehindert durch einen schweren Unfall, und somit im Laufen nicht der Schnellste, ließ seinen „Fund“ vorsichtig zu Boden gleiten und humpelte, so schnell ihn seine Beine trugen zum rettenden Auto. Ende gut, alles gut. Alle Beteiligten waren glücklich. Eberhard, der wohlbehalten neben seiner Elsbeth im Auto saß und das wiedervereinte Paar, Mutter Dachs mit Nachwuchs. Im gemütlichen Trott begaben sich die Beiden wieder an die Stelle, wo der kleine Dachs vordem im Buschwerk verschwinden wollte. Sicher war dieser Kleine nicht ihr einziges Junges, aber ganz sicher der Mutigste der Nachwuchsschar, die irgendwo im Wald auf die Mutter wartete.
Dachs, Foto: Siegfried Stein
Als sich die Aufregung bei Eberhard und Elsbeth etwas gelegt hatte, freuten sich beide darüber, dass Elsbeth gleich zwei Dachse an einem Tag in freier Wildbahn gesehen hatte. Und mit Sicherheit begleitet sie ihren Mann mal wieder in den Wald. Einer muss ja auf ihn aufpassen.
Ich habe diese Geschichte aufgeschrieben und Eberhard zu lesen gegeben. Er hat mir bestätigt, dass jedes Wort wahr ist: „Genauso ist es gewesen.“
Hirschjagd in der Schorfheide
Den ersten Hirsch in meinem, damals noch jungen Jägerleben, streckte ich am Tag der Grenzöffnung am 9. November 1989 in der Schorfheide, einem für uns „Westler“ noch völlig unbekanntes Jagdgebiet, nördlich von Berlin. Diesen Tag hatten meine Jagdkollegen und ich natürlich nicht im Voraus festgelegt, er ergab sich einfach aus dem zeitlichen und somit geschichtlichen Ablauf. Von mir wurde der Hirsch später der „Einheitshirsch“ genannt und so benannt, hängt er immer noch an der Trophäenwand im Jagdzimmer. Zwar war die Einheit, die sich viele nicht vorstellen konnten, noch nicht vollständig erfolgt, aber das war nur noch eine Frage der Zeit.
Doch die Vorgeschichte zu dieser einmaligen Jagd, und gerade an so einem denkwürdigen Tag, lag aber noch etwas weiter zurück.
Unser Hegeringleiter, im heimatlichen Revier ein gestandener Jäger, hatte Verwandte in der DDR und lernte bei früheren Besuchen, die ihm wohl möglich waren, dort auch einen Förster kennen. Bei seinen weiteren Besuchen kamen sich der Förster in der „Noch-DDR“ und unser Hegeringleiter in Gesprächen näher. Wenn über die Jagd gefachsimpelt wird, treten bekanntlich unter Jägern keine großen Probleme auf, politische schon gar nicht. So traten beide in einen regen Erfahrungsaustausch, der sich dann in einem Briefwechsel über die bestehende Grenze hinweg, fortsetzte. Nach der teilweisen Grenzöffnung häuften sich die Besuche unseres Hegeringleiters bei seiner Verwandtschaft. So traf er auch hin und wieder auf den ihm nun schon bekannten Förster. Während der Fachsimpelei der beiden Weidmänner tauchte naturgemäß auch die Frage nach einer Jagdmöglichkeit auf. Der Förster kannte Frau K., eine Jagdleiterin im Revier R… in der Schorfheide als kompetente Ansprechpartnerin, in deren Bereich auch auf einen Hirsch gejagt werden konnte, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Das konnten natürlich nur die politischen sein und die waren nun gegeben.
Jäger Brandes, von ihm ist hier die Rede, in unserem Revier der Hegeringleiter und zugleich auch unser Ortsbürgermeister, ließ sich das nicht zweimal sagen und machte sich umgehend auf den Weg in die Schorfheide, dem uns so unbekannten Eldorado aller Rotwildjäger in der nun zusammenfallenden DDR.
Wer den Namen Schorfheide als Jäger schon einmal gehört hat, weiß sicherlich sofort Verbindungen mit Persönlichkeiten der Politik herzustellen, ob im positiven oder negativen Sinne. Auf jeden Fall ruft die Nennung dieses Namens bei gestandenen Hirschjägern Herzklopfen hervor.
R..., abgelegen, wie ein Dorf und Forstbetrieb in unserem dicht bevölkertem Land überhaupt nur sein kann, war der Wohnsitz von Frau K. in einem stattlichem Forsthaus mit einigen Nebengebäuden, direkt an einem trocken gefallenen Seegelände. Hier traf Jäger Brandes in einem freundschaftlichen Gespräch, bei einem Besuch, auf ihre Bereitschaft, nun auch westdeutsche Jäger in diesem schönen, weitgehend naturbelassenen Landesteil jagen zu lassen, da auch die politischen Voraussetzungen nun sicherlich bald gegeben seien. Jäger Brandes kam mit der frohen Botschaft in unseren Ort zurück, dass wir auf Rotwild bis zu einer bestimmten Gewichtsklasse und zu einem bestimmten Preis jagen dürften. Einem Jäger sollte jeweils ein Hirsch zustehen. Der Termin sollte ganz kurzfristig bekannt gegeben werden, der dann auch, heiß erwartet, kam.
Heinrich und Siegfried, meine Jagdkameraden aus dem heimischen Revier, und ich machten uns für die Reise in ein für uns völlig neues Land fertig, alles war perfekt vorbereitet und dann auch noch genau an diesem historischen Tag. In der Nacht vor unserer Abfahrt hatte ich kaum geschlafen. Die Waffe, die Munition und ein kleiner Koffer, ja ein kleiner Koffer, wie für eine Reise in ein fernes Land, standen gepackt bereit. Beim ersten Licht des Tages rollten Heinrich und Siegfried mit dem Auto vor meine Haustür. Ab ging die Fahrt, von allen guten Segenswünschen begleitet.
Ein unglaubliches Erlebnis erwartete uns am Grenzübergang Marienborn. Es gab keine Grenze mehr. Die sperrigen Anlagen waren zwar noch vollständig vorhanden, aber alles lag leer und verlassen da. Wir konnten ohne Stopp „hinüber“ fahren, niemand hielt uns an, keine Kontrolle hinderte unsere Fahrt. Mit einem Mal war unser Vaterland größer geworden. Wir fühlten klar den großen Augenblick, schauten links und rechts aus dem Autofenster und freuten uns darüber, dass wir das erleben durften, wovon zwei Generationen geträumt haben. Im Dunst des frühen Tages tauchten in der Ferne, auf der rechten Seite, die beiden Türme des Magdeburger Domes auf. Am liebsten hätte ich jetzt sofort einen kleinen Abstecher dorthin unternommen. Unser Ziel lag an diesem Tag jedoch noch etwas weiter entfernt.
Den schlechten Zustand der Autobahn in Richtung Osten kannte ich von früheren Fahrten nach Berlin. Aber nun machte uns dies alles nichts mehr aus. Das sonst übliche Nörgeln über den Straßenzustand unterblieb. Man konnte sagen: Wir waren richtig glücklich. Auf der anderen Seite der Autobahn rollte in großer Zahl eine Autokolonne in Richtung Westen, eine blaue Abgaswolke hinterlassend, wie ich es noch nicht erlebt hatte. Trabbi an Trabbi mit offensichtlich ganz fröhlichen Insassen, die uns im Vorbeifahren lustig zuwinkten und manchmal auch ihrer Freude durch anhaltendes Hupen Ausdruck verliehen.
Am östlichen Berliner Ring trafen wir noch auf eine kurze Strecke kopfsteingepflasterte Autobahn und kurz vor unserer Abfahrt Joachimsthal standen sogar „Trabbis“ von Pilzsuchern am Straßenrand. Dass so etwas auf einer Autobahn möglich war, erstaunte uns doch sehr.
Dank einer guten Wegbeschreibung fanden wir unser Ziel. Es war aber doch gar nicht so einfach. Kurz vor R… durchfuhren wir ein weit geöffnetes zweiflügeliges Tor, von dem aus beidseitig ein hoher Maschenzaun im Wald verlief. Später erfuhr ich, dass wir uns im eingezäunten Bereich befanden. Hier hatten die politischen Größen der zerbröckelnden DDR gejagt.
Ich beschrieb es bereits, etwas Abgelegeneres als R… in der Schorfheide konnten wir uns kaum vorstellen. Dort angekommen war unsere Begrüßung und Meldung bei der Jagdleiterin, Frau K. schnell erledigt. Ich nahm Quartier im Ort und meine beiden Jagdkameraden zogen nach F…, einige Kilometer entfernt in einen Plattenbau, mit in die enge Wohnung von Mitjäger Heinrichs und Siegfrieds Jagdführer Wilhelm. Von Wilhelm soll aber später noch die Rede sein.
Die nächsten Tage während der Jagd auf den Hirsch, sollte mein Zuhause ein kleines gemütliches Zimmer bei dem zuständigen Förster, in einem Nebengebäude, gleich neben dem Forsthaus, sein.
Nach der Erledigung der wenigen Formalitäten war es erst früher Nachmittag, so wollten wir bereits an diesem Abend den ersten Pirschgang unternehmen.
Meine wenigen Sachen waren schnell verstaut und ich machte meinen Antrittsbesuch bei der Frau des Försters und den beiden, noch schulpflichtigen Töchtern. Die Herzlichkeit schlug sofort über. Sicherlich war ich an diesem Tag der erste Westdeutsche im Ort, aber Probleme im Gespräch gab es nicht im Geringsten. Die Familie nahm mich in ihrem Heim auf, als wäre ich ihr ganz persönlicher Gast. Es war das erste Mal, dass ich ein Forsthaus von innen sah. Die alten Jagdbilder an den Wänden, die vielen Trophäen, zusammen mit den geschnitzten Möbeln, dazu im Gegensatz die junge Familie, hinterließen in mir einen bleibenden Eindruck. Viel Zeit zum Klönen und Erzählen blieb nicht, denn „mein“ Förster Wolf drängte auf den ersten Gang ins Revier. Nach ungefähr dreißig Minuten war ich, in jagdliches Grün umgekleidet, der Repetierer mit drei Schuss geladen und mit Nachschub in der Tasche, bereit.
Einfügen möchte ich an dieser Stelle aber noch etwas über meine Waffe. Heinrich, mein Jagdkamerad und Jagdherr im heimischen Revier, fragte auf der Fahrt nach dem Kaliber meiner Waffe.
„30-06 KS mit 9,7 Gramm“ war meine Antwort.
Worauf mir Heinrich antwortete: „Mit der Kugel läuft der Hirsch sicher noch bis nach Polen“.
Da kamen mir Bedenken, aber ich hatte nun mal dieses Kaliber, meine Waffe war damit sauber eingeschossen. Für unser heimisches Revier war es bisher ausreichend gewesen, denn Rotwild gab es bei uns nicht und für die Sauen und Rehe hat das von mir geschossene Kaliber stets ausreichende Wirkung gezeigt. Heinrich und Kamerad Siegfried schossen stärkere Kaliber in den acht Millimeterbereichen. Ganz genau schossen sie das Superkaliber 8x68 S. Aber es sollte in der Folge bei Heinrich noch anders kommen. Doch davon später mehr.
Wir durchschritten eine kleine Pforte hinter dem Forsthaus und waren direkt im noch herbstlich verfärbten Wald. Weiter ging es auf einem gut zu begehenden, sauber geharkten Weg, der direkt, nach nur etwa 400 Metern links vom Wegrand wegführte, zu einem verkleideten Ansitzschirm, von dem man einen freien Ausblick auf eine mit kurzem Gras bestandene Lichtung hatte. Die Lichtung wurde durch einen kleinen Bach durchschnitten, der ziemlich genau die Wiese in zwei Hälften teilte, an den Rändern aber völlig ohne Bewuchs war.
Geräuschlos betraten wir den Schirm und sofort machte „mein“ Förster mich mit einer stummen Handbewegung aufmerksam, jede Hantierung zu unterlassen und zur Wiese hinzuschauen. In ungefähr 150 Metern Abstand stand ruhig äsend ein Rudel Rotwild, fünf Tiere und ein Hirsch, dessen Geweih ich aber nicht vollständig sehen konnte. Ein kurzer Blick des Försters durch das Glas zum Rudel und sein leises, nur gezischtes Kommando lautete: „Schießen“. Offensichtlich kannte er den Hirsch von vorangegangenen Pirschgängen. Mein Herz schlug nicht mehr da, wo es eigentlich seinen Platz hat. Ich nahm die Schussposition ein. Wie sich alles Weitere aneinander reihte, ist mir entfallen.
Ich hatte den Hirsch jedenfalls gut im Zielfernrohr, suchte das Blatt und der Schuss brach. Das Rudel Kahlwild flüchtete zum nahen Wald und „mein“ Hirsch folgte.
Aber nach einer kurzen Strecke von vielleicht 10 oder 15 Metern knickte er mit den Hinterläufen ein, zog sich mit den Vorderläufen noch etwas weiter und brach zusammen. Ich war von dem Erlebten so benommen, dass ich wie gebannt zur Wiese und zum nun liegenden Hirsch schaute. Dazu muss ich gestehen, dass ich vordem noch gar keinen Hirsch, außer im Zoo und im Gehege in Springe gesehen hatte. Alles war in einem atemberaubenden Zeitraum von wenigen Minuten geschehen. Zu einem eventuell erforderlichen Nachschuss wäre ich vor Aufregung vielleicht gar nicht im Stande gewesen.
Wir gingen nach einer kurzen Pause zu dem gefallenen Recken und ich konnte mich an den Anblick nicht sattsehen. Förster Wolf brach vom nächsten Baum einen Zweig, ich denke es war Eiche und überreichte ihn mir in feierlicher Haltung als Erlegerbruch, den ich mir stolz an den Hut heftete.
Dann ging es ans Aufbrechen. Zwar leistete ich tatkräftige Mithilfe, den Großteil erledigte aber Förster Wolf. Sicherlich wäre das Aufbrechen meine Aufgabe gewesen. Rehe hatte ich schon versorgt, ebenso ein Stück Schwarzwild, aber einen Hirsch, das traute ich mir auch nach vier Jahren als Jagdscheininhaber noch nicht zu.
Ich hielt die „Totenwache“ am Hirsch, während Wolf ein Fahrzeug zum Abtransport holte. Diese Wache hätte Stunden dauern können. Immer wieder befühlte ich das Geweih und besah mir „meinen“ Hirsch. Zwischenzeitlich war es auch völlig dunkel geworden. Doch dann tauchten die Lichter vom Auto auf und der Abtransport war schnell erledigt und damit meine erste Hirschjagd.
Ich bedauerte, dass die Jagd für mich nach so wenigen Stunden in der Schorfheide viel zu schnell beendet war. Erst viel später, schon wieder zu Hause, kam mir der bestimmt nicht falsche Gedanke, dass das doch eigentlich gar keine richtige Jagd war.
In gemütlicher Runde sollte später gemeinsam mit den Jagderfolgen meiner beiden Mitjäger und Freunde gefeiert werden.
Das Revier, in dem wir weidwerkten, war vormals das Revier eines hohen „DDR-Funktionärs“ und dieser hatte mit Sicherheit seine Freude an der hohen Anzahl Hirsche.
Aber zum Schlafengehen war ich an diesem Abend noch längst nicht bereit. Die Nacht war sternenklar und der Jahreszeit gemäß auch entsprechend kühl. Im nahen, trocken gefallenen Seebruch schrien die Hirsche dicht bis an den Rand des Geländes. Es war eine Musik, wie sie schöner und ergreifender gar nicht sein konnte. Ich stand einen Großteil der Nacht, ohne müde zu werden, am Zaun zum Seebruch und hörte die Schreie der Hirsche aus einer Nähe, wie noch nie und auch nie wieder in meinem noch relativ kurzen Jägerleben.
Meine Gedanken gingen nach Hause und ich malte mir aus, wo das Geweih wohl seinen Platz haben würde. Es war ein Erlebnis, wie ich es nie wieder mit solcher Intensität erlebt habe.
Später, abgekocht und gewogen, brachte das Geweih etwas über 6 Kilogramm auf die Waage, es hatte zwar eine Aug- und Eissprosse auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Mittelsprosse, sehr lange Stangen und statt einer Krone Gabeln. Es war ein Abschusshirsch, wie er sein sollte. Eine „Schönheit“ war er leider nicht.
Da gab es am anderen Tag noch ein kleines Erlebnis in der Begegnung zwischen „Ost und West“, das mir etwas über die Mentalität des Einzelnen zu denken gab. Bei der Jagdleiterin hatte sich auch ein Ehepaar aus unserem Nachbarort angemeldet. Der Mann war Jäger und gehörte zu unserem Hegering. Seine Frau kam als nichtjagende Begleitperson mit. Persönlich kannte ich diesen Jäger aber nicht. Er wollte, genau wie wir, auf einen Hirsch weidwerken. Als Unterkunft sollte die Dachkammer im Haus der Jagdleiterin dienen, so war es gedacht.
Nach einer Besichtigung der angebotenen Unterkunft sagte das Ehepaar dankend ab und quartierte sich auf große Entfernung zum Revier in einem gerade neu eröffneten Hotel der oberen Preisklasse ein.
Mit der freundlichen, aber nun etwas verunsicherten Jagdleiterin besichtigte ich die Kammer und konnte ihr zur Beruhigung bestätigen, dass die Unterkunft auch für einen Jäger aus der kapitalistischen „BRD“ völlig ausreichend war. Nun, die Dachkammer war bescheiden mit zwei Betten, zwei Stühlen, einem Tisch und einem Schrank möbliert. Für die Jagd in den wenigen Tagen war aber wirklich alles bestens, zumal auch die Nähe zum Revier gegeben war. Dann kam auch noch hinzu, dass es die Jagdleiterin selbst war, die diese Übernachtungsmöglichkeit anbot. Ich habe mich für das Verhalten dieser, unserer Leute, etwas geschämt. Die Entscheidung des Ehepaares blieb nicht ohne Folgen, er hatte kein Jagdglück und fuhr nach drei Tagen als „Schneider“ wieder nach Hause. Da hatte vielleicht die Jagdleiterin ihre Hände im Spiel.
So gut wie ich es mit meiner komfortablen Unterkunft während der Jagdzeit getroffen hatte, hatten es meine beiden Mitjäger leider nicht. Sie mussten mit einer sehr beengten Situation in der Plattenbauwohnung von Jagdführer Wilhelm vorliebnehmen, waren damit aber dennoch sehr zufrieden. So wie richtige Jäger es eben sind.
In den weiteren Nächten bis zu unserer Rückfahrt hörte ich mehrfach Schüsse in der Umgebung meines Quartiers. Zwar galten noch die alten Jagdgesetze der „untergegangenen DDR“, die wurden nun aber völlig ignoriert. Der Übergang zu der neuen Gesetzgebung war noch nicht erfolgt und so bediente sich manch eingesessener Jäger mit einem Stück Wild, wofür er noch kurze Zeit vorher streng bestraft worden wäre.
Auf der Rückfahrt zu unserem Wohnort wollte Heinrich noch einmal das Kaliber meiner Waffe wissen, nun wirkte er doch sehr nachdenklich. Leider hatte er kein Glück, auf den ersten Schuss „seinen“ Hirsch zur Strecke zu bringen.
Da unsere Jagd nun für alle Beteiligten ein gutes Ende gefunden hatte, sollte Heinrichs Hirsch aber doch noch einmal Erwähnung finden.
Ganz dicht bei meiner Unterkunft saß Heinrich mit Wilhelm, seinem Führer auf dem Ansitz, auf dem vor kurzer Zeit noch ein hoher, beinamputierter Parteifunktionär seinen Sitz hatte. Der Sitz hatte es in sich, davon konnte ich mich später überzeugen. Eine breite Holztreppe mit Podest in der Mitte führte hinauf. Oben hätten bequem vier Jäger reichlich Platz gehabt, alles war überdimensioniert.
Es dämmerte bereits, aber die Sicht war noch gut, als nach etwa einer Stunde Wartezeit aus dem abendlichen Nebeldunst ein Hirsch auf ca. 100 Meter langsam, seitlich vorbeizog. Das Geweih zeigte sich deutlich in der am Horizont untergehenden Sonne.
Wilhelm löschte seine Zigarette, steckte die Kippe ein, nahm das Glas und konnte Heinrich berichten: „Der passt, den kannste schießen.“
Heinrich ist bei uns im Revier und auf dem Schießstand als guter, als sehr guter Schütze bekannt. Der legt nun an, der Schuss bricht, mit dem vordem geschilderten Kaliber und der Hirsch ist aus dem Blickfeld der beiden Jäger verschwunden. Untergetaucht im hohen Schilf.
„Den hast du getroffen, der liegt, hab ich klar gesehen. Jetzt machen wir ‘ne kleine Pause. Ich rauche meine Zigarette weiter und wir nehmen einen Schluck aus meiner Pulle, dann gehen wir hin.“
So entschied es Wilhelm und so wurde es auch gemacht. Die Zigarette war aufgeraucht und der Schluck genommen. Sie erhoben sich aus der hockenden Stellung hinter der geschlossenen Brüstung, sahen nach vorn und dort stand in etwa der gleichen Entfernung wie beim ersten, wieder ein Hirsch.
Wilhelm nahm erneut sein Glas, schaute hindurch und wandte sich an Heinrich: „Heinrich, wenn du willst kannste den auch noch erlegen. Der Preis bleibt der Gleiche, wie vom ersten Hirsch. Ausnahmsweise.“
Man ist schließlich in der Schorfheide auf den Hirsch und Heinrich, kein armer Mann, überlegt nur ganz kurz, bringt den Repetierer in Stellung und ein weiterer Schuss hallt über das abendliche Gelände. Wieder eine Pause, aber nun viel kürzer. Beide machen sich auf den Weg zum Ort der Tat. Ich will die Geschichte abkürzen: Es lag nur einer dort. Der zuerst Beschossene ist wieder aufgestanden und wollte sich gerade verabschieden, als ihn die zweite Kugel traf. So kann es eben gehen. Die Geschichte mit dem doppelten Schuss habe ich von Wilhelm erzählt bekommen. Heinrich hat sie erst bedeutend später selbst und genauso erzählt.
Wie man so schön sagt: „Ende gut, alles gut“ und so hatte am Ende einer erlebnisreichen Jagd jeder von uns seinen Hirsch. In den folgenden Jahren habe ich noch so manchen Hirsch, auch in der Schorfheide, erlegt, aber mein „Einheitshirsch“ ist in der Erinnerung am Stärksten haften geblieben.
Es war Herbst geworden, die Bäume hatten ihr Laub verfärbt und die große Zeit der Hirsche war heran. Ich war erneut zur Jagd auf den König der Wälder in die Schorfheide, nördlich von Berlin, eingeladen. Mein Jagdfreund Wolf hatte die notwendigen Formalitäten für mich bereits erledigt. Die Zeiten von meinem ersten Besuch, gleich nach der politischen Wende, hatten sich nun sehr verändert. Damals, zur ersten Jagd auf den Hirsch, verlief noch alles völlig unbürokratisch, es waren keinerlei Formalitäten erforderlich. Aber das war nun Geschichte, mein Jäger hatte mir alles telefonisch mitgeteilt und mein Wagen rollte mit viel Hoffnung in Richtung Hirsch.
Noch war ich aber nicht an meinem Ziel in R. angekommen.
Im Gegensatz zu meiner ersten Fahrt, gleich nach der „Wende“, die ich mit zwei Jagdfreunden unternahm, brauchte ich den Weg nun nicht mehr zu suchen. R. liegt versteckt mitten im Wald, in der Schorfheide, die den Namen Heide als riesiges Waldgebiet eigentlich nicht verdient. Die winzige Ortschaft ist nur auf einer „Holperstrecke“, einer alten preußischen gepflasterten Landstraße, wie man sie in Brandenburg noch häufig antrifft, zu erreichen. Nachdem ich den nun heruntergerissenen Zaun passiert hatte, der die Schorfheide in diesem Bereich umgab, lag mein Ziel vor mir. Die Vorfreude auf das, was mit der Jagd kommen sollte, erfüllte mich total.
Sehr herzlich wurde ich auch dieses Mal von Wolf, dem Förster, und seiner Familie begrüßt und bezog anschließend „meine“ Kammer im Nebengebäude des Forsthauses. Diesen Raum bewohnte ich bereits bei meinem ersten Besuch. Die Stunde zum ersten Gang ins Revier war noch nicht heran und so hatten wir ausgiebig Zeit, einige Jagderlebnisse auszutauschen, aber auch der Zeit zu gedenken, die zwischen diesen beiden Besuchen lag.
Wie schnell hatte sich doch alles verändert, stellte ich bereits bei meiner Ankunft fest. Selbst in der engeren Umgebung des Forsthauses gab es so manches nicht mehr. Die nahe Drahtfabrik für Wildschutzzäune hatte ebenso wie das etwas entfernte Betonwerk den Betrieb eingestellt. An neue Arbeitsplätze war für die Menschen hier nicht zu denken. Mit Sicherheit machte sich bei den Leuten eine leichte Ernüchterung nach der großen Freude bemerkbar. Aber alle sahen es noch nicht so negativ, keiner wusste, was auf ihn zukommen würde. Besonders erfreulich war die nun eingetretene Ruhe. Die Russen hatten den Flugbetrieb auf dem nahen Landeplatz für Düsenjets eingestellt.
Mein Stammplatz war auch dieses Mal das „berühmte“ Sofa im Jagdzimmer des Forsthauses. Genau auf der Stelle, direkt an der linken Lehne, saß zu bestimmten Zeiten der Staatsratsvorsitzende der DDR, Erich Honecker. Hier wartete er auf den Beginn der Jagd, denn Wolf war bei einigen Jagden sein Führer. Wie kam es dazu? Honeckers Jagdgebiet war zwar nicht R. allein, aber zu unbestimmten Zeiten sollte es eben R. sein. Während einer angesetzten Jagd wollte sich der Erfolg für den großen Weidmann Honecker in dem trocken gefallenen Seegebiet, gleich neben dem Forsthaus, einfach nicht einstellen. Am Rande des ehemaligen Sees, in Schussrichtung dorthin, stand und steht wohl noch bis zum heutigen Tag der Sitz. Obwohl Honecker ein Erfolg gewohnter Jäger war, dem auch schlechtes Wetter so schnell nichts ausmachte, es aber nun zu regnen begann und der Sitz keine Überdachung hatte, brach er den Ansitz ab. Sein Fahrer konnte diesen unverhofften Abbruch nicht ahnen und war daher noch nicht zurück. Sonstiger Begleitschutz war um diese Zeit nicht vorhanden. So stand der Staatsratsvorsitzende der DDR etwas verloren, unter einer Kastanie am Straßenrand in R. Mein Jäger Wolf, der eigentlich bis dahin mit den Jagden Honeckers direkt nichts zu tun hatte, kam gerade aus seinem Revier und sah den „großen Jäger“, den Chef über die Schorfheide, dort verloren stehen.
Natürlich erkannte Wolf sofort wer da stand, ging auf ihn zu und bat ihn für die Dauer der Wartezeit in sein Haus, welches nur einige Meter entfernt stand. Honecker nahm die Einladung gerne an und verbrachte so die Wartezeit, vielleicht eine halbe Stunde, bei „meinem“ Jäger, genau auf dem Sofa, dessen Platz ich jetzt innehatte. Honecker muss die Unterhaltung mit Wolf und der Platz auf dem Sofa so gefallen haben, dass er, wenn er in R. jagen wollte, Wolf nun als seinen Jagdführer auserkoren hatte. Bei jedem dieser Besuche, eigentlich waren es ja keine Besuche, sondern für Wolf Dienstantritte, saß Honecker auf diesem bewussten Sofa in seiner Ecke. Besondere Vorteile hatte Wolf aus diesen Führungen nicht gezogen. Genau das Gegenteil war nach der politischen Wende der Fall. Für seine „Gänge“ mit dem Staatsratsvorsitzenden bekam er die Ablehnung seiner Kollegen nach der Wende zu spüren, die er wirklich nicht verdient hatte.
Glaubten seine einstigen Kollegen nicht, dass es nur eine Tüte Südfrüchte war, die Honecker manchmal, aber auch nur manchmal, für die Töchter mitbrachte. Welche besonderen Vorteile hätte er auch erzielen können? Dass Wolfs schon betagter Vater, der mit der Mutter auf dem gleichen Grundstück ein kleines, gemütliches, mit Hirschgeweihen an den Wänden versehenes Häuschen bewohnte und Honeckers Hirschlagerbuch über verschiedene Jagden führte, hatte ebenfalls keinen Einfluss auf besondere Vergünstigungen. Das kleine elterliche Backsteinhaus durfte ich später besuchen und fand hier eine Jagdklause, wie aus früheren, geschilderten Zeiten.
Immer noch auf dem Sofa sitzend, erfuhr ich weiteres Interessantes. Die zu „DDR-Zeiten“ in Wolfs Revier beschäftigten Brigaden, zuständig für Fütterungen, Jagdeinrichtungen und Wildäcker, waren entlassen und das vormals in einem Übermaß vorhandene Rotwild war merklich weniger geworden.
Die Zeit für den ersten Pirschgang, der mit einem Ansitz enden sollte, war nun herangekommen. Meinen Jagddress hatte ich schon an, die Waffe war schnell geholt und schon pirschten wir den Hauptweg vom Forsthaus entlang durch den Wald, auf sauber geharktem Pirschweg. Für mich wieder eine völlig ungewohnte Jagdsituation. War ich in unserem Revier die Weite der Felder und Wiesen gewohnt, die immer nur von kleinen Waldstücken unterbrochen waren, sah es hier beim Pirschen ganz anders aus. Die Bäume standen dicht an dicht beieinander, sodass ich mich ganz auf die guten Augen meines Jagdführers verlassen musste. Doch da ergab sich eine Situation, die mich ins Staunen versetzte.
Wolf hatte an einer etwas lichten Stelle im Wald einen Hirsch ausgemacht. Wir waren zu diesem Zeitpunkt erst ungefähr dreißig Minuten gepirscht. Er machte mich aufmerksam und ich sah den Hirsch nun ebenfalls. Der trug für meine Begriffe ein Geweih mit mächtiger Auslage auf dem Haupt. Wolf machte mir aber schnell klar, dass dieser Hirsch für mich nicht in Frage kam, der war für höhere Persönlichkeiten vorgesehen. Wir duckten uns hinter einen Busch, der Wind kam für uns von der richtigen Seite und so konnten wir beobachten, wie der König sich in ruhigem Schritt einem etwa 1,80 Meter hohen Wildschutzzaun näherte und diesen aus dem Stand mit einem Satz übersprang. Ich war tief beeindruckt, hatte ich doch diesem schweren Tier eine solche Leichtigkeit des Sprunges nicht zugetraut. Ich sah dem Davonziehenden mit etwas Wehmut nach. Ein langes Hirschleben hatte der bestimmt nicht mehr vor sich.
Aber uns führte der Weg weiter durch den herbstlichen Wald. Weiteres Wild kam uns nicht mehr in Anblick und so suchten wir auf einem sauber ausgeharkten Pirschweg den offenen Ansitz auf. Die Lichtung, an deren südlichen Rand wir uns ansetzten, war etwa einen Hektar groß und mit Kiefern umstanden. Das Gras darauf hatte schon die herbstliche Färbung angenommen, alles war gut zu erkennen. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, begann das Warten. Nach etwa einer halben Stunde wechselte eine Bache mit fünf noch gestreiften Frischlingen an, die wir in dem kurzen Bewuchs und auf etwa 80 Metern gut beobachten konnten. Eine Ricke mit ihrem Nachwuchs äste in gehöriger Entfernung zur Bache und ich glaubte, noch einen Fuchs am Rande der Lichtung gesehen zu haben. Langweilig wurde es nicht einen Augenblick.
Gerade der Anblick der Bache mit dem Nachwuchs zu dieser Jahreszeit gab mir die Gewissheit, dass Bachen zu unbestimmten Zeiten frischen. Aber nun wurde es doch dunkel. Wolf sah mich fragend an: „Brechen wir ab und versuchen es morgen früh noch einmal?“. Mir war es recht, morgen dann noch einmal. Jagdzeit für mehrere Tage hatte ich mitgebracht. Die Bache hatte sich zwischenzeitlich wieder mit ihrem quirligen Nachwuchs zurückgezogen, auch die Ricke hatte sich verabschiedet und wir packten unsere Sachen zusammen. Als erster verließ ich den Ansitz, stand schon auf der Mitte der Leiter nach unten, da rief mir Wolf von oben leise zu: „Komm schnell, er ist da!“
Gemeint war natürlich der Hirsch, den Wolf für mich in den vorangegangenen Tagen bestätigt hatte. Wieselflink war ich wieder auf dem Ansitz. Durchs Glas konnte ich an der rechten Waldkante drei Stücke Wild erkennen. Dass es Hirsche waren, war wegen der Dunkelheit schwer zu erkennen und ich sah sie erst auf dem zweiten Blick bei 8-facher Vergrößerung. Wolf flüsterte mir zu: „Rolf; es ist der Mittlere. Er hat noch zwei Beihirsche bei sich. Kannst du noch schießen?“ Ein Blick durch das Zielfernrohr ließ klar noch drei Wildkörper erkennen, aber welcher „mein“ Hirsch war, das war für mich nicht deutlich zu sehen.
Wolf sah durch sein Glas natürlich bedeutend mehr und besser als ich durch das Zielfernrohr und erklärte mir, dass der ganz rechts stehende der „Richtige“ war. Ich visierte ihn an und da er langsam in eine Richtung zog, konnte ich auch das schwer zu erkennende Blatt als Zielpunkt ausmachen. Dann krachte der Schuss und ich hörte deutlich den Kugeleinschlag des 30-06, KS Projektils. Dann folgte ein Krachen und Brechen im Unterholz und die Fläche war leer.
Einen Augenblick verharrten wir noch. Die obligatorische Zigarettenpause entfiel beziehungsweise wurde stark abgekürzt, wir sind beide Nichtraucher, und so begaben wir uns zum Anschuss. Mittlerweile war es aber völlig dunkel geworden. Wir brauchten zum Glück aber nicht lange suchen, denn der Hirsch lag genau an der Waldkante.
Auf seiner letzten Flucht war er mit der vollen Wucht seines Laufes gegen die einzige Eiche gekracht, die dort zwischen den Kiefern stand und auf der Stelle verendet. Die Rinde des Baumes war stark beschädigt. Ein Auto, mit langsamer Fahrt, hätte nicht mehr Schaden an der Baumrinde anrichten können. Ich konnte es noch nicht fassen, vor mir lag „mein“ Hirsch. Es war ein guter, ungerader Vierzehnender mit einer sehr starken Perlung.
Im Aufbrechen von Hirschen war meine Erfahrung noch nicht so gut, aber ich konnte Wolf bei dieser Arbeit doch schon tüchtig unterstützen. So wurde ich zum Beleuchter, denn inzwischen war es tiefschwarze Nacht geworden.
Da die Nächte schon sehr kühl waren, bargen wir den Hirsch erst am nächsten Morgen, wobei einige dort noch beschäftigte Waldarbeiter dabei eine Hilfe waren. Wolfs alter VW Käfer kam wieder zum Einsatz und am frühen Vormittag hing der Hirsch schon im Kühlhaus. Den nächsten Tag verbrachte ich im Forsthaus, das Geweih musste erst begutachtet, abgekocht und gewogen werden.
Dabei lernte ich „Hermann“ kennen. Seinen eigentlich richtigen Namen kannte ich nicht. Er wurde so gerufen und hatte auch nichts dagegen, weil er im Aussehen und Sprachgebrauch einem großen Jäger glich, der nicht nur in der Schorfheide ein unrühmliches Erbe hinterlassen hatte.
„Hermann“ war wie Wolf Förster in einem etwas entfernteren Revier und er erzählte mir Geschichten, an deren Glaubwürdigkeit man doch zweifeln konnte. Aber die Ernsthaftigkeit, mit der Hermann seine Geschichten erzählte, ließ die Zweifel an der Wahrheit doch erst recht spät oder gar nicht aufkommen. Seine vitale Art und sein markantes Aussehen machten es leicht, ihm so manches abzukaufen.
So erzählte er mir die folgende Geschichte mit dem „Ansitz“:
„Ich sitze also auf meinem gewohnten Ansitz und träumte etwas vor mich hin. Es war ein schöner Herbstnachmittag. Die Sonne schien und an Schießen wollte ich nicht denken. Da sehe ich doch seitlich vor mir einen starken Hirsch in einer Entfernung von etwa 50 Metern. Da ich nicht zum Schießen aufgelegt war, lautete die Parole, den Hirsch beobachten. Der ging eine kurze Strecke, gerade über eine Lichtung, machte plötzlich einen Sprung von mindestens zwei Metern, ging ganz ruhig weiter und war hinter den nächsten Bäumen verschwunden.
Nanu dachte ich, was war das? Döste weiter auf meinem Ansitz vor mich hin. Nach etwa einer Stunde kam derselbe Hirsch aus der anderen Richtung zurück, verhoffte kurz, machte wieder einen gewaltigen Sprung und zog weiter, aus meinem Blickfeld heraus.
Donnerwetter, erst war ich erstaunt darüber, aber dann fiel mir ein, hier war ja bis vor wenigen Monaten ein Wildschutzzaun. Das wusste dieser alte Recke doch noch ganz genau. Nur, dass dieser Zaun nun nicht mehr da war, das hatte er wohl noch nicht bemerkt“.
Solche und andere Geschichten gab „Hermann“ zum Besten und ich entsinne mich, dass ich am Anfang unserer Bekanntschaft am Wahrheitsgehalt seiner Erzählungen kaum gezweifelt habe.
Nach vielen Jahren sah ich „Hermann“ wieder. Nun aber in einer aktuellen Fernsehsendung und mit richtigem Namen. Er gab dort Kommentare zur Jagd in der Schorfheide ab, die sich ausschließlich auf die alten Genossen des Politbüros bezogen. Schwung und Elan waren ihm auch nach so langer Zeit noch anzusehen und anzumerken. Hermann ist längst pensionierter Förster, aber sein Försteranzug sitzt immer noch wie angegossen. Er hatte sich zwar optisch etwas verändert, was nach so vielen Jahren nicht ausbleibt, aber es war immer noch der alte „Hermann“.
Etwas ist mir in der Schorfheide aber besonders positiv in Erinnerung geblieben und das ist die enge Verbundenheit der Dorfbewohner mit der Jagd.
Auf Drückjagden, an denen ich teilnehmen durfte und das Glück hatte, Überläufer zu erlegen, war das gesamte Dorf am anschließenden Schüsseltreiben beteiligt. Von Protesten gegen die Jagd hatte hier noch niemand etwas gehört.
Aber dann ging auch diese schöne Zeit vorüber und ich trat die Rückfahrt, beladen mit schönen Erinnerungen und einer herrlichen Trophäe, an. Sie hat ebenfalls einen Ehrenplatz im Haus erhalten.
Im heimischen Revier
Welcher schreibende Jäger hat noch nicht die Geschichte von seinem ersten Bockabschuss zu Papier, neuerdings in den Computer gebracht? Ich will da keine Ausnahme machen, zumal es absolut nicht so ablief, wie ich es mir zu Beginn meiner Jagdzeit vorgestellt hatte.
Meinen recht mühsam erworbenen Jagdschein hatte ich nun schon vier Jahre. Die ersten beiden Jahre waren ausschließlich der Fallenjagd im gesamten Revier gewidmet und im dritten Jagdjahr durfte ich für meine Bemühungen, die im Übrigen mit der Fallenjagd sehr erfolgreich waren, eine überalterte Ricke erlegen. Aber nun, im vierten Jahr meiner „Jägerschaft“, sollte es ein Bock werden. Dabei möchte ich aber nicht übergehen, dass die Fallenjagd weiter von mir mit Eifer und Erfolg betrieben wurde.
Mein Freund Heinrich, der Jagdherr in unserem heimischen Revier, gab mir in einem entfernten Revierteil, in dem nachweislich seit vielen Jahren keiner mehr gejagt hatte, wo garantiert kein Schuss gefallen war, den Abschuss frei. Besonders schwierige Auflagen machte er mir nicht, mit der Ausnahme: Der Ansitz, der dafür vorgesehen war, eine geschlossene, seit Jahren total vernachlässigte Kanzel, musste wieder in Ordnung gebracht werden. Es sollte natürlich ein typischer Abschussbock sein. Die genaue Anweisung wie ein solcher auszusehen hat, machte er mir mit aller Deutlichkeit klar. Vielleicht wollte er mit seiner Belehrung mir auch nur eine kleine Sperre auferlegen, denn was dort an Böcken lebte, wenn überhaupt, war niemanden in unserem Revier bekannt.
Mit Begeisterung machte ich mich an die Arbeit und die klapperige Kanzel wurde nun für einige Wochenenden meine Baustelle. Alte Hornissennester wurden entfernt, die Leiter bekam neue Tritthölzer und die Tür wurde wieder gangbar gemacht, die Fensterscheiben geputzt und wo erforderlich, auch erneuert. Auch das Dach wurde nun wieder wasserdicht gemacht. All diese Arbeiten erledigte ich natürlich vor der Jagdsaison, die zu der Zeit noch am 16. Mai begann. Die Arbeiten an diesem Sitz auszuführen wurden nur dadurch erschwert, dass man mit dem Auto nicht heranfahren konnte und weitab stehen bleiben musste. Die erforderlichen Werkzeuge und Gerätschaften trug ich über eine weite Entfernung heran, dabei mussten auch verschiedene Stacheldrahtzäune auf den davor liegenden Weiden überwunden werden. Diese Abgeschiedenheit hatte aber den großen, einmaligen Vorteil, dass meine mir zugewiesene Revierecke von Besuchern und Spaziergängern verschont blieb.
Einige Tage vor dem von mir selbst gesetzten Termin war ich mit meinen Arbeiten fertig, sodass wieder Ruhe einkehren konnte. Ich wartete gespannt auf das, was kommen sollte. Im gesamten Revier waren die Einstände für die aufgehende Bockjagd verteilt und ich hatte ja nun auch einen Platz bekommen, diesen, mir durch meine Arbeit, sozusagen „erworben“. Ob ich gerade den bekommen hatte, den kein anderer Jäger in unserem Revier haben wollte, war mir völlig egal, daran habe ich keinen Gedanken verschwendet.
Vielleicht, das waren so meine späteren Überlegungen, wollte wegen der schwierigen Anfahrt und der Krabbeleien unter den Stacheldrahtzäunen auch keiner meiner Mitjäger seinen Standort gerade dort aufschlagen.
Für mich zählte nur eines und zwar ein hoffentlich erfolgreicher Abschuss auf meinen ersten Bock. Bis dahin war der Abschuss von einem Bock für mich etwas Rätselhaftes, etwas, über das alle redeten und somit die Krone der Jagd im Frühjahr darstellen sollte. Anderes Wild, wie Sauen oder Rotwild, gab es bei uns nur als seltenes Wechselwild. Schon im Jägerlehrgang hörte ich meine Mitschüler von diesem Abschuss träumen. Natürlich wollte ich an solch einem, für mich noch nicht klar erkennbarem Ereignis teilhaben, darauf liefen alle meine Bemühungen hinaus.
Endlich war der Tag gekommen, den ich mir für die Jagd vorgenommen hatte. Aber nicht sofort am 16. ging ich auf Ansitz, sondern zügelte meine Jagdpassion noch zwei Tage und saß dann an einem sonnigen Spätnachmittag auf meinem renovierten Sitz. Ein Fernglas brauchte ich nicht, hatte es aber dabei, die Rinderweide, an der ich meinen Sitz hatte, war nur etwa 60 Meter lang und endete vor dem Zaun in einer Buschgruppe, die wiederum in einen Kiefernbestand überging, damit war die Sicht also ausgezeichnet und das Gelände völlig überschaubar. Rinder waren jahreszeitlich bedingt noch nicht auf der Weide, so dass von dieser Seite auch keine Störungen zu erwarten waren, wie vom Wind ebenfalls nicht. Dieser weht zwar die meiste Zeit, nicht nur bei uns, aus westlicher Richtung, genau in der ich saß, aber an diesem Tag ruhte er beinahe völlig. Bedingt durch meine gespannte Erwartung verging die Wartezeit sehr schnell und die Sonne neigte sich schon in meinem Rücken dem Horizont zu.
Da erschien erst am Rande der Buschgruppe, dann auf der Weide unter dem Zaun hindurch, aber immer am Rand bleibend, ein Reh. Nun doch das Glas genommen, erkannte ich: Es war ein Bock. Dass er nicht mehr jung war, konnte ich klar, selbst aus meinen, noch nicht vollständig entwickelten, noch theoretischen Kenntnissen, beurteilen. Sein Haupt war eisgrau und das Gehörn schon stark zurückgesetzt, aber dick und massig, soweit ich das aus der Distanz beobachten konnte. Ich muss aber noch anmerken, dass die Böcke in unserem Revier alle keine Medaille im Gehörn hängen haben.
Ich machte mich „fertig“. Das Herz schlug hoch und pochte an einer Stelle, wo es eigentlich nicht seinen Platz hat. Die Waffe, ich führte eine Bockbüchsflinte, lag im Anschlag und als der Bock breit stand, das Haupt zum hastigen Äsen gesenkt hatte, zog ich den Abzug und der Schuss im Kaliber 30-06 KS brach.
Mit dem Knall brach der Bock auf der Stelle zusammen und ich konnte ihn, im noch nicht hohen Gras der Weide, ohne dass er sich rührte, gut liegen sehen. Erst einmal durchatmen. Ich hatte meinen ersten Bock.