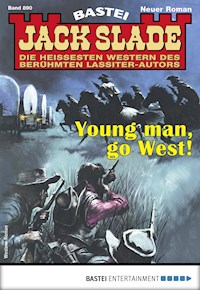
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jack Slade
- Sprache: Deutsch
Young man,go to West
1.400 Kilometer lang ist der Santa Fé Trail, und viele Gefahren lauern. Strapazen und auch der Tod. Naturgewalten, Banditen, Indianer. Der Treck mit den zahlreichen Wagen dauert vier Monate. Dem aufstrebenden jungen Händler Jim Murphy, der mannstollen schönen Maryan sowie Jims Neffen Paul und dessen Freund Sol sowie vielen anderen wird der Trail zum Schicksal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Young man, go West!
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelfoto: Maren/Norma
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-8880-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Young man, go West!
Über tausend Meilen lang ist der Santa-Fé-Trail, und viele Gefahren lauern auf seinem Weg, lebensbedrohliche Strapazen und auch der Tod. Dazu Naturgewalten, Banditen und Indianer. Der Treck mit den zahlreichen Wagen ist vier lange Monate unterwegs.
Dem aufstrebenden jungen Händler Jim Murphy, der so mannstollen wie schönen Maryan sowie Jims Neffen Paul und dessen Freund Sol und vielen anderen Mitreisenden wird der Trail nach Santa Fé zum Schicksal …
1836. Texas war gerade erst zur Republik ausgerufen worden. Das Alamo wurde angegriffen, die junge Republik kämpfte ums Überleben. In Independence am Missouri sammelte sich der Treck für den Santa-Fé-Trail. Zahlreiche Planwagen standen bei der kleinen Stadt, die Zugtiere grasten auf der Weide. Es herrschte ein reges Treiben.
Hickory Jim Murphy schlenderte durch das Camp zu seinem Frachtwagen. Der war klein, konnte gerade mal fünfhundert Kilogramm Last fassen. Neu war er auch nicht mehr, sondern gebraucht. Von sechs Mulis gezogen. Damit wollte Jim mit einem jungen Burschen als Begleiter nach Santa Fé. Auf dem Trail gedachte er, als selbstständiger Händler sein Glück zu machen.
Doch das neideten ihm andere. Brawler Gibson, zum Beispiel, der acht große Wagen und eine Mannschaft von Fuhrleuten und Maultier- und Ochsentreibern unter seinem Kommando hatte.
Der großmäulige Brawler sah sich als den King auf dem Santa-Fé-Trail an. Alle anderen hatten zu parieren und ihm Schutzgeld zu bezahlen. Dafür übernahm er die Führung und den Schutz des Trecks, der zu der Zeit bis zu achtzig Wagen umfasste.
Mit dem Brawler war nicht zu spaßen.
Jim dachte nicht daran, ihm Gebühr zu bezahlen. Der Westen war frei, der Brawler hatte den Santa-Fé-Trail nicht gekauft.
Jim schlenderte, eine Maiskolbenpfeife im Mund, dahin. Frauen machten ihm schöne Augen, er war ein stattlicher, gut aussehender Mann.
Groß und kräftig, mit Schlapphut und dunkelblondem Bart, in derber Leinenkleidung, Stiefel an den Füßen und eine schwere Pistole und ein langes Messer im Gürtel.
Er passierte gerade zwei Wagen, als ihm drei Kerle in den Weg traten. Sie gehörten zu Brawler Gibsons Leuten. Einer war Bannack Knife, ein Raufbold und Schurke, seinem Boss treu ergeben. Die anderen Curly Biggs und Rod Shaw.
»Du stinkst uns, Jim Murphy«, sagte Bannack Knife. »Du zahlst die Gebühr nicht. Entweder du blechst, aber die doppelte Summe, oder du kannst nicht mit Mr. Gibsons Treck fahren.«
»Warum denn das Doppelte?«
»Weil du ein Unruhestifter bist. Bastarde wie dich brauchen wir nicht auf dem Trail.«
»Dann fahre ich eben allein, auf eigene Faust. Will Becknell, der 1821 den Trail begründete, hat das auch getan.«
Ein Jahr später waren es schon vier Händler gewesen. Horrende Gewinne lockten. Seitdem fuhren immer mehr Händler auf dem Santa-Fé-Trail, einer 1.400 Kilometer langen, beschwerlichen und gefährlichen Strecke. Indianer lauerten, um Skalps zu erbeuten und Zugtiere zu stehlen.
Tornados brausten über die Great Plains. Wasserlöcher trockneten aus und brachten Menschen und Tiere durch die Qual des Durstes unter sengender Sonne zum Wahnsinn. Dann, endlich, lag da Santa Fé wie ein goldenes Tor in der spanischen Provinz Nuevo Mexico. Wenn sie es erreichten, tobten die Händler und ihre Fuhrleute und Helfer sich hemmungslos aus.
Geschäfte zu machen, vergaßen die Handelsleute dabei nicht.
»Das wirst du allein nicht schaffen«, sagte Bannack Knife. »Geld her!«
Er streckte die Hand aus. Jim fasste in sein Hemd, als ob er die Geldkatze hervorholen wollte. Er hörte ein Geräusch hinter sich und spitzte die Ohren. Da kam einer von hinten.
Der zweiunddreißigjährige Händler reagierte blitzschnell. Mit der freien Hand nahm er die Maiskolbenpfeife und warf sie Curly Biggs ins Gesicht. Ihn hielt er für den Gefährlichsten im Trio vor ihm.
Biggs riss automatisch die Hände hoch. Jim verwandelte sich in einem rasenden Tornado. Er trat Bannack Knife, der die Hand am Pistolengriff hatte, gegen das Knie, dass es krachte, stieß Shaw zwei Finger in die Augen und knallte Biggs den Ellbogen mit aller Wucht ans Kinn.
Im Nahkampf war Jim gut. Schon als sehr junger Mann war er bei einem Trapper in die Lehre gegangen und hatte gelernt, sich in wilden Grenzkämpfen zu behaupten. Biggs ging zu Boden.
Knife und Shaw kurz danach. Faustschläge und ein Handkantenschlag streckten sie nieder. Knife hatte seine Pistole verloren. Sie war ihm aus dem Gürtel gerutscht.
Sein Instinkt warnte Jim, er sah einen Schatten, hörte ein Geräusch und wich aus. Gerade noch rechtzeitig.
Ein riesiger Schwarzer mit einer Holzfälleraxt stand hinter ihm. Immerhin war er freundlich genug gewesen, mit der stumpfen Seite der Axt zu schlagen. Ob auf Jims Kopf oder die Schulter, wusste der Händler nicht.
Auf jeden Fall wäre es ihm schlecht bekommen. Big Solomon – so hieß der Schwarze, einer von Brawler Gibsons Leuten – führte weitere Schläge. Diesmal mit der Schneide der Axt. Er nahm keine Rücksicht mehr.
Er führte die schwere Axt wie ein Spielzeug. Jim hatte Mühe, auszuweichen. Keiner konnte ihm helfen. Sie hatten ihn eingekeilt und gestellt.
Solomons Axt krachte in die seitliche Stellwand eines großen Frachtschoners. Der Hüne schlug glatt die Bretter durch.
Zuerst mal steckte die Axt fest. Jim nutzte die Gelegenheit und sprang auf den Riesen zu. Er hämmerte auf ihn ein, traf steinharte Muskeln und grobe Knochen. Der Kerl hatte Kraft wie ein Ochse und war ebenso stark gebaut.
Er grinste nur, rollte mit den Augen, obwohl ihm von der gespaltenen Unterlippe das Blut tropfte. Jim konnte weder seine Augen treffen noch den Kehlkopf.
Big Solomon rammte den Kopf vor. Jim nahm dem Kopfstoß durch Zurückgehen und Ausweichen einen Teil seiner Wucht. Doch es traf ihn immer noch wie ein Huftritt. Er wankte und sah eine ganze Armada von Sternen.
Sie kreisten, und er hörte ein Knacken im Ohr und ein Summen. Ihm brummte der Schädel. Big Solomon zog mit einiger Mühe die Axt aus der Stellwand. Er schüttelte missbilligend den Kopf, als Jim, dessen Blick sich klärte, sich wieder aufraffte und Kampfstellung einnahm.
»Du nix mehr kämpfen, oder ich schlagen dich tot. Gib auf, Big Solomon will nicht töten.«
»Warum tust du es dann?«
»Weil Mr. Gibson mir geben Befehl. Solomon ist entlaufen von Plantage mit grausame Master. Mr. Gibson jetzt mein Massa, mein Master. Big Solomon sein ein freier Mann und kein Sklave.«
»Warum gehorchst du dann solch grausamen Befehlen? Das sind Verbrechen, die Brawler Gibson begeht und befiehlt. Hör auf damit.«
»Wohin ich dann geh? Was Massa Gibson sag, ist gut, ist Gesetz. Solomon gehorchen, nix fragen. Du dich ergeb, Jim? Dann kommen gut davon. Du Männer von Massa Gibson verletzt.«
Shaw und Knife regten sich wieder. Biggs taumelte hoch, sein Kiefer sah merkwürdig aus. Knife krabbelte am Boden herum und tastete nach seiner Pistole. Er fand sie nicht und murmelte Flüche. Shaw konnte kaum sehen, Tränen strömten ihm über das bärtige Gesicht.
»Du zahl, du dich ergeb«, sagte Big Solomon, die Axt in der Hand. »Dann werd ausgepeitscht als Straf. Dann alles gut. Du kann fahren mit unser Treck. Allein sein nix gut.«
»Du redest ja richtig väterlich zu mir, du schwarzer Halsabschneider. Das sollte man dir gar nicht zutrauen.«
»Big Solomon sein lieber gut statt roh. Doch die Verhältnisse, die sein nicht so.«
Jim hatte Auspeitschungen erlebt. Sie waren grausamster Art.
»Wer soll mich auspeitschen? Du? Mit der Louisiana-Sumpfschlange, nehme ich an.«
»Ja, Solomon peitsch. Zwanzig Schläge will Mr. Gibson als Sühne, Solomon denk. Aber kein Sorg, Jim Murphy. Solomon schlag so zu, dass du nach ersten Schlag schon bewusstlos. Dann nix mehr spür.«
»Bis ich aufwache«, spottete Jim ihm nach. »Dann ist mein Rücken kaputt, die Haut hängt in Fetzen. Vielleicht bin ich lebenslänglich ein Krüppel.«
Augenrollend sagte der Schwarze, eine treuherzige Seele: »Nein, nein. Ich nix mach dich kaputt. Ist nur Strafe. Schmerz vergeht. Narben bleiben, Narben sind gut für Mann. Du dich ergeb und zahl?«
»Nein, hol dich der Teufel! Leg die verdammte Peitsche weg, oder es knall … äh, knallt.«
Jim zog seine Pistole, einen einschüssigen Vorderlader, Kaliber 48. Das reichte auch für Big Solomon aus.
»Wirf die Axt weg! Zur Seite, sofort.«
»Ich Axt weg, wenn du lass Pistol fallen.«
»Okay.«
Sie schauten sich an.
»Jetzt!«
Die Axt flog zur Seite und landete im Gras. Jim ließ die Pistole fallen. Kaum war sie im Gras gelandet, schon hob er sie wieder auf und spannte den Hahn.
»Ergib dich!«
»Oh, oh, oh, das nix gut. Du gesagt, lass Pistole fallen. Mann hält sein Wort.«
»Willst du mit mir diskutieren? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Pistole liegen lasse. Heb die Hände hoch! Dreh dich um, knie dich hin! Oder ich knalle dir ein Loch in deinen schwarzen Pelz.«
Solomon schritt mit geballten Fäusten langsam auf Jim zu. Er war stark genug, ihm mit bloßen Händen das Genick zu brechen.
»Du nix schieß auf waffenlos Mann. Arm Solomon hat kein Pistol und kein Derring-Bumm.«
Der Schwarze war lustig. Jim brachte es nicht fertig, ihn über den Haufen zu schießen, obwohl er dazu das Recht gehabt hätte. Er warf ihm die Pistole ins Gesicht. Solomon riss im Reflex die Arme hoch. Der Schuss löste sich donnernd. Die Kugel fuhr harmlos ins Leere.
Den Moment, als Solomon abgelenkt war, nutzte Jim, um ihm voll zwischen die Beine zu treten. Solomon grunzte wie ein Kamel bei der Wasseraufnahme und hielt sich die großen Hände gegen sein männlichstes Teil.
»Du Schwein. Das gemein. Oh, oh, oh. Arm Solomon Hoden kaputt.«
Das würde sich noch herausstellen. Jim glaubte es nicht. Er schnappte sich die abgeschossene Pistole und donnerte sie Solomon, der gebeugt dastand und vor Schmerz aktionsunfähig war, mehrfach fest an den Kopf.
Der Schwarze hatte einen so harten Schädel, dass der Pistolengriff abbrach. Jim versetzte ihm noch eins mit dem schweren Lauf, und Big Solomon legte sich flach.
Der Schuss musste den Treck alarmiert waren. Es würden welche kommen und nachsehen. Doch bis sie da waren, hatte Jim es noch mit seinen Gegnern zu tun. Big Solomon war betäubt. Knife humpelte stark. Biggs stand an einen Baum gelehnt und übergab sich.
Shaw stand breitbeinig da. Er hielt einen Derringer in der Hand und zielte auf Jim. Der sah in die Mündung wie in den Rachen des Todes. Es war eine große Mündung – 55er Kaliber. Auf die kurze Entfernung konnte Shaw nicht vorbeischießen.
Die schwere Kugel würde Jim den Brustkorb zerfetzen. Bannack Knife hielt ein gebogenes, rasiermesserscharfes Messer in der Faust. Die Suche nach seiner entfallenen Pistole hatte er aufgegeben. Er humpelte näher.
»Jetzt bist du fällig, du Hund!«
Jim hielt nur einen abgefeuerten Pistolenlauf in der Faust. Sein Messer hatte er verloren. Über weitere Waffen verfügte er nicht. Shaw krümmte den Finger am Abzug.
☆
Das Waisenhaus der »Gnadenvollen Schwestern« an der New Yorker Eastside war düster und kalt. Aus Backstein gemauert, mit Heiligenfiguren am Dach. Da waren Apostel und Märtyrer zu sehen, gesprenkelt von Taubendreck, was ein weiteres Martyrium für die Dargestellten war.
In dem Waisenhaus waren hundertachtzig Kinder untergebracht, Waisen und Mündel der Stadt New York. Bei letzteren lebten die Mutter oder der Vater vielleicht noch, doch sie konnten oder wollten sich nicht um ihre Kinder kümmern. Im Haus gab es lange geflieste Gänge, vergitterte Fenster an den Schlafsälen, in denen jeweils dreißig Kinder schliefen.
Jungen und Mädchen waren getrennt. Das Alter der Schutzbefohlenen lag zwischen fünf und fünfzehn Jahren. Mit fünfzehn mussten die Jugendlichen, die sie dann waren, abrücken. Man brachte sie irgendwo unter. Von der Zeit in dem Waisenhaus blieb ihnen die Erinnerung an muffige, kalte Räumen, dünne Kohlsuppen, frühes Aufstehen, erzwungene Gebete und harte Strafen wie Stockschläge und den Karzer im Keller.
Die Kinder wurden im Haus oder in der Armenschule nebenan unterrichtet. Dafür, dass sie nicht genug Bildung bekamen – vor allem nicht die falsche – sorgten die Schwestern schon.
Die Kinder hatten zu arbeiten, auch die Kleinen schon. Flitter- und Perlennäherei war angesagt. Es gehörte zur Mode, dass Hüte und Kleidungsstücke damit besetzt und verziert waren. An sich war die Feinstickerei keine schwere Arbeit. Doch wenn es im Akkord und bei schlechtem Licht und in kalten Räumen geschah schon.
Die Mädels mussten Hauswirtschaft lernen. Die Jungs gröbere Arbeiten. Dazu gehörten für die Größeren auch Latrinenreinigen und Straßenkehren sowie Abfälle sammeln und zur Müllkippe bringen.
Größere Kinder wurden an Haushalte oder Betriebe ausgeliehen. Oft gab es dort schlechte Behandlung und sexuelle Übergriffe. Wenn sich die Waisenhausinsassen beklagten, glaubte man ihnen nicht. Als kurz nacheinander zwei Dreizehnjährige in einem Metzgereibetrieb schwanger wurden, schickten die Nonnen keine Kinder mehr dorthin.
Mehr geschah nicht. Die jungen Mütter wurden in ein besonderes Heim gebracht. Die Kinder nahm man ihnen weg und gab sie zur Adoption frei.
Geld erhielten die Waisenhauszöglinge für ihre Arbeit keines. Wenn man den Schwestern glaubte, ging alles für Kost und Logis sowie Kleidung drauf … »Unglaublich, was diese Kinder zerreißen … und wie schnell sie wachsen!« … man legte noch drauf.
Es war dafür gesorgt, dass es den Waisen nicht zu gut ging.
Die Gnadenvollen Schwestern brüsteten sich auch, ein gutes und christliches Werk an den ihnen anvertrauten Kindern zu tun.
Spielen durften sie selten. Müßiggang galt als Laster. Dem Herrgott die Zeit stehlen. Wenn es mal einen Ausflug in den Central oder Battery Park gab, marschierten alle in einer Gruppe, in Zweierreihen, und trugen die einheitliche Kleidung, damit jeder sah, dass sie aus dem Waisenhaus kamen.
Lachen war selten in diesem Haus. Rosenkranzgebete gab es öfter.
Die Behandlung war schlecht. Tuberkulose grassierte. Die Sterblichkeit war relativ hoch. Dafür wurden die Kinder in der Bibel unterwiesen und bekamen Traktätchen eingetrichtert, in denen von heiligen und geduldigen Kindern und Märtyrern die Rede war.
Diese hatten sich immer gefreut, wenn sie sterben durften, möglichst auf grausame Art, um Zeugnis für ihren Glauben abzulegen. Je grausamer sie starben, umso löblicher war es.
»Glaubst du diesen Scheiß?«, fragte der zwölfjährige Paul Murphy seinen gleichaltrigen Freund Sol Perlman. Sie saßen unter dem Walnussbaum in der Ecke des Hofs auf einer niederen Mauer. »Wenn es das Höchste sein soll, dass man gebraten, gesotten, gevierteilt oder sonst wie gemartert umkommt, frage ich mich, wozu das denn gut ist?«
»Damit du in den Himmel kommst, Paul.«
»Was soll ich denn da? Wenn er von solchen wie den Gnadenvollen Schwestern bevölkert wird, muss es ein abscheulicher Ort sein.«
»Das sage ich Schwester Clarissa«, sagte ein bezopftes kleines Mädchen, das zugehört hatte.
»Mach das nicht. Bitte nicht.«
Paul wusste, was ihm dann blühte. Mindestens zwanzig Stockhiebe und Karzer im Keller, bei Wasser und Brot.
»Sei keine Petze.«
Die Kleine linste ihn an.
»Gut, ich kann schweigen. Aber nur, wenn du mir am Sonntag deinen Nachtisch gibst. Und deine Murmeln.«
»Meine Murmeln gebe ich nicht her.«
»Dann wirst du gehauen.«
»Vielleicht sollten wir ihr eine Abreibung verpassen«, schlug Sol Perlman vor.
»Dann wird es noch schlimmer.« Paul seufzte. »Ich gebe dir fünf von meinen Murmeln.«
Sie feilschten. Paul konnte die Kleine, sie war erst sieben Jahre alt, ein freches Gör mit brandroten Haaren und Sommersprossen, nicht herunterhandeln.
Seufzend wollte er schon seinen Murmelschatz herausrücken; er hatte nicht viel Eigenes ergattert in den anderthalb Jahren, die er nun hier war.
Da sagte die Kleine: »Ich begnüge mich mit fünf Murmeln. Wenn du mir einen Kuss gibst.«
»Was?«
Paul glaubte nicht recht zu hören. Doch die Rothaarige spitzte den Mund und schaute ihn mit ihren großen grünen Augen verlangend an. Paul schaute ratlos zu seinem Freund Sol.
Der zuckte die Achseln.
»Kommt drauf an, was dir die Murmeln wert sind«, sagte er.
Ein Kuss war schnell erledigt. Die Murmeln, welche aus Ton und aus Glas waren und zwei Metallklicker, würden für immer fort sein.
»Also gut.«
Paul gab dem Girl einen flüchtigen Kuss. Dann wollte er fünf Murmeln aus dem Säckchen nehmen, das neben ihm lag.
»Halt, so geht das nicht. Gib mir einen richtigen Kuss, oder ich will alle Murmeln.«
»Du bist ja verrückt. Du bist sieben Jahre alt. Woher willst du denn wissen, wie richtig geküsst wird?«
»Ich bin in einem Hurenhaus aufgewachsen, bis ich sechs Jahre alt war«, sagte die Kleine nüchtern. »Dort ging es lustig zu. Ich wollte dort bleiben. Doch die blöden städtischen Beamten nahmen mich meiner Mutter weg, die ich seitdem nicht wiedergesehen habe. Und brachten mich hierher in das scheußliche Waisenhaus.«
Sie sann eine Zeit lang nach und fuhr dann fort: »Die Nonnen nennen mich ein Kind der Sünde und eine Sünderin und mögen mich nicht. Die Murmeln, oder ein Kuss. Ich zeige dir, wie es gemacht wird.«
Paul gab sich geschlagen. Er forderte seinen Freund Sol auf, sich umzudrehen und wegzuschauen. Dann vergewisserte er sich, dass sie nicht beobachtet wurden, und beugte sich zu der Kleinen vor in ihrem schmucklosen grauen Anstaltskleid mit einer gestärkten, kratzigen weißen Borte am Kragen.
Sie gab ihm einen richtig aufwendigen Zungenkuss. Paul ekelte sich. In seinem Alter hielt er nicht viel von Mädchen, und dann noch ein solcher Kuss. Die rothaarige Göre klammerte sich an ihm fest.
Sol hatte doch heimlich hingesehen. Er kicherte.
»Wehe, wenn du mich verrätst«, warnte ihn Paul. »Dann bist du nicht mehr mein Freund und kriegst Dresche.«
Sol wollte sich ausschütten vor Lachen.
»Du hättest dich sehen sollen. Dein Gesicht. Wie kann man nur so etwas Ekliges machen? Jemand anders die Zunge in den Mund stecken. Igitt.«
»Die Erwachsenen machen das gern«, sagte die kleine Göre altklug. »Und noch ganz andere Sachen. Ich könnte euch Dinge erzählen …«
»Erzähl mal.«
Die Kleine – deren Namen die beiden Jungs noch immer nicht wussten, da Jungs und Mädels meistens getrennt gehalten wurden – schilderte einiges aus dem Hurenhaus. Sie war immer neugierig gewesen und hatte in kindlicher Unschuld spioniert. Kein Mann hatte sie angefasst. Später wäre es dazu gekommen.
»Nein!«, riefen Paul und Sol hin und wieder. Und: »Tatsächlich? Das machen die Erwachsenen wirklich? Wie kann man denn nur.«
Paul sagte altklug: »Wenn ich mal erwachsen bin, tue ich solche Dinge nicht mit einer Frau. Das ist ja voll ekelig.«
»Es macht ihnen Spaß«, behauptete die Kleine. »Wirst schon sehen. Wenn du mal erwachsen bist, wird es dir auch Freude bereiten. Das haben mir die Mädels in dem Haus dort gesagt. Obwohl es, gewerblich betrieben, ein harter Job ist. In den Stoßzeiten, wenn mehrere Schiffe anlegten und die Matrosen an Land kamen, ging es heftig zu. Dann gaben sich die Sailors bei den Girls die Klinke in die Hand. Weißt du was, Paul, die Murmeln kannst du behalten. Du hast mich geküsst – und du gefällst mir.«
»Bleib mir ja vom Hals!«, rief der Junge. »Fünf Murmeln sind abgemacht. Da hast du sie. – Und jetzt mach dich vom Acker. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich mache mich lächerlich, wenn ich mit dir herumhänge. Was sollte ich denn mit dir anfangen, du … du Mädchen. Ich weiß ja nicht einmal deinen Namen.«
»Ich bin die Lucy. Lucy O’Brien. Meinen Vater kenne ich nicht, meine Mutter ist wahrscheinlich tot. Sie hat einen schlimmen Husten gehabt. Vielleicht hat sie auch ein Freier erwürgt.«
Lucy sagte das ganz ruhig. Sie hatte früh lernen müssen, mit der Realität zu leben.
Sie hatte noch nicht richtig zu Ende gesprochen, als drei Nonnen herbeifegten, allen voran Schwester Clarissa, eine sehr strenge. Die Nonnen trugen allesamt weiße Kleidung, Flügelhauben und weiße Kragen. Sie waren empört.
»Was habe ich da beobachtet?«, keifte die Nonne Clarissa. »Ihr verkommenes Pack, Brutstätten der Sünde. Gott möge euch strafen. Ab in den Karzer mit euch.«





























