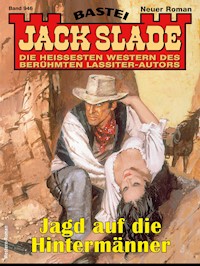
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jack Slade
- Sprache: Deutsch
Das Grenzgebiet zwischen Texas und Mexiko ist ein wildes, in großen Teilen wüstenartiges Land. Ein alternder Cowboy findet sich in der Wüste des mexikanischen Bundestaates Coahuila wieder, auf der Suche nach Frauen, die Banditen in Texas geraubt haben. Wer ist der Drahtzieher hinter diesen Überfällen und Entführungen?
Die Spur führt zur Sierra Madre und in eine kleine Stadt, die ihre koloniale Glanzzeit hinter sich hat, nicht jedoch die Schattenseiten ihrer Vergangenheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Jagd auf die Hinter männer
Vorschau
Impressum
Jagd auf die Hintermänner
Das Grenzgebiet zwischen Texas und Mexiko ist ein wildes, in großen Teilen wüstenartiges Land. Joe Stakeman, ein in Ehren ergrauter Satteltramp, findet sich in der Wüste des mexikanischen Bundestaates Coahuila wieder, auf der Suche nach Frauen, die Banditen in Texas geraubt haben.
Wer ist der Drahtzieher hinter diesen Überfällen und Entführungen? Die Spur führt Stakeman zur Sierra Madre und in eine kleine Stadt, die ihre koloniale Glanzzeit hinter sich hat, nicht jedoch die Schattenseiten ihrer Vergangenheit ...
Joe Stakeman hatte den Rio Grande bei einem gottverlassenen Ort namens San Elisario überquert und war zwei Tage in südlicher Richtung unterwegs gewesen.
Es war ein heißes und staubiges Land, eine Wüste aus Felsen, Sand und verdorrten Dornbüschen. Hier gab es nichts außer Kojoten, Klapperschlangen, und vielleicht trieben sich ein paar Apachen hier herum.
Stakeman war ein fünfzigjähriger, breitschultriger Mann mit einem schmalen Gesicht, mit hellen Augen und einem grauen Schnauzbart. Gegen Mittag des zweiten Tages hatte ein dunkler Streifen am Horizont die Höhenzüge der Sierra Madre angekündigt. Es hätte beinahe eine Fata Morgana sein können.
Captain Jefferson, der Chef der Texas Ranger auf der anderen Seite des Rio Grande, hoffte, dass Stakeman das Versteck der Desperados irgendwo dort oben aufspüren konnte. Irgendwohin musste die Bande ja verschwinden, irgendwo musste sie die Frauen verstecken, bevor sie sie in den Süden des Landes verkauften.
Die Sonne brannte glühend und gnadenlos von einem strahlend blauen Himmel. Kein Windhauch regte sich, und vor dem einsamen Reiter flimmerte die Landschaft in der Sonne.
Noch lag ein weiter Weg vor ihm. Er zog sein Taschentuch hervor und wischte sich über das Gesicht, über Nacken und Schädel. Dann öffnete er seine Wasserflasche und trank einen kleinen Schluck. Doch die Flasche war fast leer. Er hatte dem durstigen Pferd heute früh zu viel von der kostbaren Flüssigkeit überlassen.
Wieder einmal fragte er sich, ob das letzte, sehr friedliche Jahr auf der Ranch seines Bruders ihn nicht vielleicht doch zu sehr verwöhnt hatte. Ob er nicht vielleicht doch zu weich, zu wenig rücksichtslos und misstrauisch geworden war. Einfach zu alt. Er fragte sich, ob er diesen letzten Job tatsächlich noch hätte übernehmen sollen.
Er trieb das Pferd an, ritt immer weiter in Richtung Süden. Schaum stand vor dem Maul des Tieres, und das Fell war nass vom Schweiß. Es benötigte dringend ein paar Stunden der Ruhe, bis wenigstens die schlimmste Hitze vorüber war.
Der Texaner sah eine Gruppe von Felsen, die sich vor ihm aus der Wüste erhoben. Nein, das war keine Einbildung, kein Geisterbild der Hitze und der Sonnenstrahlen. Wasser gab es dort ganz sicher keines, aber immerhin Schatten.
Dort würde er einige Zeit rasten und gegen Abend die Ausläufer der Sierra Madre erreichen.
✰
Die drei Männer hatten den Reiter von Weitem kommen gesehen. Es waren ein Gringo und zwei Mexikaner: der Weiße war ein bulliger, vierschrötiger Typ mit einer dunklen Haut, einem dunklen Bart und rohen Gesichtszügen.
Die Mexikaner waren von kleiner, fast schmächtiger Gestalt, bekleidet mit Hose und Jacke aus schmutzigem, weißem Leinen, das um ihre mageren Glieder schlotterte. Besonders vertrauenerweckend sah keiner der drei aus: Der Gringo war ein typischer Satteltramp, und seine mexikanischen Kumpane waren ohne Zweifel Strauchdiebe. Es waren Leute mit ausgemergelten und gierigen Gesichtern, wie sie sich hier im Grenzgebiet zu Dutzenden herumtrieben.
Alle waren mit Colts und anscheinend nagelneuen Winchester-Gewehren bewaffnet, und ganz offensichtlich hatten sie im Schatten des Felsens Schutz vor der gnadenlosen Hitze gesucht.
Sie spähten in Richtung des Reiters, der sich ihnen wie eine Fata Morgana aus der flirrenden Mittagshitze näherte. Die kleine Gestalt würde sicher noch eine halbe Stunde brauchen, bis sie den Felsen erreicht hatte.
Was wollte er? Da er von der amerikanischen Grenze kam, war er vermutlich ein Gringo. Vielleicht war er ein Schatzsucher, vielleicht auch ein Mann, der vor dem Gesetz auf der Flucht war. Auf alle Fälle war er eine leichte Beute.
»Den sehen wir uns mal näher an«, sagte der Gringo. Er war ganz offenbar der Boss der kleinen Bande. Er schob seinen speckigen Hut in den Nacken zurück, wischte sich den Schweiß von der Stirn und erhob sich. »Schaff die Pferde hinter den Felsen, damit er sie nicht sieht«, wandte er sich an einen der Mexikaner, an einen kleinen Mann mit einem typischen Fuchsgesicht. »José und ich klettern schon mal auf den Felsen.«
»Okay, Señor Tom«, antwortete der Mexikaner. Auch er erhob sich, fasste die Tiere – zwei Braune und einen Schecken – an ihren Zügeln und verschwand damit hinter dem Felsen.
Tom McGuire, der Amerikaner, und José verwischten die Spuren, die sie im heißen Sand hinterlassen hatten, und kletterten geschickt wie Berglöwen den Felsen hinauf.
Es war ein massiger Brocken, mindestens dreimal mannshoch und ähnlich lang und breit. In dem vom heißen Wind zerklüfteten Gestein fanden sie immer wieder Felssprünge und Spalten, die ihnen gute Griff- und Trittmöglichkeiten boten.
✰
Es war ein Fehler gewesen, mit dem Wasser nicht sparsamer umzugehen. Joe Stakeman konnte nur hoffen, spätestens gegen Abend auf einen Tümpel zu stoßen, an dem er und das Pferd ihren Durst löschen konnten.
Die Mittagssonne brannte unbarmherzig. Langsam näherte er sich dem Felsen, in dessen Schatten er die nächsten Stunden verbringen wollte. Sobald die schlimmste Hitze nachgelassen hatte, wollte er wieder aufbrechen.
Der Felsen war ein massiger Klotz. An manchen Stellen wuchs dürres, zerzaustes Gestrüpp in einer Felsrinne.
Stakeman hatte den Felsen nun erreicht. Wasser gab es hier jedenfalls keines. Langsam trabte er an dem Block vorbei. Etwas kam ihm komisch vor. Sein Instinkt sagte ihm, dass Gefahr drohte.
In dieser Sekunde krachte der Schuss. Der Revolvermann kauerte hinter einem niedrigen Brocken an der Seite. Stakeman spürte, wie das Pferd unter ihm wegbrach. Warmes Blut schoss in einer dicken Fontäne aus dem Hals des Tieres hervor und über Stakemans Gesicht, Hals und Brust. Dann kippte es schwer zur Seite und begrub den Reiter unter sich.
Stakeman versuchte, sich unter dem im Todeskampf zuckenden Tier hervorzuarbeiten. Er hatte sich überrumpeln lassen. Was war mit ihm los? Schon traf ihn der harte Tritt eines Stiefels mitten ins Gesicht.
Er hörte ein gackerndes, triumphierendes Lachen. Mühsam kam er unter dem sterbenden Pferd hervor. Es waren Mexikaner. Er blickte in hasserfüllte und von Wut und Mordlust verzerrte Gesichter. Fäuste trafen sein Gesicht und harte Stiefel seinen Bauch und seine Leisten. Er versuchte, den Colt zu ziehen, doch ein schneller Tritt stieß ihm die Hand weg.
Dann wurde er auf den Bauch gedreht. Für Bruchteile von Sekunden wurde ihm schwarz vor Augen und würgte ein Brechreiz in seinem Magen. Ein Bandit zog ihm die Hände auf den Rücken, während ein zweiter sie mit einem Lederriemen fesselte.
»Hehe, Mister Tom, wir haben ihn!«, hörte er eine heisere Stimme rufen.
»Hehe, Drecksack!«
»Dreht ihn auf den Rücken!«, kommandierte ein dritter Mann.
Grobe Hände drehten Stakeman um, und er blickte in den Lauf eines Colts, der zu einem schmächtigen Mexikaner gehörte, einem vielleicht dreißigjährigen Mann mit hageren Wangen und einem hungrigen Fuchsgesicht. Der Bandit grinste hämisch und voller Schadenfreude. Hinter ihm stand ein Amerikaner, ein bulliger Mann mit einem von der Sonne gebräunten vierschrötigen Gesicht und halblangen dunklen Haaren unter einem vom Schweiß speckigen Hut.
»Was suchst du hier?«, fragte der Gringo. Es war dieselbe Stimme, die gerade kommandiert hatte.
»Ich bin auf der Durchreise.«
Der Bullige nickte, und ein zweiter Mexikaner – auch er ein schmächtiger Mann in einer weißen Leinenjacke und mit einem gewaltigen Sombrero auf dem sonnengebräunten Schädel – verpasste Stakeman einen harten Tritt in die Rippen. Der schnappte nach Luft.
»Wohin willst du denn?«, fragte der Weiße.
»Monterey.«
»Ach. Und was hast du dort zu suchen?«
»Ich will Pferde kaufen.«
Ein weiteres kurzes Nicken und ein weiterer Tritt.
»Erzähl keinen Scheiß«, knurrte der Gringo.
»Verdammt, ich habe dort gute Kontakte!«, hechelte Stakeman.
»Was du nicht sagst. Durchsucht ihn!« Der Bullige musterte Stakeman aus kalten Augen wie ein überflüssiges Insekt.
Einer der Mexikaner kauerte sich neben Stakeman und durchsuchte dessen Taschen. Er warf eine Geldbörse, einen Tabaksbeutel, eine dünne Brieftasche, Streichhölzer, ein Taschenmesser und anderes neben den Gefangenen in den heißen Sand.
Der bullige Bandit bückte sich, hob die Brieftasche auf und sah rasch ihren Inhalt durch. Einen dünnen Stapel Dollarscheine ließ er in seiner eigenen Jackentasche verschwinden. Dann entdeckte er die Fotografie einer Frau. Die Lady hatte lockiges, blondes Haar und ein hübsches Gesicht mit einem großen Kussmund. Obwohl ihr Haar straff gekämmt war und sie eine hochgeschlossene Bluse trug, sah sie attraktiv und erotisch aus.
»Wer ist das?«, fragte der Gringo und zeigte Stakeman die Fotografie. »Deine Frau?«
Der nickte. Blut quoll zwischen seinen aufgeplatzten Lippen hervor.
»Wärst du Idiot doch bei ihr geblieben? Wo ist sie?«
»Sie ist tot.«
»Im Ernst?«
Stakeman sparte sich eine Antwort.
»Mein Beileid, Arschloch!«
»Lasst mich jetzt gehen«, verlangte Stakeman.
Der Bullige grinste.
»Was wollt ihr von mir?«
»Ich fürchte, du bist einfach ein dummer, alter Mann, Hombre!«
Der Mexikaner durchsuchte Stakemans Satteltaschen. Er entdeckte einen Colt und mehrere große Schachteln Ersatzmunition, außerdem ein Fernglas, eine Flasche Whisky, getrocknetes Fleisch und Bohnen sowie eine Medizin gegen Wundbrand.
»Was willst du mit diesem Zeug beim Pferdekauf anfangen?«, fragte der Bullige. Stakeman kannte sein Gesicht von einem Steckbrief. Sein Name war Tom McGuire.
»Ich überlasse euch die Sachen, wenn ihr mich frei lasst.« Der Texaner versuchte, den Oberkörper aufzurichten, doch McGuire verpasste ihm blitzschnell einen Fußtritt unters Kinn. Der Gefangene kippte wieder nach hinten.
»Dein Dreck gehört uns doch schon, Schwachkopf.«
»Ich habe Durst! Gebt mir etwas zu trinken!«
»Was kann ich für deinen Durst? Hättest eben selbst trinken sollen, Arschloch.« Tom McGuire scharrte mit der Stiefelspitze in den Habseligkeiten aus der Satteltasche.
Dann drehte er sich auf dem Stiefelabsatz um und trat dem Mann am Boden ohne jede Vorwarnung und mit aller Kraft gegen die Schläfe.
Für Sekunden hatte Stakeman das Gefühl, als explodiere sein Schädel. In seinen Ohren dröhnte es wie von den Kanonenschüssen. Er bemerkte noch, wie sich alles um ihn drehte, dann wurde es schwarz vor seinen verquollenen Augen. Er hatte den Eindruck, in einen tiefen und unendlich dunklen Schacht zu stürzen und immer tiefer und tiefer abwärts zu trudeln.
✰
Es waren gewaltige Vögel, Wesen mit breiten Schwingen. Sie sahen aus wie übergroße Flughunde. Ihre Haut war schwarz und ledern, und ihre Augen wirkten wie Kohlen. Sie öffneten die großen scharfen Schnäbel und streckten lange dunkle Zungen heraus. Ihr Atem war heiß und stank giftig, und sie zischten, knurrten und geiferten. Sie stammten aus einer längst vergangenen Vorzeit. Sie waren böse und mörderisch.
Joe Stakeman wollte die Arme heben, um die beiden Monster abzuwehren. Doch er konnte sich nicht bewegen. Seine Hände waren noch immer auf dem Rücken fixiert, und ein schweres Gewicht lastete auf ihm. Verzweiflung erfasste ihn. In seinem Schädel rumste und dröhnte es, und in der Kehle brannte ein gleißendes Feuer.
Vor allem war er gelähmt.
Die großen Flughunde schwirrten um seinen Kopf herum, stießen mit ihren bösen Schnäbeln zu.
»Madre Dios! Señor! Öffnen Sie die Augen!«, drang eine männliche Stimme an Joe Stakemans Ohr. Sie schien aus weiter Ferne zu kommen und hallte schaurig in seinen Ohren wider. Immerhin begriff er, dass der Mann zunächst mexikanisch gesprochen hatte und seinen letzten Satz nun in englischer Sprache wiederholte. »Señor, öffnen Sie bitte die Augen!«
Immerhin bekam der Texaner ein schwaches Blinzeln zustande.
»Wer hat das getan?«, hörte er eine andere Stimme fragen.
»El Diablo! Es waren die Teufel!«, antwortete der andere Mann.
Stakeman fühlte sich noch immer erstarrt. Er versuchte, die Hände auf seinem Rücken zu bewegen, allerdings ohne jeden Erfolg. Dafür hörte er nun ein hektisches, aufgeregtes Scharren. Endlich gelang es ihm, seine Augen ein wenig weiter zu öffnen, und er blickte in das Gesicht eines älteren Mexikaners.
»Mister! Señor! Gott sei Dank!«, rief der Mann voller Erleichterung und Freude. »Wachen Sie auf!«
Es war ein freundliches Gesicht. Es handelte sich um einen vielleicht fünfzigjährigen Mann mit freundlichen, dunklen Augen, einer von der Sonne gebräunten Haut und einer großen Nase.
»Wasser!«, stieß Stakeman hervor. Er brachte nicht mehr als ein leises und heiseres Röcheln zustande. »Geben Sie mir Wasser, bitte!«
»Juan, hol die Flasche!«, rief der Mexikaner.
Stakeman drehte den Kopf ein wenig zur Seite und blickte sich um. Er sah Sand. Er begriff, dass sie ihn eingegraben hatten und dass nur noch sein Kopf aus dem Sand herausschaute. Jetzt erinnerte er sich, was geschehen war. Wie ein dummer Junge war er in die Falle gelaufen.
Der junge Mexikaner, der den Namen Juan trug, hatte die Wasserflasche geholt. Der Alte entkorkte sie und setzte sie an Stakemans Lippen. Der trank gierig. Er war in der Tat halb verdurstet. Beinahe verrückt geworden vor Durst, hatte er schon Ungeheuer gesehen.
Er trank und trank und trank. Der Alte hob die Flasche ein wenig an, und das köstliche Wasser lief nicht nur in Stakemans Mund, sondern auch über Lippen und Kinn. Niemals zuvor in seinem Leben hatte Wasser ihm so gut geschmeckt.
»Mister, wir haben noch mehr Wasser dabei«, lachte der Alte. »Sie können trinken, so viel Sie wollen.«
»Danke.«
Der junge Mann beschäftigte sich unterdessen damit, Stakeman auszugraben, der bis zum Hals im Sand steckte. Die Mexikaner hatten keine Schaufeln dabei, und so musste Juan beide Hände benutzen. Dennoch flog der weiche Sand in hohem Bogen zur Seite.
Der Alte griff nach dem Hut, der an der Seite im Sand lag, und setzte ihn auf Stakemans Kopf. Nun endlich war er vor den gnadenlosen Strahlen der Sonne geschützt.
Er begriff, auf welche gnadenlose Art die Banditen ihn hatten umbringen wollen. Die drei waren brutale Sadisten, und ihr Anführer war ohne jeden Zweifel ein ganz besonders übler Killer und Menschenschinder. Banditen seiner Art kreuzigten Campesinos an ihren Scheunentoren, brachten ihre Kinder um und vergewaltigten ihre Frauen. Ihm musste das Handwerk gelegt werden.
Stakemans Hände waren noch immer auf dem Rücken gefesselt. Doch Juan durchschnitt nun endlich die Lederschnüre, und der Texaner konnte jetzt mit den eigenen Händen helfen, den Sand zur Seite zu werfen. Es dauerte nicht lange, bis er ganz befreit war.
Die beiden Mexikaner zogen ihn aus dem Sandloch und wollten ihn auf die Beine stellen, doch seine Knie gaben sofort nach: zu sehr war er geschwächt vom Durst und von der stundenlangen Sonnenglut. Wie ein schwaches Kind sackte er in sich zusammen. Vorsichtig schleppten die beiden Männer ihn zum Felsen und legten ihn dort im Schatten nieder.
Der Alte goss wieder Wasser über Stakemans Gesicht.
»Sie haben großes Glück gehabt, Mister. Bis zum Abend wären sie tot gewesen«, sagte er.
Stakeman nickte. »Ja. So ist es. Ich schulde Ihnen mein Leben!«
Doch schon wieder war ihm verdammt schlecht. Es muss von der Sonne kommen, rieselte es wie Nebel durch seinen Kopf. Er hatte das Gefühl, nach hinten zu fallen und in ein weiches und kühles Bett zu sinken. Es war ein schönes Gefühl. Kühler und erfrischender Stoff umhüllte ihn, und Feuchtigkeit benetzte sein trockenes Gesicht.
Er taumelte und fiel immer weiter nach hinten. Dann verlor er wieder das Bewusstsein und glitt in einen sanften und tiefen Schlaf.
✰
Die Frau war schön wie ein Engel. Sie war so schön und dunkel und schwarzhaarig, wie Frauen jenseits des Rio Grande nur sein können kann. Sie war vielleicht zwanzig Jahre alt und hatte ein madonnengleiches schmales Gesicht mit großen dunklen Augen und einem wunderbaren Kussmund. Ihr Haar war lang und lockig und dunkel und fiel ihr weit über Schultern, die von einer weißen, bunt bestickten Bluse umhüllt wurden. Ihre Brüste in der Bluse waren straff und üppig.
Joe Stakeman sah die junge Lady an. Im ersten Moment erschien sie ihm wie eine Offenbarung. Dann sah er, dass eine zweite Lady hinter ihr stand und sich ebenfalls über ihn beugte. Sie war der ersten wie aus dem Gesicht geschnitten, hatte dieselben eindrucksvollen Augen, dieselben hoch stehenden Wangenknochen, den gleichen üppigen Kussmund. Allerdings war sie sicher zwanzig Jahre älter. Sie mussten Mutter und Tochter sein.
»Er öffnet die Augen«, sagte die ältere Lady mit einer sanften, leisen Stimme.
»Señor!«, flüsterte die Jüngere.
Nun beugte sich auch der alte Mexikaner, der Stakeman draußen in der Wüste gefunden hatte, über ihn. »Señor! Wie gut, dass Sie wieder bei uns sind!«, rief er erfreut.
Der Texaner nickte.





























