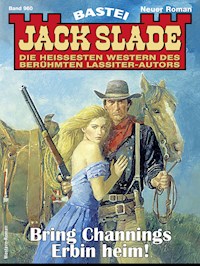
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jack Slade
- Sprache: Deutsch
Bud Wilcox hat genug von Revolvern und blauen Bohnen in der Luft. Die Schrecken des Bürgerkrieges haben ihn von seinem vorangegangenen Leben als Revolverheld kuriert, und er hat als Arbeiter auf der Ranch von John Sterlowe seinen Frieden gefunden. Bis ihn der Chef mit einer besonderen Aufgabe betraut: Die sechzehnjährige Judy hat die einige Tagesritte entfernte Ranch ihres Großvaters geerbt. Bud soll sie dorthin begleiten. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinen alten Remington-Revolver wieder umzuschnallen. Und nicht zu früh ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Bring Channings Erbin heim!
Vorschau
Impressum
BringChanningsErbin heim!
Bud Wilcox hat genug von Revolvern und blauen Bohnen in der Luft. Die Schrecken des Bürgerkriegs haben ihn von seinem vorangegangenen Leben als Revolverheld kuriert, und er hat als Arbeiter auf der Ranch von John Sterlowe seinen Frieden gefunden. Bis ihn der Chef mit einer besonderen Aufgabe betraut: Die sechzehnjährige Judy hat die einige Tagesritte entfernte Ranch ihres Großvaters geerbt. Bud soll sie dorthin begleiten. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinen alten Remington-Revolver wieder umzuschnallen. Und nicht zu früh ...
Der Knall war ohrenbetäubend. Feuchte Erde spritzte hoch und sprenkelte sein Gesicht. Sofort folgte die nächste Explosion. Die Druckwelle erfasste ihn und schleuderte ihn durch die Luft. Obwohl der Boden vom Regen durchweicht war, trieb ihm der Aufprall die Luft aus den Lungen. Bud Wilcox wälzte sich auf den Rücken und sah sich mit weit aufgerissenen Augen um. Wo waren die anderen?
Jetzt entdeckte er seine Kameraden. Blaue Uniformen, die durch den dichten Regen in einiger Entfernung an ihm vorbeirannten. Er wollte schreien, bekam aber kein Wort heraus. Er schmeckte Blut, seine Ohren klingelten. Unaufhörlich tobte der Schlachtenlärm, spien die Kanonen und Karabiner der Konföderierten ihre todbringenden Geschosse aus. Wie lange tobte der Kampf schon? Er wusste es nicht, jedes Zeitgefühl schien ihm verloren gegangen zu sein. Aber er musste auf diesen Hügel. Generalmajor Howard hatte es befohlen.
Etwas Schweres landete direkt neben ihm. Er fuhr herum und blickte in die toten Augen eines jungen Mannes, nicht viel älter als zwanzig Jahre. Sein Kinn und seine rechte Wange waren aufgeschürft, auf seiner Stirn klaffte knapp über dem linken Auge ein hässliches schwarzes Loch. Ein Blutsfaden rann daraus hervor. Der Junge war tot.
Das würde Bud auch bald sein, wenn er nicht vom Fleck kam.
Bud rappelte sich auf. Die von Schweiß und Regen durchnässte Uniform klebte ihm am Körper. Der Tag hatte brüllend heiß begonnen, bevor am frühen Nachmittag schwarze Wolken aufgezogen waren wie eine düstere Drohung. Nicht lange danach hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet und schien sie seitdem nicht mehr schließen zu wollen.
Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass er sich nichts gebrochen hatte. Erneut knallte es, doch diesmal war die Sprenggranate zu weit von ihm entfernt eingeschlagen, um ihm etwas anhaben zu können. Überrascht stellte er fest, dass er sein Gewehr verloren hatte. Hatte er es bei sich getragen, bevor er von den Füßen gefegt worden war? Er konnte sich nicht erinnern. In einer fließenden Bewegung zog er den Colt Navy Revolver aus dem Holster. Dabei stellte er fest, dass seine Hose am rechten Oberschenkel einen langen Riss hatte. Solange das Fleisch darunter heil war, sollte es ihm egal sein.
Bud setzte sich in Bewegung. Nach einigen Schritten fiel ihm auf, dass er nun tatsächlich allein zu sein schien. Durch den Regen, der wie eine Wand aus Wasser wirkte, waren keine blauen Uniformen mehr zu sehen. Mit zusammengebissenen Zähnen lief er weiter.
Früher hatte ihm Gefahr nie etwas ausgemacht. Sie hatte praktisch zu seinem Alltag gehört, und er war ihr stets mit einem kühlen Lächeln entgegengetreten. Doch nichts und niemand hatte ihn auf die Schrecken des Krieges vorbereitet. Das hier war etwas anderes, als irgendeinem verlausten Outlaw gegenüberzustehen, der im Zweifel aus zehn Schritten Entfernung kein Scheunentor treffen konnte. Etwas verflucht anderes. Auf einem Schlachtfeld war es nicht unbedingt notwendig, ein guter Schütze zu sein. Es wurde einfach auf alles geschossen, was sich bewegte, und in der Menge der Gegner trafen die Kugeln auf jeden Fall irgendein Ziel.
Abrupt blieb er stehen. Da vorn bewegte sich etwas. Er kniff die Augen zusammen und ließ sich im nächsten Moment ins Gras fallen. Diese Männer dort trugen Uniformen in der falschen Farbe. Eine Gruppe von Konföderierten schlich etwa dreißig Schritte von ihm entfernt hügelaufwärts. Ohne den Regen hätten sie ihn entdeckt. Sie waren zu sechst, bewegten sich langsam und vorsichtig, die Karabiner im Anschlag.
Das Unwetter ließ beinahe schlagartig nach, und er entdeckte jetzt mehr Einzelheiten. Die Grauröcke näherten sich einer kleinen Baumgruppe. Ihr Anführer, ein hagerer Bursche, der sein Käppi wohl verloren hatte, hob die Hand. Der Trupp blieb stehen.
»Ihr da drüben!«, brüllte er mit einer Stimme, die so rau klang, als würde er mit Kieselsteinen gurgeln. »Wir wissen, dass ihr euch hier versteckt. Kommt raus, wenn ihr überleben wollt!«
Hinter den Bäumen traten vier Nordstaaten-Soldaten hervor, die Hände erhoben. Keiner von ihnen war viel älter als der junge Bursche, der mit einem Loch in der Stirn ein paar Yards hinter Bud im nassen Gras lag. Ihre Angst war ihnen selbst auf die Entfernung hin deutlich anzusehen. Der dem Anschein nach Jüngste von ihnen, rothaarig und so dürr, dass er beinahe wie ein Skelett in Uniform wirkte, zitterte am ganzen Körper.
»Die Waffen weg«, befahl der Hagere. »Ganz langsam.«
Tut es nicht, dachte Bud, aber natürlich taten sie es, sie waren zu eingeschüchtert, um sechs Männern zu widersprechen, die Gewehre auf sie gerichtet hielten. Mit behandschuhten Händen griffen sie nach den Kolben ihrer Armeerevolver, zogen sie vorsichtig aus den Holstern, sorgfältig darauf bedacht, keine schnelle Bewegung zu machen.
Wenn sie erst einmal entwaffnet waren, würden die Konföderierten sie erschießen, davon war Bud überzeugt. Sein Mund war trocken geworden. Einzugreifen wäre einem Selbstmord gleichgekommen. Er und die vier Jungs gegen sechs Männer, die alle wie harte Burschen aussahen. Stattdessen konnte er einfach im nassen Gras liegen bleiben und zusehen, wie seine Kameraden massakriert wurden. Die Grauröcke würden weiterziehen, ohne ihn auch nur bemerkt zu haben.
Nur würde er damit nicht leben können.
Der Regen hatte weiter nachgelassen, der Himmel schien die Schleusen endlich schließen zu wollen. Die Jungs hielten ihre Revolver mit je zwei Fingern an den Kolben in die Höhe. Jeden Augenblick würden sie sie fallen lassen. Darauf warteten die anderen Kerle nur.
Bud schaltete das Denken aus und überließ sich ganz seinem Instinkt, wie er es immer in brenzligen Situationen zu tun pflegte. Er sprang auf die Beine. Einer der Südstaatler musste ihn gehört haben, jedenfalls wirbelte er mit dem Karabiner im Anschlag herum. Bud drückte ab. Die Kugel zerfetzte dem Mann den Hals, Blut spritzte in einer roten Fontäne aus der aufgerissenen Schlagader.
Einen Herzschlag lang schien die Zeit stillzustehen. Seine vier Kameraden glotzten Bud an wie einen Geist. Zwei von ihnen brauchten nur eine Sekunde, um auf die neue Situation zu reagieren. Ihre Finger schlossen sich um die Kolben ihrer Colts. Drei Konföderierte drehten sich um, die beiden anderen wandten die Köpfe.
Dann krachten die Schüsse. Bud warf sich in den Schlamm, feuerte im Fallen, und noch bevor er die Erde berührt hatte, hatte er einen weiteren Gegner ausgeschaltet. Der dritte versuchte seinen Karabiner auf ihn auszurichten, aber Bud, gestählt in mehr als einem Dutzend Schießereien, war schneller.
Die erste Kugel traf den Mann in die Schulter, die zweite in die Brust. Der Getroffene stieß einen Schrei aus, taumelte zurück und prallte gegen seinen Kameraden, der in diesem Moment auf die Blauröcke vor ihm ballerte und einem von ihnen das rechte Auge ausschoss. Dessen linker Nebenmann erwiderte das Feuer. Der Angerempelte kämpfte noch mit seinem Gleichgewicht, als ihn das Blei aus unmittelbarer Nähe im Schädel traf.
Bud spannte den Hahn, drückte ab, spannte wieder den Hahn. Durch den Pulverrauch und den wieder stärker werdenden Regen sah er nur Schemen. Das Donnern der Waffen und die Schreie der Männer dröhnten in seinen Ohren. Mit einem Klicken traf der Hahn auf eine leere Kammer. Seine Hand fuhr in die Hosentasche, und hektisch suchte er nach Munition. Erst als er die Patronen unter seinen Fingern spürte, bemerkte er, dass nicht mehr geschossen wurde.
Er hob den Kopf. Wo sich eben zehn Männer gegenübergestanden hatten, war jetzt nur noch einer, und der trug eine blaue Uniform. Es war der dürre Rothaarige. Seine Hand mit dem Colt zitterte, der Schrecken stand ihm ins Gesicht geschrieben, und er sah aus, als würde er gleich in Ohnmacht fallen.
Der Regen wusch den scharfen Geruch des Schießpulvers aus der Luft. Das Ganze hatten sich binnen weniger Sekunden abgespielt. Bud blinzelte das Wasser weg, das sich auf seiner Stirn gesammelt hatte und ihm jetzt in die Augen rann, erhob sich und ließ den Blick über die Toten wandern. Drei Kameraden und alle Konföderierten lagen reglos in ihrem Blut.
Wenigstens einen hatte er retten können.
»Alles klar mit dir?«, rief er ihm zu.
Erst reagierte der Bursche nicht, dann drehte er langsam den Kopf und sah ihn an. Seine blauen Augen glänzten, und das nicht nur wegen des Regens. »Danke«, sagte er matt, wandte sich ab und stapfte Richtung Hügel.
Bud sah ihm nach, bis er hinter einer Anhöhe verschwunden war.
✰
Sechs Jahre später
Bud Wilcox lehnte mit dem Rücken am Weidezaun und sah sich an, wie am Horizont die Sonne unterging und das Land in ihr blutrotes Licht tauchte.
Der Sommer neigte sich dem Ende zu. Der Herbst schickte seine ersten Boten und ließ die Nächte kühler werden. Heute jedoch war noch einmal ein richtig heißer Tag gewesen. Gedankenverloren nahm Bud den Hut ab und strich durch sein strohblondes Haar, das von der Hitze des Tages feucht war. Das grobe sandfarbene Hemd hatte er durchgeschwitzt. Unter den Armen hatten sich dunkle Flecken gebildet. Er würde das Hemd wechseln müssen. Er hasste es, nach Schweiß zu riechen.
Die Arbeit auf der Sterlowe-Ranch war anstrengend, aber Bud genoss jeden einzelnen Tag. Nach seinem unsteten Leben als Revolverheld und Kopfgeldjäger und den Erlebnissen im Krieg hatte er hier endlich Ruhe und Frieden gefunden. Bei dem Gedanken musste er grinsen. Zum Teufel, wenn ihm jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass er eines Tages damit glücklich sein würde, Zäune zu reparieren und Pferde zu tränken, er hätte ihn für verrückt erklärt. Nur hatte der Krieg ihm die alte Lust an Schießereien und an der Gewalt ein für alle Mal ausgetrieben. Manchmal sah er in seinen Träumen das Gesicht des dürren Rothaarigen vor sich, und dann wachte er jedes Mal schweißgebadet auf.
Nun ja, zugegeben brauchte es noch etwas anderes, damit er sich vollständig zufrieden fühlte. Mit seinen vierunddreißig Jahren stand er voll im Saft und gönnte sich regelmäßig einen Besuch im Bordell von Bonata, einem kleinen Städtchen nur etwa zwei Meilen südlich von der Ranch gelegen.
Bei dem Gedanken regte sich etwas in seinen Lenden. Wann war er das letzte Mal dort gewesen? Das musste wenigstens vier Wochen her sein. Viel zu lange. Er verspürte einen rasch größer werdenden Appetit auf Jane, seine Lieblingslady. Vor seinem geistigen Auge erschien ihr verführerisches Bild. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und Brüste, wie von einem Künstler gemalt. Oh ja, er würde ...
»He, Bud, bist du eingepennt?«, riss ihn eine kehlige Stimme aus seinen Gedanken.
Bud verzog das Gesicht. Das war Trevor, den alle nur Trevi nannten, weil er nicht viel größer als ein Zwerg war. Trevi erledigte nur die einfachsten Dinge, Botengänge und Hilfsarbeiten, und nicht einmal das kriegte er fehlerfrei hin. Die anderen Männer waren der Meinung, dass ihn John Sterlowe nur deshalb nicht zum Teufel jagte, weil er ein viel zu gutes Herz hatte, und Bud hatte sich dieser Meinung schon vor geraumer Zeit angeschlossen. Das war etwas, wofür er seinen Boss schätzte.
Jetzt stand Trevi vor ihm und musste den Kopf in den Nacken legen, um Bud ins Gesicht zu sehen, denn er reichte ihm gerade mal bis zur Brust. Sein Kopf war fast so rund wie ein Ball, in dem zwei kleine blaue Knopfaugen saßen. Auf dem fast kahlen Schädel wuchsen vereinzelt Büschel struppigen grauen Haars. Als er ihn angrinste, entblößte er gelblich verfärbte Zähne.
»Hab dich schon zweimal angesprochen. Hast einfach nicht reagiert«, murrte er.
»Du sprichst zu leise. Habe ich dir schon oft gesagt«, erwiderte Bud und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Ich spreche zu leise?« Trevi setzte eine empörte Miene auf. »Ich würde eher behaupten, du solltest dir mal die Gehörgänge durchblasen lassen. Mister Sterlowe will dich sehen.«
»Um diese Zeit? Ist schon Feierabend.«
Trevi zuckte die Schultern. »Soll ich ihm sagen, dass du in der Wanne liegst und dir von Catherine die Eier massieren lässt?«
Catherine Wullingham arbeitete als Köchin auf der Ranch, und tatsächlich hätte er sich gerne mal von ihr auf diese Art und Weise behandeln lassen. Nur war sie verheiratet und ein echter Drachen, was im Widerspruch zu ihrer elfengleichen Erscheinung stand. Wenn sie an einem vorbeiging, musste man ihr einfach hinterhersehen. Alles andere ließ man besser bleiben.
Irgendwann, bevor Bud auf die Ranch gekommen war, hatte es einer der Cowboys gewagt, ihr eindeutige Avancen zu machen. Als Antwort hatte sie ihm ohne Zögern eine mit Speck und Bohnen gefüllte Bratpfanne über den Schädel gezogen. Wenn die Jungs abends beim Bier zusammensaßen, wärmten sie die Geschichte regelmäßig auf und lachten sich dabei schlapp.
»Lass gut sein, Trevi«, sagte Bud. »Catherine würde mir die Eier vermutlich abreißen und in die Pfanne schlagen. Ich bin schon unterwegs.«
Trevi nickte, stieß ein trockenes Kichern aus und wackelte auf seinen kurzen Beinen davon.
Fünf Minuten später saß Bud in John Sterlowes Büro. Es war gemütlich eingerichtet, mit viel dunklem Holz, einer kleinen Sitzecke und Bilder an den Wänden.
Sterlowe saß in einem großen Ledersessel hinter seinem riesigen Schreibtisch, Bud hatte auf dem weit schlichteren Besucherstuhl davor Platz genommen. Der Rancher war ein Berg von einem Mann und wirkte selbst im Sitzen wie ein Riese. Sein kahler Schädel glänzte wie frisch poliert. Er hatte wulstige Lippen und eine mächtige Nase und vermittelte den Anschein von jemandem, mit dem man sich besser nicht anlegte.
Tatsächlich jedoch war er von einem überaus sanftmütigen Wesen. Sterlowe pflegte den Menschen mit Respekt zu begegnen, gleichgültig, ob es sich um Kunden, Geschäftspartner oder Leute handelte, die für ihn arbeiteten. Auch das schätzte Bud an ihm.
»Was kann ich für Sie tun, Mister Sterlowe?«, fragte er.
»Ein Glas Whiskey, Bud?«
Bud nickte und zog gleichzeitig eine Braue hoch. Während der ganzen Zeit, die er jetzt auf der Ranch arbeitete, hatte er schon einige Unterhaltungen mit seinem Boss geführt, aber noch nie hatte der ihm einen Drink angeboten. Er folgerte daraus, dass es sich um eine wichtige Angelegenheit handeln musste.
Sterlowe griff in ein Fach unter dem Schreibtisch, holte eine fast volle Flasche und zwei Gläser hervor und schenkte jeweils einen Fingerbreit ein. Eines der Gläser reichte er Bud und prostete ihm zu. Bud nahm es und trank einen Schluck. Der Stoff war wirklich hervorragend. Ein Tropfen vom Feinsten.
»Kommen wir zur Sache«, sagte Sterlowe und stellte sein Glas ab. »Ich habe dich rufen lassen, weil ich einen kleinen Auftrag für dich habe.«
»Worum geht's denn?«
»Du kennst doch Judy?«, fragte er überflüssigerweise, weil natürlich jeder auf der Ranch Judy kannte.
Sie war Sterlowes Enkelin. Sechzehn Jahre alt, hochgewachsen und so hübsch, dass sich die Männer nach ihr umdrehten. Eine Sache, der sie sich offenkundig bewusst war, denn manchmal pflegte sie beim Gehen lasziv ihre Hüften zu schwingen, was die Kerle schier verrückt machte. Sie hatte lange braune Haare, die sie meistens zu einem Zopf gebunden trug, große dunkle Augen und einen Schmollmund.
Bud konnte die Kleine nicht leiden. Ihr oft schnippisches Benehmen ihm gegenüber und ihre Launen gingen ihm auf die Nerven. Außerdem behandelte sie ihn von oben herab wie einen persönlichen Diener. Eine echte Rotzgöre. Er ging ihr so gut wie möglich aus dem Weg.
Aber worauf wollte Sterlowe hinaus?
»Na klar, sie ist Ihre Enkelin«, antwortete er vorsichtig.
»Richtig, meine Enkelin. Ihre Mutter war meine Tochter. Ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber sie hat noch einen anderen Großvater, väterlicherseits. Sein Name ist William Channing. Er besitzt ebenfalls eine Ranch. Sie liegt in der Nähe von Goldwater, das sind vier Tagesritte von hier.«
Er sammelte sich kurz. »Als Judys Eltern damals bei diesem Unfall ums Leben kamen, haben wir darüber diskutiert, wer von uns beiden sie zu sich nehmen sollte. William steckte damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und hatte andere Dinge im Kopf, und so wurden wir uns rasch einig, dass sie bei mir leben würde. Ein Jahr später hatte er seine Probleme gemeistert. Aber da sich Judy hier gut eingelebt hatte, wollten wir sie nicht erneut aus ihrer vertrauten Umgebung herausreißen, und so beschlossen wir, es dabei zu belassen. William ist das nicht leichtgefallen, denn er mochte seine Enkelin. Sie war das Einzige, was ihm von seinem Sohn geblieben war. Andererseits kannte er sich selbst gut genug, um zu wissen, dass er mit Kindern eigentlich nicht besonders gut umgehen konnte.«
»Ich verstehe«, sagte Bud und beglückwünschte William Channing in Gedanken dafür, dass er sich den kleinen Satansbraten nicht ins Haus geholt hatte.
»Er hat Judy einige Male besucht, allerdings wurden diese Besuche immer seltener. Zuletzt war er vor vier Jahren hier. Er hatte immer viel zu tun und noch dazu eine Zeitlang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ich konnte das verstehen. Tja, und nun ist es leider zu spät. Vergangene Woche wurde er ermordet.«
»Ermordet?«
Sterlowe trank von seinem Whiskey, bevor er fortfuhr: »Eine verdammte Schande. Jemand hat ihm in den Rücken geschossen, als er abends in Goldwater unterwegs war. Dummerweise wurde ich erst benachrichtigt, als er bereits beerdigt worden war.«
»Das tut mir leid.«
»Danke, Bud. Obwohl wir uns selten gesehen haben, mochte ich den alten Knaben. Der Tod unserer Kinder hat uns auf eine gewisse Art einander nahegebracht. Aber ich habe dich nicht kommen lassen, um dir rührselige Geschichten zu erzählen. Heute Morgen erhielt ich ein Telegramm. Williams Testament ist vor ein paar Tagen eröffnet worden. Er hat Judy die Ranch und sein ganzes Vermögen vermacht.«
Diesmal hob Bud beide Brauen. Judy Channing – Channing war ja dann wohl ihr Nachname – konnte er sich in vielen Rollen vorstellen. Eine Rancherin gehörte eindeutig nicht dazu. »Wie komme ich da ins Spiel?«, wollte er wissen.





























