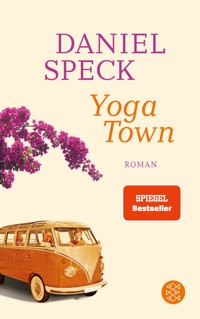12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Erfolg von »Piccola Sicilia« nun der neue Roman von Bestseller-Autor Daniel Speck. »Jaffa Road« macht die menschliche Dimension eines der größten Konflikte der Welt emotional erfahrbar. »Es ist schlicht meisterhaft, wie Daniel Speck den hochkomplizierten Nahostkonflikt mit großer Kenntnis als packende und anrührende Familiengeschichte erzählt – ein absolutes Leseerlebnis.« Peter Münch, Süddeutsche Zeitung »Der Roman ist eine riesige Weltgeschichtsstunde und dabei so unangestrengt, so leicht und verständlich, dass man einfach begeistert liest.« Jan Weiler Eine Villa am Meer unter Palmen: Die Berliner Archäologin Nina reist nach Palermo, um das Erbe ihres verschollenen Großvaters Moritz anzutreten. Dort begegnet sie ihrer jüdischen Tante Joëlle - und einem mysteriösen Mann, der behauptet, Moritz' Sohn zu sein. Elias, ein Palästinenser aus Jaffa. Haifa, 1948: Unter den Bäumen der Jaffa Road findet das jüdische Mädchen Joëlle ein neues Zuhause. Für das palästinensische Mädchen Amal werden die Orangenhaine ihres Vaters zur Erinnerung an eine verlorene Heimat. Beide ahnen noch nichts von dem Geheimnis, das sie verbindet, in einer außergewöhnlichen Lebensreise rund ums Mittelmeer. Drei Familien, drei Generationen, drei Kulturen - und ein gemeinsames, bewegendes Schicksal: Nach »Piccola Sicilia« ist »Jaffa Road« Fortsetzung und Abschluss dieser Familiengeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Daniel Speck
Jaffa Road
Roman
Über dieses Buch
Eine Villa in Palermo und ein Koffer voller Fotos. Das ist alles, was der Exildeutsche Moritz Reincke seinen Erben hinterlassen hat. Keinen Abschiedsbrief. Keine Erklärung, warum er drei Familien hatte, die einander nicht kannten.
Als seine Enkelin Nina, seine Tochter Joëlle und sein Sohn Elias sich begegnen, stehen sie vor einem Rätsel: Moritz war ein Chamäleon mit drei Leben, die rund ums Mittelmeer führen, aber voller Leerstellen, Widersprüche und Geheimnisse bleiben. Die drei fremden Verwandten setzen seine Lebensreise durch die Nachkriegszeit wie ein Mosaik zusammen, indem sie von ihren Müttern erzählen - den drei Frauen, die Moritz geliebt hat. Eine Deutsche, eine Israelin und eine Palästinenserin. Es sind die bewegenden Erinnerungen dreier Städte: Berlin, Haifa und Jaffa. Und die Erzählungen dreier Nationen, die schicksalhaft miteinander verbunden sind. In Moritz’ Villa auf Sizilien treffen sie auf tragische Weise aufeinander. War es Selbstmord oder hat ihn sein eigener Sohn getötet? Um das Rätsel zu lösen, müssen Nina, Joëlle und Elias sich fragen, ob sie trotz aller Unterschiede eine Familie sein können.
Weitere Romane von Daniel Speck:
›Bella Germania‹
›Piccola Sicilia‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Daniel Speck, 1969 in München geboren, baut mit seinen Geschichten Brücken zwischen den Kulturen. Durch seine Reisen und seine Recherchen trifft er Menschen, deren Schicksale ihn zu seinen Romanen inspirieren. Der Autor studierte Filmgeschichte in München und in Rom, wo er mehrere Jahre lebte. Er verfasste Drehbücher, für die er mit dem Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Sein Roman ›Bella Germania‹ wurde als Dreiteiler prominent verfilmt. Mit dem Bestseller ›Piccola Sicilia‹ führt Daniel Speck uns auf eine Reise ins Herz des Mittelmeers. Dieses vielstimmige Panorama der Kulturen erweitert er in seinem neuen Familienroman ›Jaffa Road‹.
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Michael Trevillion/Trevillion Images (Kind) und mauritius images/mauritius images Zeitgeschichte exklusiv/Karl Heinrich Lämmel
ISBN 978-3-10-490965-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Prolog
1
Palermo
2
3
Camp 60
4
5
6
7
Palermo
8
9
Haifa
10
11
Palermo
12
Jaffa
13
14
15
Palermo
16
Haifa
17
Palermo
18
Betlehem
19
20
Palermo
21
Haifa
22
23
24
25
26
Palermo
27
Betlehem
28
Palermo
29
Haifa
30
31
32
33
34
35
Palermo
36
Berlin
37
Palermo
38
Haifa
39
Palermo
40
41
42
München
43
Jericho
44
45
München
46
47
48
Palermo
49
München
50
51
Palermo
52
Tunis
53
54
55
56
57
58
59
60
Haifa
Epilog
Karte von Haifa
Dramatis Familiae
An die Leserinnen und Leser
Danksagung
»Man weiß selten, was Glück ist,
aber man weiß meistens, was Glück war.«
(Françoise Sagan)
Prolog
Später, in Momenten des Zweifels, würde Joëlle sich immer an diesen Morgen erinnern. Das endlose Meer ringsherum und die begrenzende Geborgenheit in seinen Armen. Reines, leuchtendes Glück. Immer wenn sie sich an Papà zu erinnern versuchte, würde sie ihn als diesen jungen Mann im frühen Licht sehen, der mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm an der Reling stand. Wie er seinen braunen Filzhut tiefer zog, damit der Wind ihn nicht fortwehte, wie seine raue, unrasierte Wange sich an ihre schmiegte, wie er auf eine Wolke zeigte und ein springendes Pferd sah. Einen Walfisch. Einen Drachen. Sie liebte ihn, wie nur ein Kind lieben kann, grenzenlos. Zwischen ihnen war nichts Falsches, nichts als Liebe und Vertrauen. In Papàs Gegenwart vergaß sie die schwitzenden Körper unter Deck, deren Gestank und schreckliche Geräusche in der Nacht, all die unruhigen Träume, die sie übers Mittelmeer verfolgten, und das Grauen, das sie zu vergessen suchten. Papà sang ein Lied, ganz leise, damit niemand ihn hörte, denn er sang auf Deutsch. Joëlle erinnert sich noch genau an den Refrain, Heimat, deine Sterne, sie strahlen mir auch an fernem Ort. Sie liebte den Klang dieser Sprache, auch wenn sie kein Wort verstand. Und sie vermochte nicht zwischen dem Wiegen seiner Arme und dem Atem des Meeres unter dem Schiff zu unterscheiden. Aber sie weiß heute noch, wie all diese Geheimnisse, eingebettet in die riesigen Wolkentürme über dem Wasser, sie erregten und zugleich mit tiefer Ruhe erfüllten.
Wenn es ein Vermächtnis gab, das Papà ihr in diesen frühen Jahren geschenkt hatte, dann war es seine Zuversicht. Wenn sie bei ihm war, trug sie das Leben. Alles schien, mitten im Chaos, in eine unerklärliche, unerschütterliche Ordnung eingebunden. Heute, wo ihr diese Sicherheit abhandengekommen ist, fragt sie sich, ob Papà es im Innersten auch so empfunden hat oder nur für sein Kind stark sein musste, während er in Wahrheit genauso verloren war wie alle anderen Seelen auf diesem Schiff. Das Geheimnis des Glücks, hatte er einmal gesagt, ist Dankbarkeit. Es ist nicht wichtig, ob du viel oder wenig besitzt. Entscheidend ist nur, ob du für das, was du hast, dankbar bist. Das Leben ist ein Geschenk, Joëlle, eine Gnade. Es hängt an einem dünnen Faden. Denk nie, du hättest einen Anspruch darauf.
Tatsächlich war es nur Dankbarkeit, die den maroden Dampfer in ein Haus verwandelte, die enge Koje in ein Bett, und das Land, auf das sie Kurs hielten, in eine Heimat. Keine Ferne machte ihnen Angst; Hoffnung war alles, was sie besaßen. Jeder sang und träumte in seiner Sprache, und das Meer trug sie. Woher sie das Vertrauen nahmen? Keiner wusste es. Es war die grundlose Heiterkeit der Überlebenden. Jenes Land, das ihnen versprochen worden war, in den Displaced Persons Camps des zerstörten Europas, den illegalen Büros und dunklen Gassen, wo sie Geldscheine gegen Geflüster tauschten, hatte keiner von ihnen gesehen. Und dennoch erschien es ihnen nicht als Fremde, sondern als sicherer Hafen, der sie mit offenen Armen empfangen würde. Sie täuschten sich, wie alle, die von einem Ort zum anderen flohen, doch es war eine süße Täuschung.
»Wie weit fahren wir, Papà?«
»Immer der aufgehenden Sonne entgegen. Bis das Meer aufhört.«
So einfach war das. Wenn es in dieser Welt einen Menschen gab, auf den sie sich verlassen konnte, dann war es Papà. Er hatte ihr nicht nur die ersten Schritte und das Fahrradfahren beigebracht, sondern auch das freie Denken und den Mut zu einem Leben, das niemand bestimmte außer sie selbst. Papà war ein Mann, der nicht viel Worte machte, aber wusste, wohin er ging. Er besaß etwas, das vielen heute fehlt: Gewissen. Ein innerer moralischer Kompass. Wenn er sagte, dass etwas richtig war, war es richtig, und wenn er fand, dass etwas falsch war, war es falsch. Später, wenn Joëlle sich in der Welt verlief und nicht weiterwusste, wünschte sie sich, sie könnte ihn nach seinem Rat fragen. Und dennoch hat Papà sie bei der wichtigsten Frage im Leben belogen. Die Frage: Wer bin ich?
»Maurice!«, brüllte ein Matrose hinter ihnen. »Weg von der Reling! Alle Passagiere unter Deck!« Im selben Moment sahen sie die Rauchfahne des britischen Zerstörers. Von der Brücke warf der Kapitän, der keine Uniform trug, die Fischereikarten, das Logbuch und das Funkgerät über Bord. Sie hatten keine Waffen, aber sie würden die verhassten Briten mit einem Hagel von Konservenbüchsen begrüßen. Sie würden sich nicht zurückschicken lassen; alle Brücken hinter ihnen waren verbrannt. Nicht weit hinter dem Horizont lag ihr Gelobtes Land.
1
Palermo
Das Mittelmeer spricht mit vielen Stimmen.
Fernand Braudel
Maurice hatte seinen Tisch für zwei gedeckt. Zwischen den leeren Tellern steht eine halbvolle Weinflasche; nur eines der beiden Gläser ist benutzt. Dazu eine unberührte Schale mit Oliven und ein Teller mit trockenen Baguettescheiben, über die jetzt Ameisen krabbeln. Der Schuss war draußen gefallen, in seiner Garage. Vorher hatte er noch die Fensterläden geschlossen. Als hätte er sich erschossen, weil er vergeblich auf einen Gast gewartet hatte. Die Einrichtung wirkt, als wäre die Zeit vor dreißig Jahren stehen geblieben: Ein altes Festnetztelefon, ein Plattenspieler, kein Computer. Seine Katze streicht mir unruhig um die Beine; niemand hatte sich um sie gekümmert. Das Erste, was ich tue, als ich im Haus meines Großvaters ankomme, ist, nach Katzenfutter zu suchen. Ich öffne ein Fenster; Sonnenlicht flutet ins Halbdunkel, Kinderstimmen, das Knattern von Motorrollern und das Rauschen der Palmblätter. Im Garten stehen Terracottatöpfe, eine verrostete Hollywoodschaukel und blühende Hecken zu den Nachbargrundstücken. Es hat etwas von einem Versteck, aber das Meer ist nah, und darüber liegt ein heiterer Himmel. Sein täglicher Ausblick. Ich frage mich, ob er Heimweh hatte. Was er all die Jahre in Palermo gemacht hat. Und wie viele Menschen man im Laufe eines Lebens lieben kann.
Hinter mir knarzt das alte Parkett. Joëlle geht verloren durch den Raum, und als sie den Kopf zu mir dreht, ist sie nicht mehr die elegante Dame, als die ich sie kennengelernt hatte. Sondern ein hilfloses, zitterndes Mädchen.
»Warum?«, fragen ihre Augen.
Gestern Morgen war die Welt noch in Ordnung gewesen. Eigentlich ist sie ja nie in Ordnung, andauernd zerbricht irgendwo irgendetwas, aber wer will das schon so genau wissen. Ich hatte die Scherben meiner geschiedenen Ehe aufgesammelt, geordnet und beschriftet. Noch passte nicht alles zusammen, aber ich hatte gelernt, mich im Unvollständigen einzurichten. Unter meinen Füßen trug der Boden, ich begann meine Flügel auszubreiten, und manchmal ertappte ich mich staunend dabei, dass ich schon seit Tagen nicht mehr an die Trennung gedacht hatte. Berlin wurde leicht und vergaß den Winter.
Ich weiß genau, wann mein Handy klingelte, um 9 Uhr 33, denn im selben Moment blieb die U-Bahn im Tunnel stehen, kurz vorm Bahnhof Friedrichstraße, und ich sah auf das Display. 0039, Italien. Der Anrufer stellte sich als Avvocato Catalano vor, aus Palermo. Er sei der Notar meines Großvaters, Moritz Reincke. Er fragte nach meinem Namen. Nina Zimmermann, ja, korrekt. Ob ich morgen nach Palermo kommen könnte. Unmöglich, sagte ich. Die U-Bahn fuhr ruckartig an, und ich stand auf, um auszusteigen. Ich wollte das Gespräch schon beenden, da erklärte er, es tue ihm leid, aber er habe mir eine traurige Mitteilung zu machen: Mein Großvater sei vorgestern verstorben. Der Strom der Aussteigenden spuckte mich auf dem Bahnsteig aus. Der Mann am Telefon blieb ruhig, nannte meine Adresse, mein Geburtsdatum und den Geburtsort. So stehe es im Testament, das ihm zur Verwahrung anvertraut wurde. Nach italienischem Recht müsse ich persönlich in Palermo erscheinen, um mein Erbe anzutreten. Ob ich vielleicht auch zur Beerdigung … Die Menschen drängten sich an mir vorbei, rempelten mich von hinten an, und ich fühlte – nichts. Wie verabschiedet man sich von jemandem, der nie da war?
Oben auf der Straße schnappte ich nach Luft und rief meine Tante Joëlle in Paris an. An ihrer Stimme hörte ich sofort, dass sie es wusste. Derselbe Notar hatte sie auch angerufen. Und dann sagte sie etwas, das mir den Boden unter den Füßen wegzog.
»Er sagt, es war Selbstmord.«
Ihre Stimme klang gebrochen, untröstlich. Ich fühlte mich betäubt, verwirrt, aber vor allem: betrogen. Der Mann, den wir gemeinsam suchten, war gestorben, bevor wir ihn finden konnten. Mein Großvater, ihr Vater, der ewig Verschollene.
»Nina, ich kann das nicht glauben. Ich kenne ihn doch. Er könnte das nie tun.«
Fakten. In solchen Momenten muss man sich an Fakten festhalten.
»Wo soll das passiert sein?«
»In Palermo. Er hat dort ein Haus, sagt der Notar.«
»Wie hat er dich ausfindig gemacht, Joëlle?«
»In seinem Testament steht meine Adresse, meine Telefonnummer … kannst du dir das vorstellen, all die Jahre wusste er, wo ich lebe, aber nie …«
Mir wurde schwindlig.
»Kommst du, Nina? Bitte. Ich schaff das nicht alleine.«
Ich rief meinen Chef in der Antikensammlung an, packte meinen Koffer, und am nächsten Morgen nahm ich den ersten Flieger. Berlin-Rom-Palermo. Das Erbe meines Großvaters antreten: Was sollte das bedeuten? Bisher war alles, was er uns hinterlassen hatte, eine Leerstelle, die nichts als Legenden gebar. Er kam nie aus dem Krieg zurück, das war einer dieser knappen Sätze, die meine Großmutter über ihn sagte. Oder: Er ist in der Wüste verschollen. Die Abwesenden sind mächtiger als die Anwesenden; das hatte ich schon als Kind gelernt, denn unser ruheloser Geist toleriert keine Leere, muss sie mit Hörensagen ausfüllen, auch wenn es Lügen sind; alles ist erträglicher als das Nichts. Der Schatten seines Schweigens hatte meine Großmutter zu einer verbitterten Frau und meine Mutter zu einer Nomadin gemacht. Nichts war uns geblieben, nicht einmal eine Uniform oder ein Grab, an dem wir ihn besuchen konnten. Üblicherweise setzt der Tod einen Punkt hinter ein Leben, manchmal auch ein Ausrufezeichen, und wenn er zu früh kommt, ein Komma. Mein Großvater hinterließ ein Fragezeichen. Der Mann mit den zwei Namen. Moritz, Maurice. Das Chamäleon mit den drei Leben. Eines in meiner Familie. Eines in Joëlles Familie. Und ein drittes, von dem wir beide nichts wussten.
Erst seit letztem Herbst kennen wir uns, Joëlle und ich, aber es erscheint mir wie ein ganzes Leben. Man wird zweimal geboren, einmal ohne eigenes Zutun und ein zweites Mal aus sich selbst heraus, und Joëlle war, ohne dass wir es je so benannt hätten, meine zweite Mutter. Unsere langen Spaziergänge am Strand, unsere nächtlichen Gespräche waren wie eine Wiedergeburt nach meiner Ehekrise. Seitdem habe ich mein Leben auf den Kopf gestellt, und dass mich das nicht mit Angst, sondern mit Freude erfüllt, habe ich Joëlle zu verdanken. Was sie mir über meinen Großvater erzählte, hat mich aus meinem Selbstmitleid gerissen. Ich begriff, wie vermessen es gewesen war, zu glauben, mir sei etwas Außergewöhnliches passiert, während es in Wahrheit doch ganz gewöhnlich war: Eine geschiedene Frau mehr in Berlin, sonst nichts, anderswo sterben Menschen. Es gibt Geschichten, die das Leben verändern. Die einen, weil man sich selbst in ihnen wiederfindet, und die anderen, weil sie einem ermöglichen, die Welt aus den Augen der anderen zu sehen. Zu erfahren, dass mein Großvater Moritz, der im Afrikafeldzug Vermisste, nicht gefallen war, sondern fernab der Heimat eine zweite Familie gegründet hatte, ihn dafür nicht zu verdammen, sondern seine Beweggründe zu verstehen, änderte alles. Er hatte meine Großmutter im zerbombten Berlin nicht im Stich gelassen, weil er sie nicht liebte. Sondern weil das Leben ihm mitten im Krieg eine neue Liebe geschenkt hatte. Und eine Tochter namens Joëlle. Dass er in der Nacht vor der Abreise an die Front ein Kind gezeugt hatte, meine Mutter, wusste er nicht. So einfach war das, und oft sind es die einfachen Wahrheiten, die Wunden heilen. Der Groll meiner Großmutter, der unsere Familie in seinem Bann gehalten hatte – es war nicht mehr meiner. Ich wünschte, meine Mutter, die ihren Vater nie kennenlernen durfte, wäre heute noch am Leben, um Joëlle zu treffen – ihre unbekannte Halbschwester, die im selben Jahr wie sie geboren wurde: 1943. Die eine in Berlin, die andere in Tunis. Die Alliierten hatten das Deutsche Afrikakorps geschlagen, Hunderttausende Deutsche und Italiener gingen in Gefangenschaft, aber Moritz war in letzter Minute desertiert. Versteckt im Haus der Familie Sarfati. Italienische Juden, die ihn wie einen Sohn behandelten, weil sie den Menschen hinter der Uniform erkannten. Vom Fenster aus konnte er das Meer hören, das ihn von Europa trennte. Und im Zimmer nebenan schlief die junge Frau, die die Liebe seines Lebens werden sollte. Joëlles Mutter. Mit Moritz, dem sie den Namen Maurice gaben, erlebte Joëlle die glückliche Kindheit, die meiner Mutter verwehrt geblieben war. Und dann, als Joëlle erwachsen wurde, war Moritz aus ihrer Familie ebenso leise und unauffindbar verschwunden wie aus meiner. Sie hat die Hoffnung, ihn wiederzusehen, nie aufgegeben.
Ich gehe als Fremde durch sein Haus, die Katze maunzt, und ich finde das verdammte Futter nicht. Joëlle steht vor dem geschlossenen Klavier und liest das Notenblatt auf dem Ständer. Sie fröstelt, wickelt den Schal um ihre Schultern, und als wüsste ich die Antwort auf ihre Frage, Warum?, umarmt sie mich und beginnt zu weinen. Ich halte sie und staune, wie leicht es mir fällt, Trost zu spenden, während ich doch selbst verloren bin. Vor dem Fenster, im Garten, steht ein Mann, der uns beobachtet.
»Ich traue ihm nicht«, flüstert Joëlle.
Catalano, der Notar, war am Flughafen von Palermo nicht erschienen, obwohl er versprochen hatte, uns abzuholen. Ich hatte nach ihm Ausschau gehalten, als ich in die Ankunftshalle kam – lauter Männer, die Namensschilder hielten, Mr. und Mrs. Soundso, aber nirgends stand mein Name. Ich fragte mich kurz, was ich hier überhaupt mache. Dann sah ich Joëlle. Sie wartete an der Bar. Neben ihr bohnerte ein Putzmann den Boden. Sie tat so, als würde der Lärm sie nicht stören. Ihr kleiner, resoluter Körper, ihre mondäne Erscheinung, ein bisschen zu jugendlich in ihrem Sommerkostüm mit Hut. Lippenstift und Schminke, tiefe Lachfalten und blitzende Augen, und nie ohne Schal, selbst jetzt nicht an einem warmen Apriltag. Sie ist über siebzig und lebendiger, als ich es je gewagt hatte zu sein. Als sie mich sah, lächelte sie, als wäre sie immer noch dieselbe, aber als ich näher kam, erkannte ich den Abgrund, der sich in ihr aufgetan hatte. Sie breitete ihre Arme aus und herzte mich. Worte waren unnötig. Es gibt Menschen, die kannst du nicht finden, sie finden dich. So jemand ist Joëlle. Seit sie mich gefunden hat, ist etwas in mir in eine heilsame Unordnung geraten.
Dann rief der Notar an. Es habe eine Verzögerung gegeben, sagte er, irgendwas mit Polizei und Spurensicherung, es tue ihm leid, er würde uns später im Hotel besuchen.
»Geben Sie mir die Adresse meines Vaters«, sagte Joëlle.
Catalano versuchte sie abzuwimmeln, man könne auch morgen noch das Haus besuchen, aber sie insistierte unerbittlich, bis er ihr die Adresse gab. Er würde dort auf uns warten.
Während der Fahrt mit dem Taxi schwiegen wir, irgendwann nahm Joëlle meine Hand und drückte sie. Auf der Landstraße am Meer entlang ließ sie das Fenster runter und zündete sich, ohne den Fahrer zu fragen, eine Zigarette an.
Wir fanden das Haus in Mondello. Der Villenvorort schmiegt sich an ein ehemaliges Fischerdorf, wo die Sommerfrischler aus Palermo mit ihren Badetaschen aus dem Bus steigen. Tatsächlich war ich schon einmal hier gewesen, auf meiner Hochzeitsreise. Die Vorstellung, dass mein Großvater nur ein paar Schritte von dem Strand entfernt wohnte, auf dem ich mit meinem Ex gelegen hatte, verstört mich. Moritz hätte an mir vorbeigehen können, und ich hätte ihn nicht erkannt; einer der Herrschaften mit Hut, die hier abseits vom Lärm der Stadt residieren. Hier gibt es schattige Alleen mit gepflegten Gärten und Jugendstilvillen. Alles scheint etwas aus der Zeit gefallen; der weiße Sandstrand, die Badeanstalt auf dem Pier mit ihrer Art-Deco-Fassade, ein aristokratisches Sommeridyll, heute banalisiert durch den Lärm der Bars und Restaurants am Lungomare, wo feiernde Palermitaner auf Rentnerinnen stoßen, die ihren Hund ausführen.
Im ersten Moment kam es mir abweisend vor, das Haus meines Großvaters. Aber das lag nur an dem Schweigen, das es umgab. Die Fensterläden waren verschlossen. Auf dem Gehweg lagen Laub und Blüten. Im Vorgarten ragte eine verwilderte Palme in die Höhe. Es befand sich in einer Seitenstraße unweit des Meeres. Eine weiße, schnörkellose Fassade, deren Putz abblätterte. Es war gepflegt, aber in die Jahre gekommen. Moritz muss wohlhabend gewesen sein, oder er hatte das Haus schon vor Jahrzehnten gekauft, als es noch bezahlbar war. Mein Leben lang hatte ich von einem Haus am Meer geträumt. Da lag es nun im sizilianischen Licht und wartete auf mich. Sofort verscheuchte ich den Gedanken wieder. Das Eisentor stand offen. Auf dem Kiesweg vor der Garage parkte ein schwarzer Mercedes, und daneben erkannte ich zwei Männer. Der ältere telefonierte am Handy. Ich erkannte die Stimme des Notars. Maßgeschneiderter Anzug über dem Wohlstandsbauch, Krawatte, gepflegter Haarkranz. Der jüngere stand daneben und rauchte. Ich schätzte ihn auf Mitte, Ende vierzig, vielleicht ein Sizilianer. Offenes Hemd und Jeans, schlank, gepflegter Fünftagebart, graue Strähnen im schwarzen Haar. Als er uns vor dem Tor stehen sah, beobachtete er uns einen Moment lang, ohne uns hereinzubitten. Erst als ich durchs Tor ging und Joëlle mir folgte, kam er uns ein paar Schritte entgegen. Auf den ersten Blick strahlte er die Lässigkeit eines Mannes aus, der schon Schlimmeres überstanden hatte. Kraftvoll, aber ruhig. Auf den zweiten Blick wirkte er genauso übernächtigt und durch den Wind wie wir. Er hatte sich nur besser unter Kontrolle.
»Buongiorno.«
Er gab uns die Hand, ohne seinen Namen zu nennen. Er schien auf uns gewartet zu haben, auch wenn er seine Skepsis nicht verbarg. Oder war es Schüchternheit? Sein Händedruck war gefühlvoll. Das Auffälligste waren seine tiefgrünen, intensiven Augen. Er hielt den Blick, als würde er sich wirklich dafür interessieren, wer ich bin. Seine Präsenz war auf verwirrende Art anziehend, denn trotz seiner Freundlichkeit umgab ihn etwas Unergründliches, das ihn vom Rest der Welt trennte, ohne dass ich es hätte benennen können. Es gibt Menschen, die ihre Verletzungen offen tragen. Solche wie ich, die sich nicht verstellen können. Die über alles nachdenken müssen. Und dann gibt es solche, deren Wunden so tief reichen, dass sie nur überleben können, wenn sie nichts mehr davon wissen wollen. So einer schien er zu sein. Der traurigste gutaussehende Mann, dem ich je begegnet war.
Der Notar beendete schnell sein Telefonat und schüttelte uns kräftig die Hand.
»Bruno Catalano. Benvenuti a Palermo!«
Dann stellte er uns vor.
»Signora Sarfati aus Paris. Signora Zimmermann aus Berlin. Das ist Dottor Bishara.«
Sein diskreter Blick schien den anderen zu fragen, ob er etwas erklären sollte. Ich bemerkte eine kurze Verunsicherung zwischen ihnen, die sie zu überspielen versuchten. Ohne es auszusprechen, fragte ich mich, ob der Dottore sein Arzt war. Ob mein Großvater krank war.
»Mein herzliches Beileid«, sagte Catalano.
»Grazie«, sagte Joëlle. »Dürfen wir rein?« Ohne die Antwort abzuwarten, ging sie zum Haus. Von Anfang an hielt sie Catalano auf Abstand, obwohl sie keinen Grund dazu hatte. Er war zuvorkommend und korrekt, aber nichtsdestotrotz der Überbringer einer Nachricht, die sie nicht hören wollte. Ihr Vater gehörte ihr, und jeder, der ihre Erinnerung störte und ihre Hoffnung, dass er doch noch lebte, war ein Eindringling in die Schatzkammer ihrer Seele. Den anderen Mann beachtete sie erst nicht groß. Aber ich spürte, dass er es war, nicht der Notar, der das Geheimnis meines Großvaters kannte. Catalano lief Joëlle nach und holte sie noch vor der Türe ein. Bishara und ich blieben stehen.
»Kommen Sie auch?«, fragte ich.
Als unsere Blicke sich trafen, hielt er seine dunkelgrünen Augen eine Sekunde länger als erwartet auf mich gerichtet. Dann schüttelte er den Kopf. Ich spürte einen instinktiven Widerwillen, wie der eines Tieres, das die Reviere der anderen meidet. Catalano rief mich zu sich, und ich ging zu ihm, während Bishara am Tor stehen blieb. Das war unsere erste Begegnung, drei Fremde vor der Haustür eines Verschwundenen, unter Palmen, an einem windigen Frühlingstag.
2
Seine Leiche haben sie schon abtransportiert. Wir stehen in der Kühle seines Wohnzimmers, wie bestellt und nicht abgeholt, atmen den Geruch seiner Ledersessel und Teppiche, blicken auf seine Fotos an den Wänden und seine Bücher in den Regalen. Er hat hier gelebt, ohne Zweifel, die Bilder bezeugen es, aber nur den sehr jungen Mann erkenne ich, den in Schwarz-Weiß, der auf einem Steg am Wannsee steht, mit nacktem Oberkörper und skeptischem Blick in die Kamera. Das muss meine Großmutter fotografiert haben; sie hat mir davon erzählt, wie sie ihm dort zum ersten Mal begegnet war; ein stiller Außenseiter, der immer seine Kamera in der Hand hatte und außergewöhnlich gute Porträts machte. Auf späteren Fotos erkenne ich ihn kaum wieder. Ein älterer Herr im Garten, der ein Rosenbeet jätet. Gebeugter Rücken, weißes Haar. Dann, zurück in der Zeit, als sein Haar noch dunkelbraun und voll war, ein gutaussehender Mann im Sommerhemd, die Ärmel hochgekrempelt, vor einem braunen Citroën, vielleicht in den späten Siebzigern. Sein Blick in die Kamera: skeptisch lächelnd, als würde er dem Fotografen nicht ganz vertrauen. Ich versuche zu erkennen, wo das Bild aufgenommen wurde; man sieht das Nummernschild nicht, nur die scharfen Schatten des Südens, und niemanden sonst, keine Frau, keine Kinder. Ich kann die Scherben nicht zusammenfügen.
»Wie haben Sie uns eigentlich gefunden?«, frage ich den Notar.
»Signor Reincke hat Ihre Adressen und Telefonnummern im Testament hinterlegt.«
»C’est impossible!«
Joëlle ist genauso fassungslos wie ich. Der Gedanke, dass er wusste, wo ich bin, aber sich nie gemeldet hatte, macht mich traurig. Und wütend.
»Hatten Sie denn gar keinen Kontakt?«, fragt Catalano.
»Nein!«, ruft Joëlle.
»Wie hat er das rausgefunden?«, will ich wissen.
»Ich weiß nicht«, sagt Catalano, »aber heutzutage ist es nicht allzu schwer, solche Nachforschungen zu betreiben.«
Joëlle stützt sich auf der Couch ab und muss sich setzen.
»Alles okay?«
»Verstehst du das, Nina?«
»Nein.«
»Ich bringe Sie ins Hotel«, sagt Catalano und geht voraus zur Tür. Die irritierende Selbstverständlichkeit, mit der er sich hier bewegt. Als wäre es sein Haus.
»Wir bleiben hier«, bestimmt Joëlle. Catalano sieht mich fragend an. Ich weiß nicht, ob ich hier übernachten möchte, im Haus eines Toten.
»Wo wollen Sie schlafen? Das Gästezimmer ist nicht vorbereitet.«
»Das lassen Sie mal unsere Sorge sein«, sagt sie.
»Sie möchten doch sicher etwas zu Abend essen?«
»Wir kochen uns was.«
»Signora, es tut mir leid. Sie können hier nicht bleiben«, insistiert er. »Es ist ein Tatort. Die Kriminalpolizei …«
»Ich dachte, es wäre Selbstmord?«, unterbricht ihn Joëlle.
»Auch in diesen Fällen muss die Polizei …«
»Ich will die Leiche sehen.«
»Natürlich, Signora, morgen können wir zur Gerichtsmedizin gehen. Trotzdem, hier im Haus … Ich muss Sie wirklich bitten …«
Sie steht energisch auf.
»Es ist das Haus meines Vaters. Natürlich schlafe ich hier.«
Sie wirft mir einen Blick zu, der mir klar macht, dass ich zu ihr gehöre, und geht an ihm vorbei zur Treppe nach oben. Catalano breitet ratlos schnaufend die Arme aus. Durchs Fenster sehe ich Dottor Bishara auf der Terrasse. Er gießt Pflanzen. Hat uns beobachtet. Catalano macht ihm ein Zeichen und geht zu ihm nach draußen. Ich höre nicht, was sie sagen, aber aus den Gesten kann ich lesen, dass Bishara abwiegelt. Als ich zu ihnen komme, sagt Bishara zu mir:
»Ist schon gut. Willkommen.«
»Sie sucht ihn schon sehr lange«, erkläre ich. »Sie hatte immer die Hoffnung, ihn lebend zu treffen.«
»Ich verstehe«, sagt Catalano. Ich höre ein unausgesprochenes »aber« mitschwingen.
»Hat er nichts von ihr erzählt?«, frage ich.
»Offenbar hatte der alte Mann ein paar Geheimnisse«, sagt Bishara ironisch, aber nicht überrascht.
»Sarfati … ein jüdischer Name, nicht wahr?«, fragt Catalano.
»Ja.«
»Aber Moritz …«
»Joëlles Mutter war Jüdin.«
Bishara hört uns verhalten, aber neugierig zu, und ich habe den Eindruck, dass Catalano die Frage für ihn gestellt hat.
»Wussten Sie«, frage ich, »dass mein Großvater als Soldat in Tunis war?«
»Ja.«
»Dort hat er Joëlles Mutter kennengelernt.«
»Ach. Wusstest du das?«, fragt Catalano Bishara.
Der schüttelt den Kopf.
»Ich auch nicht«, sage ich. »Er galt ja als verschollen. Und ich wusste nie, was er im Krieg gemacht hat. Ob er vielleicht ein Nazi war. Aber dann bin ich Joëlle begegnet. Und sie hat mir erzählt, was in Tunis passiert ist. Tatsächlich hat er einem italienischen Juden das Leben gerettet.«
»Davvero?«, fragt Catalano, als würde er Moritz das nicht zutrauen. »Bella storia!«
Ich sehe Bishara beim Denken zu.
»Dann musste er untertauchen«, ergänze ich. »Die Eltern des Mannes haben ihn in ihrem Haus versteckt. Und Moritz hat sich in deren Tochter verliebt. Joëlles Mutter.«
»Damals lebten dort viele Italiener«, sagt Catalano. »Juden, Katholiken, tutti quanti. Sie nannten es La Piccola Sicilia. Es liegt von hier aus näher als Rom. Das sagt alles über uns Sizilianer!«
Er lächelt geistreich, als hätte er mir gerade die Welt erklärt. Bishara mustert mich stumm. Nicht als ob er mir nicht glauben würde. Aber als wüsste er mehr als ich.
Aus dem ersten Stock hören wir ein dumpfes Poltern. Joëlle muss etwas umgeworfen haben. Catalano schnauft und geht nach drinnen. Er durchquert das Wohnzimmer, wo ich ihn nicht mehr sehe, aber ich höre, wie er die Schiebetür zum hinteren Bereich, in dem der Schreibtisch steht, schließt.
»Was hat er Ihnen denn erzählt?«, frage ich Bishara.
»Dass er nach dem Krieg zurückgegangen ist. Nach Berlin. Dass er dort eine Familie hatte.«
Ich bin fassungslos. Das ist die Version seines Lebens, die sich meine Mutter immer gewünscht hatte. Die nie stattgefunden hat.
»Nein, er kam nie zurück, weder tot noch lebendig.«
Ich frage mich, warum er Bishara belogen hat.
»Wie lange lebt er schon hier?«
»Lange. Dreißig Jahre ungefähr.«
»Und Sie sind … sein Arzt?«
Bishara nickt, aber seine Gedanken sind woanders. Er scheint froh darüber zu sein, dass Catalano uns unterbricht. Ob ich das Hotel bevorzugen würde. Er habe zwei Zimmer gebucht. Ich antworte, dass ich Joëlle nicht allein lassen könne. Es ist mir genauso unangenehm wie ihm. Ich rufe nach ihr. Keine Antwort.
»Andiamo, Bruno«, sagt Bishara, »ich muss meine Kinder abholen.«
»Bitte fassen Sie nichts an«, sagt Catalano zu mir, und dann, nach einer Pause: »Die Testamentseröffnung …«
Er beendet den Satz nicht, sucht nach den richtigen Worten.
»Haben Sie es schon gelesen?«, frage ich.
Sein Blick weicht aus. Er reicht mir seine Visitenkarte.
»Kommen Sie morgen um zehn in mein Büro. Da besprechen wir dann … alles.«
»Arrivederci«, sagt Bishara, um das Gespräch schnell zu beenden. Catalano folgt ihm nur widerwillig durch den Garten, ums Haus herum. Im Gehen dreht er sich noch einmal um. Es gefällt ihm nicht, uns hier allein zu lassen. Wieder steigt dieses Gefühl aus meiner Kindheit in mir hoch: Moritz’ Verschwinden hinterlässt eine Unbestimmtheit; ohne klare Regeln macht jeder seine eigenen, und ich fühle mich nicht sicher. Es bräuchte jemanden, der das Vakuum füllt, mit Ruhe und Verlässlichkeit, und ich befürchte, dass Joëlle, so gerne sie es tun würde, nicht mehr dazu imstande ist.
Sie kommt zu mir, als das Motorengeräusch sich entfernt. Sie ist müde. Etwas in ihr ist zerbrochen. Ein festes Fundament, auf dem ihre Sorglosigkeit geruht hatte. Ich schlage vor, etwas essen zu gehen, aber sie geht wie in Trance zur Garage und bleibt davor stehen. Das gelbe Absperrband der Polizei flattert im Wind. Ich trete an ihre Seite, und eine Zeitlang starren wir auf das weiße Garagentor. Ich bin froh, dass es verschlossen ist. Ich nehme Joëlle am Arm, und wir gehen zurück ins Haus.
Joëlle stößt alle Fenster auf, die hohen Flügel und Fensterläden. Abendlicht flutet den Raum, wir hören das Meer rauschen. Es ist, als wollte sie den Tod aus seinem verlassenen Haus vertreiben. Ich bin schon einen Schritt weiter, ich spüre, dass er nicht mehr lebt und dass es sinnlos ist, es zu verleugnen. Sie öffnet die Schiebetür und macht sich an seinem Schreibtisch zu schaffen. Es ist sinnlos, zu versuchen, sie zurückzuhalten. Sie stöbert und wühlt und weiß doch nicht, was sie sucht, weil das, was sie eigentlich finden will, nämlich er, greifbar nah, aber doch verschwunden ist. Mir ist nicht danach, in sein Reich einzudringen, solange er noch nicht einmal unter der Erde ist. Ich gehe in die Küche, um einen Kaffee zu machen. Die Katze maunzt. Am Ende gebe ich ihr die Mortadella, die ich im Kühlschrank finde. Dann sehe ich einen Einkaufszettel an der Wand, auf den Moritz mit Bleistift geschrieben hat: Burro. Prezzemolo. Detersivo. Cibo per gatti. Eine schwungvolle, altmodische Schrift, die klar und energisch wirkt. Ich suche nach einer weiblichen Spur in der Küche, aber finde nichts. Alles ist sauber und aufgeräumt, als hätte er keine Unordnung hinterlassen wollen. Ich muss den Notar fragen, ob es einen Abschiedsbrief gibt, schießt es mir durch den Kopf. Den Kaffee hat er sich mit einer alten, rußverkrusteten caffetiera gemacht. Im Sieb ist noch kalter Kaffeesatz. Sein letzter. Ich zögere, dann klopfe ich ihn aus und schalte den Gasherd an.
»Joëlle, hör auf«, sage ich und finde doch keine Worte, die sie trösten könnten. Ich stelle ihre Tasse auf den Schreibtisch, werfe einen Blick auf die verstreuten Papiere, wende mich ab, weil ich kein Recht habe, sie zu lesen. Und dann entdecke ich, hinter Joëlles Rücken, einen Safe in der Wand. Am Boden darunter steht ein abgenommenes Bild mit Fischerbooten, das den Safe wohl verdecken sollte. Die Tür steht halb offen; ich schaue hinein – der Safe ist leer.
»Schau mal!«, sage ich, aber sie reagiert nicht. Erst jetzt bemerke ich, dass sie weint und zittert, während sie sucht und sucht und doch nichts findet.
»Nichts. Absolut nichts.«
»Nichts was?«
»Kein einziges Foto von mir oder meiner Mutter. Nichts.«
Tatsächlich, so konservativ sein Altherren-Schreibtisch auch wirkt – etwas fehlt, das sonst immer vorhanden ist: die Familienfotos. Weder aus unserer noch aus Joëlles Familie.
»Er hat uns ausgelöscht. Findest du das nicht skandalös?«
Nein, das finde ich nicht. So habe ich ihn kennengelernt, den Mann, den ich nie kennenlernen durfte. Ich bin auf einmal wieder neun Jahre alt und sehe meiner Mutter zu, die in einem plötzlichen Anfall von Wut oder Sehnsucht Omas Fotoalben aus dem Schrank zerrt und durchwühlt und vom Tisch wirft und Oma für Dinge anklagt, die ich nicht begreife. Alles, was ich damals verstand, war, dass Oma sagte, er sei tot, sie solle endlich zur Vernunft kommen. Millionen verreckte Soldaten, so sei das eben gewesen im Krieg. Und dass Mama schrie, nein, das dürfe sie nicht sagen, es gäbe keinen Beweis! Was, wenn er tatsächlich noch lebte, irgendwo?
Und jetzt Joëlle, Jahrzehnte später, die gleiche Wut, die gleiche Wunde, das gleiche Aufbäumen gegen die Wirklichkeit. Obwohl sie ihn doch als Vater hatte. Ich habe von Männern gehört, die zwei parallele Familien hatten, ohne dass die Frauen voneinander wussten, und von Männern, die verschwinden, um woanders eine zweite Familie zu gründen. Aber ein Mann, der zweimal verschwindet, zwei Frauen und Töchter zurücklässt, um dann ein drittes Leben unter Palmen zu führen – wie erklärt man das außer durch eine pathologische Persönlichkeit?
»Joëlle, hör auf.«
»Reincke, Reincke, Reincke. Nirgends steht Sarfati!«
Sie zieht seine Briefe aus den Schubladen, Stromrechnungen und Handgeschriebenes, sie liest nur den Namen, immer nur diesen deutschen Namen: Moritz Reincke. Ich sehe hilflos zu, wie sie sich im Dunkeln verrennt. Was man bei sich selbst nicht bemerkt, wie man blind wird vor Liebe oder Hass, erkennt man nur bei anderen. Vielleicht habe ich diesen Mann gerade deshalb geliebt, weil er nie da war. Weil er sich entzog und verwandelte, sobald ein eindeutiges Bild von ihm erschien. Wenn er niemand war, konnte er alles sein. Er war die weiße Leinwand meiner Phantasie. Für Joëlle aber war er der Fixstern ihrer Kindheit. In ihrer Erinnerung war die Zeit stehen geblieben, sein Bild wie versteinert, als hätte er nie weitergelebt. Und jetzt fällt das alles auseinander. Zum ersten Mal bin ich einen Schritt weiter als sie. Jetzt liegt es an mir, ihr Halt zu geben.
»Joëlle, siehst du das?«
Spätes Licht scheint auf den Fenstersims, und in der leichten Staubschicht erkenne ich zwei rechteckige Leerstellen. Genau dort, wo der Blick hinfällt, wenn man am Schreibtisch sitzt.
»Hier standen Fotorahmen.«
Joëlle fährt mit dem Finger über den Staub.
»Das ist nicht lange her.«
Ich schaue zur Wand. Wenn man genau hinsieht, bemerkt man auch dort die etwas helleren Stellen, an denen einmal kleine Bilderrahmen hingen. Jemand muss sie entfernt haben. Vielleicht die Polizei, vielleicht Moritz, vielleicht jemand anderes. Wer war auf diesen Fotos?
»Er hat so viel fotografiert«, sagt Joëlle. »Er muss Fotos von mir gehabt haben. Hunderte.«
»Warum hat er deine Mutter verlassen?«
»Er hat sie nicht verlassen. Sie war die Liebe seines Lebens.«
Zum ersten Mal ertappe ich mich dabei, dass ich Joëlle nicht ganz glaube. Mich interessieren Geschichten des Scheiterns viel mehr als Geschichten mit Happy End. Das war schon immer so, auch vor meiner Scheidung. Filme oder Romane, in denen sich die Liebenden am Ende in den Armen liegen, sind mir suspekt. Als Teenager entwickelte ich einen schrägen Tick: In Buchläden lese ich nie die ersten Sätze, um zu entscheiden, ob ich ein Buch kaufe, sondern blättere bis zum Ende, lese die letzte Seite, und wenn es gut ausgeht, lege ich das Buch zurück. Ich kaufe keine Lügen. Glückliche Enden empfinde ich als Verrat an der Wirklichkeit. Dunkle Geheimnisse, tragische Trennungen, unmögliche Liebe – da bin ich zu Hause. Mein Ex – so wie ich ihn inzwischen nenne, nie mehr mit seinem Namen; auch das eine Art Auslöschung – hat sich oft lustig darüber gemacht. Denn tatsächlich zeigte unsere Ehe keine Spur von Tragik und Untergang. Sie war der einzige Ort auf der Welt, an dem ich kein Unglück vermutete, sie war meine Insel. Insgeheim war ich stolz darauf, dass ich mein Nest besser gemacht hatte als meine Mutter und meine Großmutter. Nie hätte ich gedacht, dass ausgerechnet dort die Bombe einschlagen würde. Und jetzt schockiert mich nichts mehr. Keine Liebe ist von Dauer. Nicht etwa, weil die Welt schlecht wäre, nein, die Welt ist voller Liebe, und genau das ist das Problem. Der größte Feind der Liebe ist nicht Hass, sondern eine andere, noch größere Liebe. Wer zu wenig davon bekommen hat, wird süchtig nach mehr, immer mehr.
»Joëlle, was ist passiert? Erzähl mir die Wahrheit. Auch wenn sie weh tut.«
Es dauert ein wenig, bis sie sich beruhigt und wir uns erschöpft ans Fenster setzen. Bis das Licht langsam schwächer wird und Schatten das Zimmer durchwandern. Bis das Schweigen sich ausbreiten darf und Joëlle die Erinnerung zulassen kann.
»Stell dir einen Mann vor«, sagt sie, »der sich entschieden hat. Für seine Familie. Gegen alles, was ihm vorher etwas bedeutet hat. Stell es dir einfach vor, auch wenn du nicht glaubst, dass Männer so lieben können. Damals gab es sie noch. Sie machten nicht viele Worte, sie zeigten ihre Liebe, indem sie nach dem Krieg die Ärmel hochkrempelten und ein Haus bauten, mit bloßen Händen. Vielleicht waren sie verschlossener als heute, vielleicht verstanden sie ihre Frauen nicht, vielleicht betrogen sie sie sogar. Aber glaub mir, sie hätten getötet, um ihre Familie zu beschützen.«
»Hat er wirklich jemanden getötet?«
»Nein. Vielleicht war das seine einzige Schwäche. Vielleicht war er zu gutmütig. Vielleicht wäre sonst nicht alles auseinander gegangen. Aber er hat etwas getan, das noch mehr Mut erforderte: Er hat sich selbst ausgelöscht. Aus Liebe zu meiner Mutter. Er änderte seinen Namen, nahm ihre Religion an und heiratete sie. Er stieg mit ihr auf ein illegales Auswandererschiff, kurz nach dem Krieg, und beschloss, nie mehr zurück zu kehren.«
3
Camp 60
Alle große Literatur
ist eine von zwei Geschichten:
Ein Mensch geht auf eine Reise,
oder ein Fremder kommt in die Stadt.
Leo Tolstoi
»Mein Name ist Maurice Sarfati.«
»Ihr Pass ist eine Fälschung.«
»Mein Name ist Maurice Sarfati.«
Wenn er es oft genug wiederholte, würden sie es ihm glauben. Es war nicht einmal gelogen. Er sagte nicht: »Ich bin Maurice Sarfati.« Er trug seinen Namen wie ein neues Hemd, eine Krücke, einen Schlüssel.
Bis sie es glaubten. Bis er es selbst glaubte.
Joëlle stand neben ihm in der Menschenschlange auf dem staubigen Hafenpier, an der Hand ihrer Mutter. Das Gelobte Land stank nach Öl und Brackwasser. Es war heiß. Überall standen Koffer herum, Stacheldraht wucherte über Sandsäcken, hellhäutige Soldaten in kurzen Hosen und roten Mützen kontrollierten die Ausweise, stellten Fragen auf Englisch und notierten die Antworten in ihren Listen: Einschiffungshafen, Name des Schiffes, Wohnort, Familienstand. Man hörte Namen wie Łódź, Trieste, Bergen-Belsen, Dachau. Ein alter Mann zog den Ärmel seiner verfilzten Jacke hoch, um die eintätowierte Nummer auf dem Arm zu zeigen. Der Nächste drängte sich vor und schob ihn beiseite, eine Frau verlangte Milch für ihr Baby. Die Soldaten zogen einen jungen Mann heraus, um ihn abzuführen. Er war einer der Matrosen ihres gekaperten Schiffes, das der britische Zerstörer in den Hafen von Haifa geschleppt hatte.
Maurice reichte dem Engländer die Papiere. Joëlle hatte keine Angst an seiner Seite, auch wenn sie durstig war und in der Sonne schwitzte. Solange Mamma und Papà bei ihr waren, konnte niemand ihr etwas anhaben. Sie spürte, dass Papà dem jungen Soldaten überlegen war, obwohl dieser eine tadellose Uniform trug und Papà nur diesen zerschlissenen Anzug. Was in Maurice vor sich ging, wie sehr er Angst hatte, aufzufliegen, zurückgeschickt oder verhaftet zu werden, ahnte sie nicht.
»Mein Name ist Maurice Sarfati. Das ist meine Frau, Yasmina Sarfati. Und meine Tochter, Joëlle Sarfati.«
Im Italienischen, das er mit seiner Familie sprach, sagt man über seinen Beruf beispielsweise: »Faccio il marinaio«. Ich mache den Matrosen. Ich bin es nicht. Ich könnte es jederzeit auch wieder sein lassen. Doch für den eigenen Namen sagt man: »Sono Maurice.« »Ich bin Maurice«. Wie eigenartig, dass Menschen sich mit einem Namen identifizieren, den sie – im Gegensatz zum Beruf – nicht gewählt haben. Sie sind also eine Idee ihrer Eltern. Später heißt es: »Ich bin Vater«, oder: »Das ist mein Mann«. Aber wäre es nicht angemessener zu sagen: »Faccio il papà«, »Faccio il marito«? Ich gebe den Vater, den Ehemann, den Italiener. Ich bin es nicht, sondern tue es, als Schauspieler auf der Bühne des Lebens. Ich erfülle die Vorstellung davon, was es in den Augen der anderen bedeutet, dieser oder jener zu sein.
»Italiener?«
»Ja.«
»Jude?«
»Ja.«
»Sind Sie Mitglied einer jüdischen Untergrundorganisation?«
»Nein.«
Der Brite glaubte ihm nicht. Auch wenn das die bisher einzig wahre Antwort war. Der Ton des Soldaten war bemüht neutral, aber eigentlich feindselig. Die Einwanderer hatten sich mit allen Mitteln gewehrt. Als der Zerstörer längsseits ging, hatten ein paar Leute Konservendosen an Deck geschleppt, um sie wie verrückt auf die britischen Seeleute zu werfen. Es gab Verletzte.
»Ihnen ist bewusst, dass Sie versucht haben, illegal einzureisen?«
Das war der Punkt, an dem die Männer vom Mossad Alyah Bet in Italien ihnen eingeschärft hatten, zu lügen, sie seien auf einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer. Moritz entschied sich für die Wahrheit. Eine Lüge schmeckt besser, wenn sie mit wahren Details geschmückt ist.
»Ja, natürlich.«
Der spitze Mund des Engländers entspannte sich.
»Wer hat Ihre Überfahrt bezahlt?«
»Die Jewish Agency.«
Der Soldat notierte seine Aussage, aufreizend indifferent. Maurice versuchte, Ruhe zu bewahren. Er kannte diese jungen Männer in Tropenuniform, die in ein fremdes, staubiges Land geschickt worden waren, ohne zu wissen warum. Er war selbst einer von ihnen gewesen. Bevor er Maurice Sarfati wurde.
»Wo gibt es Trinkwasser für meine Frau und meine Tochter?«
Der Soldat schrieb weiter, ohne aufzusehen.
»Sie haben kein Recht, uns wie Kriminelle zu behandeln!«, fuhr es aus Maurice heraus, viel zu heftig. Im selben Moment bereute er es.
»Sie wurden bei der illegalen Einreise in britisches Hoheitsgebiet gefasst. Die illegale Organisation, der Sie behaupten, nicht anzugehören, unterwandert die britische Einwanderungsquote. Und wenn ich eine persönliche Bemerkung hinzufügen darf, Ihre Leute haben meinen besten Kameraden auf dem Gewissen. Vor fünf Tagen hat eine Bombe seinen Jeep zerfetzt.«
»Wen meinen Sie mit Ihre Leute?«
Hass macht blind, würde Maurice später einmal zu der erwachsenen Joëlle sagen und sie an ihre Ankunft in Haifa erinnern. Wie er insgeheim erleichtert war, dass der Brite ihn tatsächlich für einen Juden hielt. Feinde erscheinen alle gleich, nur bei den eigenen Leuten differenziert man. Und das Geheimnis der Lüge, das weiß jeder Propagandaprofi, ist Ablenkung.
»Keiner der Menschen auf diesem Schiff«, erklärte Maurice, »hat eine Bombe im Gepäck. Manche haben nur die Kleider, die sie am Leib tragen. Und eine Nummer auf dem Arm. Wissen Sie, was diese Menschen hinter sich haben?«
»Ihr seid alle unschuldig. Natürlich. Nehmen wir mal an, Sie sind tatsächlich kein Mitglied des Mossad oder Palyam. Nehmen wir an, ich schicke Sie also nicht zurück nach Europa, sondern ins Camp. Noch bevor Sie dort Ihren ersten Teller Suppe bekommen, wird ein freundlicher junger Mann Sie ansprechen. Sie und alle anderen jungen Männer. Er wird Ihnen versprechen, Sie rauszuschmuggeln. Es gibt Tunnels, bestechliche Wachen … Und in ein paar Wochen werden einige von Ihnen – nicht alle, natürlich – einer Terrororganisation angehören und eine Bombe legen, die junge Briten tötet. Aber natürlich seid ihr alle unschuldige Flüchtlinge. Die Zeitungen lieben euch.«
»Hören Sie, wenn ich ein Matrose des Palyam wäre, hätte ich dann meine Frau und meine Tochter auf dieses Schiff mitgenommen? Sie ist vier Jahre alt.«
»Können Sie beweisen, dass diese Personen wirklich Ihre Angehörigen sind?«
»In meinem Koffer ist unsere Heiratsurkunde. Wenn Sie die …«
»Wo und wann haben Sie geheiratet?«
»In Rom.«
»Wann?«
Maurice spürte, wie ihm der Schweiß den Nacken hinunterlief. Aber er blieb bewegungslos. Er musste die Wahrheit sagen. Sie hatten den Koffer.
»1945.«
»Und ihre Tochter ist schon vier Jahre alt?«
Der süffisante Ton war nicht zu überhören. Er hatte Maurice an seiner Achillesferse erwischt. Maurice beugte sich zu dem Offizier und sagte leise, damit Joëlle es nicht hörte.
»Ihr … leiblicher Vater ist im Krieg gefallen.«
Maurices Hoffnung, das Mitgefühl des Engländers zu wecken, erfüllte sich nicht. Er blieb aufreizend unbeeindruckt.
»Wer ist in den Krieg gefallen?«, fragte Joëlle.
Maurice erschrak, beugte sich zu ihr hinunter und sagte: »Viele Menschen sind gestorben. Aber wir nicht, siamo fortunati, wie alle diese Leute hier; wir haben es geschafft.«
In Wahrheit hatten sie nicht viel geschafft, außer die Fahrt übers Mittelmeer zu überleben. Nur wenige der illegalen Schiffe schafften es noch bis zur Küste Palästinas, wo ihre Kapitäne sie auf Grund setzten und die Passagiere an Land schwammen. Inzwischen wurden die meisten dieser überladenen Seelenverkäufer von der britischen Küstenwache abgefangen und in den Hafen von Haifa geschleppt. Weil die Camps an der Küste längst überfüllt waren und die palästinensischen Araber gegen die jüdische Einwanderung protestierten, baute Großbritannien nun Lager auf Zypern, wo sie die Flüchtlinge hinbrachten, Zeltstädte im Niemandsland, umzäunt mit Stacheldraht, nicht mehr in Europa, aber noch nicht im Nahen Osten. Niemand wusste, wie lange sie dort ausharren mussten.
Einen halben Tag lang hatten sie die Bucht von Haifa sehen können, die sandsteinfarbenen Häuser am Hang, die roten Ziegeldächer und grünen Alleen. Eine Stadt wie ein Amphitheater, und der Hafen war die Bühne. Sie hatten die Radioübertragungen aus den offenen Fenstern gehört, hebräische und arabische Lieder, aber sie durften den Pier nicht verlassen. Am Abend führte man sie an Deck des britischen Zerstörers, wo es Suppe gab, Brot und eine Decke für die Nacht. Und in der Dunkelheit legte das Schiff wieder ab, mit Kurs auf Zypern.
Die Lichter von Eretz Israel verschwanden hinter dem Horizont. Einige standen an der Reling und weinten. Aber Moritz saß in seine Decke gehüllt auf dem Boden, hielt die schlafende Joëlle im Arm und war insgeheim glücklich. Der erste Schritt war gemacht. Sie hatten ihn offiziell registriert. In seiner Hand hielt er die weiße Karte, auf der in schwarzer Tinte geschrieben stand:
NATIONALITY: Italian.
RACE: Jewish.
NAME: Maurice Sarfati.
4
Das Camp hatte keine Geschichte. Es gab keine Stadt, die ihm ihren Namen hätte leihen können, keinen Berg und keinen See, nur eine gewundene Schotterstraße, die irgendwo auf einem weiten Feld endete, vor einem Tor aus Holzbalken und Stacheldraht. Ein langer Zaun, staubige Erde und nirgends ein Baum, der gegen die Sonne schützte. Nicht einmal ein Schild am Eingang. Der Grund, warum sie mir davon erzählt, sagt Joëlle, hat nichts mit dem Ort zu tun, denn Camp 60 auf Zypern war ein Nicht-Ort, den man am besten schnell wieder vergisst. Sondern mit dem, was dort zwischen Maurice und Yasmina geschah. Alles, was sich später in der Jaffa Road ereignen sollte, war bereits hier im Camp vorgezeichnet. Als liefen die Verzweigungen des Lebens auf unsichtbaren Schienen, die unweigerlich zu einer Bestimmung führen. Als trüge der Anfang jeder Liebe, die Erhöhung im Zauber, der Schicksalsglaube, bereits den Samen ihres Endes in sich, den Absturz ins Alltägliche, die Enttäuschung, den Verrat.
Joëlle war zu klein, um zu begreifen, was die Eltern von ihr abschirmten, und allein dafür schuldet sie ihnen Dank. Doch was die einen Schutz nennen, ist für die anderen eine Lüge. Erst als Maurice ihr später alles erzählte, erfuhr sie die Wahrheit. Sie verstand die Welt erst durch die Augen der anderen.
Und so ist alles, was nun folgt, die Erinnerung an eine Erinnerung. Nicht die Geschehnisse selbst, sondern ihre Wahrnehmung durch die Menschen, die sie durchlebt haben und durch ihre Kinder, denen davon erzählt wurde. Das Gedächtnis unserer Familien, fragmentiert von Wunden, Tabus und Loyalitäten. Die Rekonstruktion endet nie, denn anders als bei einer archäologischen Ausgrabung, wo man handfeste Scherben aus den Zeitschichten schürft, unterliegen die Verkrustungen der Gefühle einer ständigen Neuinterpretation. Und jeder erinnert sich auf seine Weise.
Ihre Handflächen waren verbrannt vom glühenden Blech, an dem sie sich festgekrallt hatten. Dann sprangen sie von den offenen Pritschen der Lastwagen hinunter in den Staub. Dutzende, Hunderte, reichten sich die Koffer und standen verloren in der Mittagshitze zwischen Zäunen, Gittern und Stacheldraht. Sie konnten nicht glauben, dass sie den Lagern entkommen waren, nur um wieder in einem Lager zu enden. Sie mussten sich ausziehen, bis auf die nackte Haut, und ihre Kleider auf große Haufen werfen. Dann kamen Soldaten, die Gasmasken trugen und Blechpumpen mit Entlausungsmittel, einem grauen Pulver, das die Haare verfilzte und im Rachen brannte. Es gab keine Duschen und kein fließendes Wasser, nur den täglichen Tanklastwagen, vor dem sie Schlange standen mit ihren Blechnäpfen. Es gab keine Häuser aus Stein, nur Wellblechbaracken, in denen Dutzende Familien schliefen, zusammen mit Alleinstehenden, zufällig zusammengewürfelt wie Stallhühner; sie sprachen nicht einmal dieselbe Sprache. Im Camp 60 hörte man Deutsch und Jiddisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch und Russisch; die wenigsten sprachen Englisch, und nur die Religiösen konnten Hebräisch. Man verständigte sich mit Händen und Füßen. Einige trugen altmodische Anzüge, andere kurze Khakihosen und Stiefel, auch die Frauen, und einige Männer liefen mit nacktem Oberkörper herum. Wer hier landete, hatte nur ein Ziel: möglichst schnell wieder wegzukommen. Die Briten hatten sie im Niemandsland abgeladen, weil keiner wusste, wohin man sie schicken sollte. Fünfzehntausend legale Einreisevisa verteilten sie pro Jahr, aber es kamen viel mehr Menschen übers Meer, und keiner wollte zurück nach Europa. Wie zum Trotz hissten sie zwischen den Baracken die weißblaue Flagge mit dem Davidstern. Als wären sie schon dort. Als gäbe es schon den Staat, den niemand außer ihnen »Eretz Israel« nannte. Auf allen Karten der Welt hieß das Land so, wie die Briten es nannten, Palästina. In ihren Köpfen aber war der Traum längst Wirklichkeit. Tatsächlich war dieses Camp im Nirgendwo kein Ort zum Leben, aber ein Ort, an dem die Menschen träumten, Tag und Nacht, unter der unbarmherzigen Sonne und dem Sternenhimmel. Sie träumten, um zu vergessen, wo sie waren, sie träumten, um zu vergessen, wo sie herkamen. Sie träumten von dem Land, in dem sie endlich sicher wären, dem Land ihrer Vorväter, das sie neu aufbauen würden, als Bauern, Soldaten und Lehrer. Und manchmal, wenn sie schliefen oder nachts zusammensaßen, kamen die Geister der Toten in ihre Zelte. Camp 60 war der Ort, an dem du einen Fremden nach seiner Familie fragtest und seine Antwort von deiner eigenen Familie erzählte. Ihre Liebsten waren tot. Sie waren allein. Sie wollten leben.
Niemand ahnte, wer Maurice einmal gewesen war. Keiner kannte seine Angst, dass die anderen es herausfanden. Maurice und Yasmina waren das schönste Paar des Lagers. Er aufrecht und hochgewachsen; sie mit ihren wilden Locken und dunklen Augen, ihrer undurchdringlichen Mischung aus Stolz, Zerbrechlichkeit und Mitgefühl für alle, die schwächer waren als sie, die elternlosen Kinder und gebrechlichen Alten. Wenn sie mit den Soldaten stritt, konnte sie energisch aufbrausen, aber wenn sie sich um jemanden kümmerte, umgab sie ein stilles Leuchten. Man wusste nie genau, wo Yasminas Körper endete; die Grenze zwischen ihr und den anderen war fließend. Manche Frauen im Lager waren eifersüchtig auf ihre dunkle Schönheit, und nicht wenige schwärmten von Maurice. Aber er hatte nur Augen für seine Frau. Er war auch bei den Männern beliebt, denn er half, wo er konnte, reparierte eine stehengebliebene Uhr oder ein kaputtes Dach; selbst die Soldaten baten ihn manchmal um Hilfe, als sie sein Talent für Feinmechanik erkannten. Joëlle durfte überallhin mit, und sie liebte es, seine geraden, schlanken Hände zu beobachten, wie sie ruhig und präzise ein Radio oder eine Armbanduhr zerlegten und wieder zusammensetzten. Wenn alle Teile verstreut auf dem Tuch lagen, das er am Boden ausgebreitet hatte, hatte er allein den Plan im Kopf, wie sie wieder zusammenzufügen waren, derselbe Prozess rückwärts. Und wenn die Leute ihm für seine Dienste ein Päckchen Zigaretten, Lebensmittelmarken oder einen Wintermantel anboten, lehnte er ab.
Joëlle erinnert sich an kein einziges Wort der Klage aus seinem Mund. Im Gegenteil, in dieser Zeit, an diesem Ort schien er zufriedener denn je. Er wusste nicht, wo er wohnen und wovon er leben sollte, aber er wusste, zu wem er gehörte. Er hatte eine Familie geschenkt bekommen. Unverdient, wie er fand, immer noch staunend, warum er den Platz eines anderen eingenommen hatte. Er war als Fremder in ihre Welt eingedrungen, und dennoch mochte er jetzt mit niemandem mehr tauschen.
Nachts, als der Lärm in den Baracken endlich verebbte, betrachtete er Yasmina, die mit Joëlle in ihrem Arm auf der Pritsche lag. Sie schlief, wie immer, leise aber unruhig. Wie um nicht aufzufallen, aber in Träumen gefangen. Unter den schwarzen Locken, die ihr übers Gesicht fielen, zuckten ihre Augenlider. Joëlle dagegen schlief entspannt, ausgebreitet trotz des wenigen Platzes, in der liebenden Umarmung ihrer Mutter. Maurice fragte sich, was Yasmina gerade sah. Sie war eine Frau, die auch mit offenen Augen träumte, sie schien selbst einem Traum entsprungen, einer schöneren, aber surrealen Welt, die Maurice bis heute nicht verstand.
Der Grund, warum er sich in sie verliebt hatte, war mehr als ihre rätselhafte Schönheit. Es war ihr wilder, zerbrechlicher Stolz und die Entschlossenheit, für ihr Kind zu kämpfen, gegen ihre Eltern, gegen die Nachbarn, gegen alles, was ihr einmal Schutz gegeben hatte. Um diesem kleinen Wesen, das nichts von dem Skandal wusste, in den es hinein geboren wurde, ihren Schutz zu geben. In kurzer Zeit war sie zur Frau geworden, hatte den Kopf aufrecht gehalten, als hinter ihrem Rücken alle über sie tuschelten, und unbeirrt einen Ring aus Liebe um ihr Kind gebaut. Das hatte Maurice so sehr berührt, dass er nichts anderes wollte, als für sie da zu sein.
Was ihm die Gewissheit gab, dass sein Platz an ihrer Seite war, war die Tatsache, dass nicht er, sondern das Schicksal diesen Ort für ihn gewählt hatte. Er hatte einfach nur den Widerstand aufgegeben und sich dem Strom des Lebens hingegeben, wodurch er zu einem anderen wurde. Was war sein Ich denn anderes gewesen als der Widerstand gegen die Umstände? Yasminas Familie in Tunis, die ihn vor den Alliierten versteckt hatte, ihre Hochzeit unter Fremden und die Fahrt übers Mittelmeer, all das hatte sein neues Ich geprägt. Ohne sie wäre er wahrscheinlich tot. Oder er wäre jetzt ein Deutscher namens Moritz Reincke, seit Entlassung aus der Wehrmacht wohnhaft in Berlin, verheiratet mit Fanny Reincke. Ein Haus, ein Garten, Kinder. All das, wovon er und seine Kameraden unter der fremden Sonne Nordafrikas geträumt hatten. Aber Maurice träumte nicht mehr. Er war hier, jetzt, und das war mehr, als er je zu träumen gewagt hatte. Die Zeit der Unsichtbarkeit war vorbei. Er stand im Licht. Alle Taubheit der Sinne war verschwunden. Er war da. Er wollte leben.
Was Maurice aber nicht wusste, während er seine Frau im Schlaf betrachtete, war, wen sie gleich nach der Ankunft in Camp 60 gesucht hatte. Heimlich, ohne ihm ein Wort zu sagen. Während alle von der Zukunft träumten, konnte Yasmina ihre Vergangenheit nicht vergessen. Und obwohl sie alles mit Maurice teilte, den Hunger und das Brot, waren ihre Träume, die guten und die schlechten, ein Reich, zu dem er keinen Zugang besaß. Manchmal zuckte ihr Körper wild im Schlaf, so dass er Angst hatte, sie würde aus dem Feldbett fallen. Er musste sich neben sie legen und sie mit aller Kraft festhalten, bis die Wellen langsam verebbten.
»Ich hasse das Meer«, sagte sie einmal beim Aufwachen. »Gut, dass man es von hier nicht sehen kann.«
»Warum, Mamma?«, fragte Joëlle. »Ich liebe das Meer!«
Auf der Schiffsreise war Yasmina meist unter Deck geblieben. Sie, die am Strand von Piccola Sicilia aufgewachsen war und nichts lieber getan hatte, als barfuß über den heißen Sand zu laufen, zusammen mit ihrem Bruder. Maurice wusste, warum sie das Meer nicht ertrug, aber er schwieg, nahm Joëlle auf den Arm und ging mit ihr nach draußen, um sie abzulenken.
Genau wie der britische Soldat im Hafen von Haifa vorausgesagt hatte, kam tatsächlich bald ein Mann ins Camp, der Maurice, so wie alle jungen Männer, heimlich ansprach. Offiziell war er Hebräischlehrer. Er trug kurze Hosen und ein kurzes Hemd, war muskulös und braungebrannt. Er nahm Maurice beiseite, als er am Wassertanker anstand. Er könnte ihn herausschmuggeln, raunte der Mann, wenn er sich der Hagana anschloss, der zionistischen Untergrundarmee. Er solle sich keine Sorgen machen, man würde für alles sorgen, Unterkunft, Essen und sogar einen kleinen Sold. Männer wie dich brauchen wir, sagte er, junge, entschlossene Männer! Du siehst anders aus als diese verlumpten Gestalten mit gebeugtem Rücken; die tragen zu viel Diaspora in sich, aber du bist kein Schwächling, das sieht man dir an, du bist einer von uns. Wir werden nie wieder Opfer sein, wir wissen uns zu verteidigen, wir bestimmen unser Schicksal selbst! Wir sind die neuen Juden, stark und frei, wir bringen die Wüste zum Blühen!
Am Abend, als die Polen jiddische Lieder sangen und Joëlle mit den anderen Kindern tanzte, berichtete Maurice Yasmina leise von der Begegnung am Wassertanker.
»Niemals«, sagte sie.
»Aber er bringt uns hier raus. Nicht nur mich. Er hat uns eine Wohnung versprochen, für alle drei. In einem Kibbuz.«
»Hast du vergessen, was du dir geschworen hast? Nie wieder Krieg, hast du gesagt. Und jetzt willst du ein Gewehr in die Hand nehmen?«
Tatsächlich, der Gedanke, noch einmal in eine Armee einzutreten, widerstrebte ihm zutiefst. Sicher, er sah die Notwendigkeit, sich zu verteidigen. Aber er verabscheute den blinden Gehorsam, die abgetötete Empfindsamkeit, die Erosion der zivilen Moral. Und dennoch war er bereit, noch einmal über seinen Schatten zu springen. Nicht für sich, nicht für einen Führer, sondern für die beiden Menschen, die ihm anvertraut worden waren.
»Ich werde nicht zulassen«, sagte Yasmina leise, aber eindringlich, »dass Joëlle noch einmal ihren Vater verliert. Ich habe Lust, zu leben, Maurice! Ich will die Welt sehen, neue Kleider ausprobieren und neue Gesichter. Ich will nicht mehr brav sein müssen und keine traurige Witwe sein, ich will endlich frei sein! Mit dir!«
Maurice schwieg. Sie nahm seine Hand.
»Bist du nicht dankbar«, fragte sie, »noch am Leben zu sein?«
Tatsächlich empfand er jede Minute mit ihr als ein Geschenk. Dass er den Krieg überlebt hatte, war keinem Zufall zu verdanken, sondern einer Entscheidung. Hätten ihm die Sarfatis damals nicht ihre Tür geöffnet, ihm das rettende Seil zugeworfen, wäre er weiter im Strom des Krieges getrieben, bis der nächste Strudel ihn erfasst hätte. Yasminas Eltern hatte er alles zu verdanken; ohne sie gäbe es jetzt keine Sonne, weil er sie nicht sähe, und keinen Wind, weil er ihn nicht spürte. Die ganze kaputte Welt, ein unfassbares Glück.
»Aber dieses Land wird uns nicht geschenkt, Yasmina. Wir sind nicht willkommen in Palästina.«