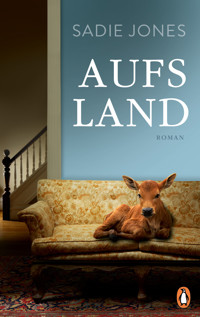14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Luke Kanowski beschließt, Provinz und Elternhaus den Rücken zu kehren, um in London seine Lorbeeren als Dramatiker zu verdienen. Mit Paul, einem angehenden Produzenten, und Leigh, Pauls Freundin, gründet er eine Theaterkompagnie, die bald erste Erfolge feiert. Die drei sind unzertrennlich – bis Luke auf Nina trifft, eine temperamentvolle, aber labile Schauspielerin, die ihn nicht mehr loslässt.
Alles, worum er gekämpft hat – Loyalität, Freundschaft, Karriere –, droht dem Versuch zum Opfer zu fallen, Ninas versehrte Seele zu retten. Wie viel ist er bereit, für sie zu riskieren?
Ein überaus romantischer, eleganter Roman über vier junge Menschen, die um ihren Platz in der Liebe und im Leben kämpfen und dabei immer wieder von den Prägungen ihrer Kindheit eingeholt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
SADIE JONES
Jahre wie diese
ROMAN
Aus dem Englischen von Brigitte Walitzek
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originaltitel: Fallout
Originalverlag: Chatto & Windus, London
Copyright © 2014 by Sadie Jones Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Gestaltung und Satz: DVA/Brigitte Müller
ISBN 978-3-641-12434-2V003
EJ und JJ in Liebe gewidmet
Später – New York – 1975
New York war nicht seine Stadt, und das hier war nicht sein Leben. Er kaufte Ansichtskarten und schrieb sie an die Menschen, die ihm nahestanden, schickte sie aber nicht ab. Nachts träumte er vom Schmerz der Menschenliebe, und jedes fremde Gesicht, das er sah, erinnerte ihn an zu Hause. Der Titel seines Stücks und der Name, der nicht sein wirklicher Name war, und dazu andere Namen auf den dicht an dicht gedrängten Anzeigetafeln der anderen Theater in der Straße blinkten über den lichterbekränzten Vorbauten. Es war wie in jedem nur vorstellbaren Film über den Broadway, auf den Boden der ärmlichen Realität heruntergebrochen durch die herumwehenden Papier- und Plastikfetzen, durch den grauen Nachmittag, der keine nostalgischen Gefühle zuließ, sondern sagte: So fühlt es sich an. Nicht so, sondern so.
Da er bei den Proben nicht gebraucht wurde, wanderte er durch die Straßen, die ihm inzwischen vertraut waren, und dann weiter hinein in das unbekannte Labyrinth dahinter. Später ging er zurück in sein Hotelapartment, sah auf die Stadt hinaus und dachte an sie. Er glaubte nicht, dass sie kommen würde.
Damals – England – 1961
Lucasz Kanowski befreite seine Mutter auf denkbar unspektakuläre Weise aus der Anstalt: Sie gingen einfach durch das Tor auf der Rückseite des Geländes. Das Vorhängeschloss knackte er mit einem Stück Draht, ein Trick, den er ungeachtet der Kultivierungsbemühungen des Gymnasiums nicht verlernt hatte. In seiner Schultasche hatte er ein paar Anziehsachen für sie mitgebracht: einen Wollschal – trotz seiner absurden Angst, sie könne sich damit aufhängen – und eine Strickjacke mit Gänseblümchen am Kragen. Außerdem ein Paar Gummistiefel. Eigentlich hatte er ihr richtige Schuhe mitbringen wollen, elegante Pumps, aber er hatte keine finden können. Natürlich war es möglich, dass sein Vater sie weggeworfen hatte, aber das erschien Luke als ein viel zu entschiedener Schritt für den langsamen, introvertierten Mann. Gummistiefel mussten reichen. Das Anstaltsgelände war weitläufig. Niemand würde sie sehen, und vermissen würde sie auch erst mal keiner.
Er zog das eiserne Tor auf, drückte das hohe Gras zu Boden.
»Allez-y«, sagte er, und sie hob das Kinn und setzte sich unsicher in Bewegung.
Nebeneinander standen sie an der Straße. Finken hüpften und flatterten in der Hecke. Lukes Mutter rührte sich nicht, sie hatte die Arme um den Oberkörper geschlungen und wirkte klein in ihrer Strickjacke.
»Der Bus kommt gleich«, sagte er, als sei alles ganz normal, aber seine dreizehnjährige Stimme kippte. Nichts war normal.
»Maman? Lass uns gehen.«
In ihren Augen sah er den Abgrund. Die Leute mieden Verrückte, angeblich weil sie so unberechenbar waren, aber Luke wusste, dass sie in Wahrheit die Leere in ihrem Blick fürchteten. Luke hatte keine Angst vor dieser Leere; schließlich war sie es, die dort leben musste. Er hätte alles getan, um sie zu retten, und betete immer noch für sie, obwohl seine Argumente gegen die Existenz Gottes neuerdings lauter wurden. Er betete und konnte nicht aufhören zu glauben, dass sie, wenn er irgendetwas richtig machte – absolut richtig –, vielleicht wieder gesund würde.
»Maman? On y va?«
Sie sah ihn lächelnd an. Ihre Haut hatte einen rosigen Schimmer, wie von Sonnenlicht überhaucht, als habe das Blut angefangen, durch ihre Adern zu pulsieren, und Luke fühlte sich als Retter. Sie überquerten die Straße zur Bushaltestelle. Als der Bus kam, stiegen sie ein und ließen sich schweigend von ihm davontragen.
Drei Tage zuvor hatten sie auf morschen Stühlen auf dem ungepflegten, von Löwenzahn durchsetzten Rasen der Sestoner Irrenanstalt gesessen, hinter ihnen das Gewirr der Regenrohre, die an den Mauern hinunterkrochen, über ihnen die dicht gedrängten Schornsteine auf den viktorianischen Giebeldächern. Helene hatte ihm einen ihrer selbstsichersten Blicke zugeworfen und gesagt: »In der Times steht, dass es in der Nationalgalerie in London eine Ausstellung französischer Maler gibt. Cézanne. Renoir. J’aimerais te le montrer, Luc.«
Lukes erster Gedanke war, dass es, wenn man von einem akzeptablen Leben sprechen wollte, ja wohl das Mindeste war, sich Bilder ansehen zu können, wenn man wollte; Bücher zu lesen, Musik zu hören. Sogar sein Vater hörte Musik. Später, als sie sich verabschiedeten und sie sich von ihm abwandte, um in den Aufenthaltsraum zurückzugehen und zu tun, was immer sie tat, wenn er nicht da war, sagte er leise: »Sollen wir vielleicht nach Lincoln fahren? Und uns in einer Galerie Bilder ansehen?«
Aber seine Mutter war gebürtige Pariserin. Und ein Snob.
»Lincoln? Lincoln ist so provinziell.« Sie beugte sich vor und flüsterte ihm ins Ohr. »Londres.«
»Londres?« Luke konnte nicht anders, er musste lachen. Ausgetrickst von einer Frau, und dazu noch von einer Geisteskranken.
»Pst!!«
Ihre Haare waren absurd zerzaust, und an den Schläfen waren noch die Brandmale der Elektroschocks zu sehen. Im klaffenden Frotteebademantel und in Pantoffeln stand sie auf dem Linoleumboden vor ihrer Station mit dem schönen Namen »Rose«. Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte trugen Schuhe, in denen man auch nach draußen gehen konnte, Schuhe, die auf dem Linoleum klapperten oder klatschten. Die Füße der Patienten dagegen waren praktisch lautlos, sie definierten sich durch weich-schlurfende Pantoffelschritte. Ihre Stimmen mochten laut sein – manchmal sehr laut –, aber sie waren nicht geerdet und ihre Schritte dementsprechend nicht zu hören.
»En train ce n’est pas très loin.«
Sie hatte recht, mit dem Zug war es wirklich nicht weit.
Die Schwestern am Empfangspult hoben nicht einmal den Kopf, als er die Anstalt durch den Drahtkäfig am Eingang verließ. Er besuchte seine Mutter, seit er fünf Jahre alt war, kam und ging, wie es ihm passte. Die Tür schlug hinter ihm zu, die Schlösser rasteten ein.
Als er sich in der Bibliothek die Fahrpläne für die Flucht seiner Mutter besorgt hatte, hatte er das Gewicht der Risiken gespürt, die auf ihm lasteten. Er stellte Pläne zusammen, Listen – Anstalt verlassen: 10.00. Zug nach London 11.07.
Für den Notfall galt: Falls Polizei – lügen.
Er wusste, dass seine Mutter selbst die größte Gefahr war. Fern der Anstalt und ohne ihre Medikamente war sie anfällig für tausend Entsetzlichkeiten. Als der Tag immer näher kam, wagte er nicht mehr, sie an ihr Vorhaben zu erinnern, damit sie sich nicht bei einer der Schwestern verplappern konnte. Es war allein sein Plan, sein furchtbares Geheimnis, aber er fand, wenn einem die Gnade geistiger Gesundheit gegeben war, dann waren Selbstzweifel feige, und so groß seine Angst vor einer Katastrophe auch war, seine Entschlossenheit stellte sich ihr resolut entgegen.
Sie verließen den Bahnhof King’s Cross und traten hinaus in die dünne, rußige Luft. Vor der Unermesslichkeit des Bahnhofsgebäudes aus Backstein und Beton kamen sie sich winzig vor; sie in ihren Gummistiefeln, die Strickjacke um sich gewickelt wie eine Zigeunerin, und er mit seinen selbst geschnittenen Haaren, auf einen Schlag demütig gemacht von ihrer Umgebung. Mutter und Sohn hielten sich so fest bei der Hand, dass sie ihre Knochen spürten. Menschen wimmelten um sie herum, im Vorbeigehen rempelte ein Mann Helene an. Sie zuckte mit einem durch geschlossene Lippen gemurmelten Laut zurück. Luke kannte das Geräusch, erkannte die Gefahr.
»Je n’ai jamais été ici.« Sie formte die Worte wie mit fremden Lippen. »Tu comprends?«
Auch Luke war noch nie in London gewesen, aber er sagte nichts.
»Also wirklich!«, hörten sie eine Frau ganz in ihrer Nähe rufen. »Taxi!« Seine Mutter duckte sich, als wolle sie dem Hieb eines Monsters ausweichen. Plötzlich waren ihre Augen voller Panik. Ein weiterer gemurmelter Laut, ein kehliges ga, als sie die Schultern hochzog und sich zusammenkrümmte, und er erkannte, dass sie ihm keine Hilfe sein würde, nicht im Augenblick. Der Tag, der vor ihnen lag, war riesig und zügellos. Er beschloss, sie sich als ein Tier im Zoo vorzustellen, nicht weniger als ein Mensch, einfach nur anders: eine seltene, unberechenbare Kreatur; er war der Experte, bewaffnet mit Beruhigungspfeilen. Es beschämte ihn, dass er sich wünschte, die Beruhigungspfeile wären echt.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte er. »Ich habe alle Informationen, die wir brauchen.« Er zog den Busfahrplan aus seiner Tasche.
Im Bus verkroch sie sich in sich selbst, und auf der Strand wären sie um ein Haar von einem Taxi angefahren worden. Einmal fing sie an, mit jemandem zu reden, den Luke nicht sehen konnte, und er nahm ihre Hand und erzählte ihr, was er gestern zu Abend gegessen hatte. Danach – sein Fehler – gingen sie in der falschen Richtung durch die Whitehall, aber da hatte sie sich schon wieder beruhigt und sah sich interessiert und glücklich um, als sie zurückgehen mussten.
Der Trafalgar Square lag weit und unbewegt vor ihnen, Nelsons Säule ragte in der Mitte auf wie ein Maskottchen.
Im Inneren der Nationalgalerie kehrte eine exotische Art von Normalität ein. Eine halbe Stunde oder sogar länger schlenderten sie umher, sahen sich die Bilder an und waren glücklich. Er genoss das Privileg ihres ungetrübten Verstands; ihre Sinne hellwach, ihr Geist klar. Er war alt genug, um zu wissen, dass es gefährlich war, sich vorzustellen, dass Gott Menschen auf ihrem Weg durch die unstrukturierte Welt bestrafte oder belohnte. Trotzdem hatte er das Gefühl, dieses eine Mal sei das ungerechte Chaos des so furchtbar zusammengestutzten Lebens seiner Mutter von Gott bemerkt worden, und er habe sich gütig gezeigt.
»Mach die Augen zu«, sagte sie, als sie, umgeben von Cézannes und Monets, fast allein in einem riesigen Raum standen. »Kannst du die Bilder fühlen?«
Luke schloss die Augen.
»Oder würde sich die Luft genauso anfühlen, wenn die Wände leer wären?«
Mit geschlossenen Augen erspürte Luke das Leben der Kunstwerke um sich herum. Es veränderte die Atmosphäre. Er dachte an Genialität, verdichtet durch die Zeit, und an das unmessbare Charisma des Ruhms. Er wusste nicht, wie er das alles in Worte fassen sollte, wusste nur, dass diese Gemälde zu atmen schienen.
»Es ist, als wäre man in einem Zimmer voller Menschen«, sagte er und machte die Augen wieder auf.
Sie standen da, umgeben von den stillen, goldgerahmten Gemälden. Sonnenlicht auf Wasser. Blumen. Leuchtende Felsen irgendwo im Süden.
Seine Mutter zuckte mit den Schultern. »Vielleicht bildest du dir das nur ein, weil du nicht glauben willst, dass das alles hier vergeblich ist«, sagte sie.
Er war verlegen, fühlte sich ertappt, aber als sie weitergingen, warf sie ihm einen Blick zu und lächelte, und da wusste er, dass es nicht vergeblich war. Um sie herum war Größe, und das wussten sie und wurden davon emporgehoben. Als sie den Raum verließen, sah er über die Schulter zurück und bedankte sich im Geist bei den Bildern. Seine Mutter nahm seinen Arm.
Zur gleichen Zeit sah die elfjährige Nina Hollings zu den beiden gemalten Frauen auf, die ihren Blick mit einem frohen Lächeln erwiderten, das von Geld sprach. Ehrfürchtig betrachtete sie die ineinander verschränkten Arme der Schwestern und ihre Gewänder aus Samt und Seide und spürte, was sie selbst im Gegensatz zu ihnen war: unvollendet durch Liebe oder Schönheit.
Hinter ihr die Stimme ihrer Mutter, klar und kühl: »Nur Männer können Frauen malen.« Ihre Hände legten sich leicht auf Ninas Schultern. »Nur Männer sind wirklich gute Coiffeure, und nur Männer können Kleider zuschneiden.«
»Wieso?« Nina konnte die Augen nicht von Singer Sargents Bild lösen, den schmalen Taillen der Schwestern unter ihren Ballkleidern, dem taufeuchten Leben, das aus ihren Augen schimmerte. »Wieso nur Männer?«
»Weil Männer Frauen begehren und sie erschaffen können – und das gilt selbst dann, wenn sie homosexuell sind. Frauen haben nicht die leiseste Ahnung. Außerdem sind die oft einfach neidisch und wollen, dass man gewöhnlich aussieht.«
»Gibt es denn gar keine Frauen, die Kunst machen?«, fragte Nina.
»Doch, die gibt es, aber denen geht es meist um Hässlichkeit. Und was die couture angeht …« Marianne schnaubte abfällig, fischte ein Paar grüne Lederhandschuhe aus ihrer Tasche und fing an, sie überzustreifen. Da sie nicht weglaufen konnte, während sie mit ihren Handschuhen beschäftigt war, verlagerte Nina ihr Gewicht auf ein Bein und ließ den anderen Fuß kreisen. Dabei sah sie sich im Raum um, musterte die älteren Damen in ihren Tweedkostümen, die, jeweils zu zweit, leise miteinander redeten, und ein Studentenpärchen, das sich küsste. Die junge Frau trug einen schlabberigen Rock und flache Schuhe, der Mann hatte die Arme um ihren Körper geschlungen.
Nach einem Moment des Überlegens sagte Nina: »Und was ist mit Coco Chanel?«
Marianne klopfte die Handschuhe in die Lücken zwischen ihren Fingern. »Die ist eine grauenhafte couturière. Alle guten Zuschneider, die sie hat, sind Männer«, sagte sie. »Komm jetzt.«
Sie griff sich die Hand ihrer Tochter und zog sie weiter. Im Vorbeigehen starrte Nina das eng umschlungene Studentenpärchen an. Die Frau, die den Kopf an die Schulter ihres Freunds geschmiegt hatte, zwinkerte ihr mit mascaraschweren Wimpern zu.
Als sie die lange zentrale Galerie erreicht hatten und der Trafalgar Square durch die Türen zu sehen war, sagte Nina: »Guck mal! Eine Sonderausstellung über französische Malerei.«
»Vielleicht nächstes Mal.«
»Dann wenigstens noch einen Raum?«
»Aber nur einen«, seufzte Marianne, als sei jede zusätzliche Minute mit ihrer Tochter eine große Last.
Vor Uccellos St. Georg und der Drache blieb Nina stehen und betrachtete die darauf abgebildete junge Frau mit dem langen Hals und den heiligen Georg in seiner Rüstung, der dem Drachen die Lanze ins Auge stieß. »Es steht nirgends, wer die Prinzessin ist«, sagte sie. »Und sie sieht nicht sehr ängstlich aus, findest du nicht?«
Marianne sah auf ihre Uhr. »Sie wird schließlich gerettet«, sagte sie.
Und damit hatte es sich. Sie verließen das Museum unter einem weißen Himmel und überquerten die Straße, um Tante Mat bei den Löwen zu treffen.
Ein paar Kinder mit Dosen voller Vogelfutter warfen den Tauben Körner hin; die Tiere segelten im Tiefflug durch die Luft oder pickten sich auf dem Boden gegenseitig aus dem Weg. Ein kleines Mädchen hatte die Arme ausgebreitet, und zahlreiche Tauben hatten sich darauf niedergelassen. Die Kleine lachte so, dass ihre Nase blubberte. Futterkörner rieselten aus den Falten ihres Mantels. Neidisch beobachtete Nina, wie der Vater des Mädchens sich hinkniete, um ein Foto zu schießen.
»Widerlich«, sagte Marianne und zog sie weiter.
Tante Mat wartete unerschütterlich am Fuß der Säule, eine gigantische schwarze Löwenpfote hinter dem Kopf, über dem Arm eine Einkaufstasche und ihre Handtasche, deren Krokodiltiefen Sahnebonbons und Players No. 6 enthielten. Sie winkte ihnen fröhlich zu. »Da seid ihr ja«, rief sie. »Habt ihr euch amüsiert?«
Nina senkte den Blick auf Tante Mats zweckmäßige Schuhe.
»Hallo, Matilda«, grüßte ihre Mutter, ein Bein vorgestreckt wie ein Vollblutpferd. Sie trug ein moosgrünes Kostüm mit Gürtel, das sich wie ein Edelstein vom Grau der Umgebung abhob.
»Marianne«, erwiderte Tante Mat kühl und lächelte auf Nina herab, wobei sich ihre pudrig weichen Wangen fältelten.
Nina konnte das Lächeln nicht erwidern und blickte starr geradeaus, denn wenn sie lächelte, verzerrte sich ihr Gesicht wie das eines Äffchens, genauso wie bei Tante Mat. Das Gesicht ihrer Mutter geriet nie durcheinander; Nina hatte vor dem Spiegel erfolglos probiert, es ihr nachzumachen. Sie glaubte nicht, dass sie einmal eine Schönheit werden würde.
»Ich muss zu einem Termin«, sagte Marianne.
»Hast du Arbeit in Aussicht?«, erkundigte sich Tante Mat.
»Ach, du weißt ja. Es ist alles furchtbar mühsam.«
»Letzte Woche hast du gesagt, du hättest viel zu tun. Irgendwelche Vorsprechtermine?«
»Ich habe auch viel zu tun!«
»Mummy, bitte!« Ninas Stimme klang winzig. Ihre Hand kroch gegen ihren Willen in die ihrer Mutter zurück.
»Nina …« Marianne ging so tief in die Knie, wie ihr Rock es zuließ, und sah ihrer Tochter in die Augen. »Liebling, sei jetzt bitte tapfer. Es macht Mummy so traurig, wenn du weinst.«
Neben ihnen eine abrupte Bewegung. Tante Mat bohrte ihre flachen Absätze ins Pflaster.
»Ich bete dich an«, flüsterte Marianne ihrer Tochter zu. »Wenn ich nicht bei dir bin, tut mir das Herz weh.«
Nina spürte, wie ihre eigene Brust sich zusammenkrampfte, als würde ein Gürtel darum festgezogen.
»Sag jetzt Auf Wiedersehen, Liebling. Gib Mummy einen Kuss.«
Das letzte Mal hatte Nina gebettelt, sich an ihrer Mutter festgeklammert und ihre Sachen zerknittert. Sie hatte sich in aller Öffentlichkeit unmöglich aufgeführt. Ihre Hemmungslosigkeit hatte etwas Ekstatisches gehabt; keine Kontrolle zu haben, nur noch ein klägliches Häufchen Elend zu sein … Ein Teil von ihr hatte geglaubt, ihre Mutter dadurch an sich binden zu können, aber stattdessen hatte es sie von ihr fortgetrieben. Wer wollte schon jemanden um sich haben, der sich derart unmöglich aufführte? Sie war entschlossen, dieses Mal nicht zu weinen.
»Wiedersehen, mein Liebling«, sagte ihre Mutter mit vor Tränen schimmernden Augen. Nina umklammerte ihre Hand und ließ nicht los.
»Um Himmels willen, Marianne!«, sagte Tante Mat. »Hör auf damit!«
Aber Marianne achtete nicht auf sie. »Liebes«, sagte sie. »Lass mich los.«
Das war zu viel. Nina fing an zu weinen, stürzte sich in die Tränen hinein.
»Liebling«, sagte ihre Mutter. »Ich muss wirklich gehen.«
»Wieso?«, schluchzte Nina und heulte Rotz und Wasser.
»Bitte, Liebling …«
»Geh einfach!«, schimpfte Tante Mat.
»Wie kannst du das nur sagen? Meine Tochter weint!«, empörte sich Marianne.
Tante Mat war machtlos. Marianne würde erst gehen, wenn ihre Tochter sich zusammenriss, aber das brachte diese nicht zustande. Schließlich war es Hoffnungslosigkeit, nicht bewusster Wille, die Nina dazu bewegte, aufzugeben und loszulassen.
Marianne ging langsam weg, drehte sich aber alle paar Schritte um, um zu winken. Dann war sie verschwunden.
»Komm«, sagte Tante Mat energisch, griff nach Ninas Hand und stapfte los.
Nina versuchte, Schritt zu halten – stolperte –, Matilda blieb stehen. Aber sie kniete sich nicht hin, um ihre Nichte in die Arme zu nehmen.
»Es tut mir leid, Liebes«, sagte sie. »Es ist nicht deine Schuld.« Sie rückte die Taschen an ihrem Arm zurecht, eine für sie typische Geste.
»Hattet ihr es denn schön? Was hältst du von einer Tasse Tee und einem Stück Kuchen?«
Nina antwortete nicht. Tante Mat seufzte und gab für den Augenblick den mühevollen Versuch auf, Nina etwas bedeuten zu wollen. Niedergeschlagen betrachtete sie die Tauben und die sitzenden Löwen. Ein kalter Wind wirbelte den Schmutz rund um die Säulen auf. Ihr Blick kehrte zurück zum unglücklichen Gesicht ihrer Nichte.
»Möchtest du vielleicht die Tauben füttern?«
»Nein«, flüsterte Nina. »Sie sind widerlich.«
»Was hast du gesagt, Liebes?«
Nina wollte gerade antworten, als sie auf der Treppe des Museums vor ihnen eine Frau in Gummistiefeln bemerkte.
»Was macht die Dame da?«, fragte sie, von ihrem Kummer abgelenkt.
Tante Mat sah hin. »Sie setzt sich.«
»Wieso setzt sie sich auf die Treppe? Die ist doch schmutzig. Und wieso hat sie Gummistiefel an. Und was macht der Junge?«
»Er versucht anscheinend, sie zum Weitergehen zu überreden. Was wir übrigens auch tun sollten.«
»Weint sie?«
»Starr sie nicht so an.«
»Sie kann mich doch nicht sehen.«
»Es ist trotzdem unhöflich.«
»Wir sind ewig weit weg. Oh, da ist ein Polizist!«
Tante Mat blieb nichts anderes übrig, als auch hinzusehen. Ein uniformierter Mann redete eindringlich auf den schlaksigen Jungen ein, der mit abwehrend ausgestreckten Armen versuchte, die Frau vor ihm abzuschirmen.
»Das ist kein Polizist«, sagte Tante Mat. »Sondern ein Museumswächter.«
»Ein Museumswächter? Was bewacht er denn?«
»Die Bilder. Und er sorgt dafür, dass die Leute sich vernünftig benehmen.«
»Sie benimmt sich aber nicht vernünftig.«
Die Frau auf der Treppe zerrte an ihrer Strickjacke und wiegte sich vor und zurück, während der Junge und der Wächter miteinander debattierten. Tante Mat griff wieder nach Ninas Hand.
»Wahrscheinlich sind es Obdachlose. Lass uns reingehen und sehen, ob wir eine Tasse Tee auftreiben können.«
Sie gingen auf die Treppe zu, ganz am Rand, um nicht in die an Lautstärke zunehmende Szene zwischen dem Wächter, dem Jungen und der Frau mit den Gummistiefeln verwickelt zu werden. Passanten waren zu Schaulustigen geworden, die sich in eine verunsicherte Menschenmenge verwandelten, als die Frau anfing, Klagelaute von sich zu geben, einen Schwall von Geräuschen, durchsetzt von Worten und Halbsätzen.
»Es waren siebenhundert!«, rief sie. »Sept cents, voyez-vous? Nicht alle von ihnen haben noch gelebt. Sie sind kein Polizist …« Und sie zuckte zurück, als würde sie angegriffen.
»Wo wohnt ihr? Wie heißt ihr?«, fragte der Wächter, während der Junge von einem Fuß auf den anderen trat und verängstigt zwischen den beiden hin und her sah.
»Es ist alles in Ordnung«, wiederholte er immer wieder mit bleichem Gesicht. »Bitte – Sie machen alles nur noch schlimmer.«
»Komm mit, Nina«, drängte Tante Mat. »Das alles geht uns nichts an.« Und sie zog Nina durch die Tür.
Im Inneren des Museums gab es nur gedämpfte Echos, leise Stimmen und bei jedem Öffnen und Schließen das weiche Schleifen der hohen, schweren Türen über den Boden. Nina verdrehte den Kopf, um zu sehen, wie es draußen weiterging, aber die Frau und der seltsame Junge befanden sich inzwischen außerhalb ihres Blickfelds. Ihr Mund fühlte sich völlig ausgetrocknet an. Sie hatte Angst gehabt, an den beiden vorbeizugehen, war aber auch fasziniert gewesen.
Und da war noch etwas. Alle hatten die Frau angesehen – so aufgeregt, so blass. So zart im Vergleich zu dem schlaksigen Jungen, der entschlossen und beschützerisch über ihr aufragte, obwohl er eigentlich zu jung war, um sich um irgendjemanden zu kümmern. Nina erkannte, was sie empfand. Es war Neid.
Sie zupfte an Tante Mats Hand. »Sie war sehr hübsch, nicht wahr?«
»Ist mir nicht weiter aufgefallen. Könnte eine Französin gewesen sein.«
»Wie Mummy.«
»Wie deine Großmutter. Deine Mutter ist so englisch wie ich, jedenfalls fast.«
»Was wird denn jetzt aus ihr?«
»Ich nehme an, sie werden das arme Ding wegbringen«, sagte Tante Mat.
»Wohin?«
»Das braucht dich nicht zu interessieren.«
»Die arme Frau«, murmelte Nina.
Sie sah sie vor sich, mit weichen Seilen gefesselt, eine Jungfrau in Nöten, von Soldaten einer ungeahnten Rettung zugeführt. Es kam ihr wundervoll vor, so hilflos zu sein; hochgehoben zu werden, und gerettet.
Es war lange nach Mitternacht, als Tomasz Kanowski seinem Sohn und zwei Polizisten die Tür öffnete. Die trübe Glühbirne im Flur hatte einen orangefarbenen Stoffschirm mit Blumen darauf, und Tomasz stand als dunkle Masse im Eingang. Ein Geruch nach gedünsteten Zwiebeln, Zigarettenrauch und, ganz schwach, Bratfisch waberte aus dem Inneren des Hauses um ihn herum. Die Polizisten nahmen ihre Helme ab, als Zeichen dafür, dass es sich um eine Familienangelegenheit handelte.
»Mr Kanowski?«
»Ja«, antwortete er. »Komm rein, Lucasz.« Seine Stimme klang gepresst, der Akzent verstärkt durch den Alkohol, den er getrunken hatte, und die Gefühle, die in ihm kämpften.
Luke schob sich hinter seinen Vater und sah an dessen Schulter vorbei auf die beiden Konstabler mit den teigigen Gesichtern, die einen Blick tauschten. Tomasz starrte sie mit seltsam passiver, entschieden unenglischer Herausforderung an. Sie warteten darauf, dass er etwas sagte, aber er blieb stumm.
Als sie weg waren, schloss er langsam die Tür. Luke ließ den Kopf hängen, schwankend vor Müdigkeit und schwindlig vor Erleichterung, wieder sicher zu Hause zu sein, in ihrem soliden, stinkenden kleinen Gefängnis. Sein Vater legte ihm die Hand in den Nacken und zog ihn an seine mächtige Brust, bis Lukes Stirn das Hemd über seinem massigen Schlüsselbein berührte.
»Was du getan hast, war mutig und sehr dumm«, sagte Tomasz leise, während seine kräftigen Finger Lukes Schädel umfassten.
Luke nickte, überwältigt von Bedauern. Der Geruch seines Vaters, nach Bier und Schweiß, stieg ihm in die Nase.
»Sicher hast du deine Mutter furchtbar geängstigt.«
»Das ist mir egal«, stieß Luke durch zusammengebissene Zähne hervor. »Es hat ihr gefallen. Sie hat es gewollt, und sie war glücklich. Eine Zeit lang. Wieso besuchst du sie nie? Du solltest sie besuchen.«
Tomasz drückte den Kopf seines Sohns an seine Brust. »Lass das, Lukasz.«
Sie verharrten in der heftigen Umklammerung ihrer Umarmung, bis Tomasz nickte und Luke seinen heißen Atem im Nacken spürte, als er ausatmete. Langsam schob Tomasz seinen Sohn von sich und umfasste sein Gesicht mit beiden Händen. Wenn die Augen von Lukes Mutter ein Abgrund waren, so drohten die seines Vaters, kompliziert und nass, vor Tränen überzuquellen. Er küsste Luke hart auf die Stirn und ließ ihn los.
»Geh jetzt schlafen«, sagte er.
Luke saß auf seinem Bett, genoss den Luxus des Alleinseins und ließ den Abend noch einmal an seinem inneren Auge vorüberziehen; die Aufeinanderfolge der Fahrzeuge, die ihn und seine Mutter über unbekannte dunkle Straßen zurückgebracht hatten; die Polizeibeamten, die ihn befragt hatten, erst misstrauisch, dann verständnisvoll, dann mitleidig, als nicht nur sein kleines Verbrechen ans Licht kam, sondern auch die Tatsache, dass seine Mutter zeit seines Lebens nirgends anders gewesen war als in einer Anstalt. Nirgends anders, bis heute, dachte Luke. Er drückte die Handballen auf die Augen in dem Versuch, den Gedanken an den unmenschlichen Kraftaufwand zu verdrängen, der nötig gewesen war, um sie von ihm zu trennen, und den an seine eigene beschämende Erleichterung, als sie weg war.
Er legte sich hin – eher ein Aufgeben als eine Entscheidung – und starrte auf das Kruzifix aus dunklem Holz und golden schimmerndem Metall an der Wand gegenüber. Manchmal lachte er über die Vorstellung eines Gottes, ein andermal zitterte er vor Angst. Oft bekreuzigte oder verneigte er sich ganz automatisch, oder spürte, wie die Wut auf die blinde, patriarchalische Hand, die ihn zu Boden drückte, in seinem Inneren aufwallte wie Blut. Jetzt jedoch richtete er den Blick auf das billige Kruzifix, das an einem einzelnen Nagel hing, und betete. Er konnte die leisen Schritte seines Vaters hören. Seine Augen wanderten zur Decke. Die Schritte seines Vaters verklangen. Alles verschwamm.
»Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą…«
»Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes …«
Eine Staffel Hurricane-Jagdbomber flog lautlos über ihm dahin. Sein Vater, wie Luke ihn nie gekannt hatte, wie er aber, das wusste er, einst gewesen war, mit Schal und Stulpenhandschuhen, winkte ihm im Vorbeifliegen fröhlich zu – und Luke schlief ein.
Über seinem Kopf lächelte die Jungfrau Maria im puderblauen Gewand und mit unglaubwürdigen Lippenstiftlippen aus ihrem billigen Rahmen auf ihn herab.
1965
Als Luke Kanowski im September 1965 am Sestoner Gymnasium in Lincolnshire in die vorletzte Klasse kam, war Nina Hollings in London gerade von der Schule abgegangen.
»Ich möchte, dass Nina mit mir nach Paris kommt«, sagte Marianne am Telefon zu Tante Mat.
Ein Territorialkampf wurde ausgefochten. Tante Mat war ein sanfter Mensch, aber ihre Schwägerin brachte sie immer wieder in Rage. »Paris ist unpassend«, sagte sie und rückte den Läufer mit dem Zeh zurecht, während ihr Herz wie wild gegen all die Dinge anhämmerte, die sie nicht sagen durfte.
Mariannes Stimme vibrierte durch die Leitung wie eine zu straff gespannte Geigensaite. »Sie ist fünfzehn! Paris ist unpassend für was? Gib sie mir!«
Sie war zu ihrem Liebevolle-Mutter-Tonfall übergewechselt, dem, der Schatz, ich habe dich so vermisst sagte, wenn sie drei Monate lang nicht angerufen oder wieder einmal einen Geburtstag vergessen hatte oder – die Arme voller Geschenke – auftauchte. Tante Mat hatte keine derartige Trumpfkarte, die sie ausspielen konnte. Sie konnte sporadischen Glücksmomenten und verzehrender Sehnsucht nichts anderes entgegensetzen als Ovomaltine, feste Schlafenszeiten und den Trost eines guten Buchs. Egal wie viel Vernunft sie predigte, ein einziges Wort ihrer Mutter, und Nina führte sich absolut lächerlich auf.
»Ist gut«, sagte Tante Mat. »Ich hole sie.«
Ihre Nichte war oben und hörte ihre grauenhaften Schallplatten. Tante Mat rief sie ans Telefon und ließ sich wie eine böse Fee auf dem Wohnzimmersofa nieder, von wo aus sie durch die offene Tür beobachtete, wie Nina hingerissen mit ihrer Mutter flüsterte und dabei die Schnur des Telefons um die Finger wickelte. Der fette, orangefarbene Kater auf dem Fenstersims hinter Matilda schnurrte aggressiv, die Gardine über eins seiner ignoranten Ohren gestülpt.
»Wirklich, Mummy? Wirklich?«, gurrte ihre Nichte.
Tante Mat spürte, wie sich die vertraute, abstoßende Eifersucht mit Angst um Ninas Zukunft mischte. Paris mit Marianne – die Frau besaß keine Moral, kein Talent, kein Geld! Nina hängte den Hörer ein und wartete, die schmalen Schultern beredt.
»Wie geht es deiner Mutter?«, fragte Tante Mat mit ruhiger Stimme.
Nina drehte sich um; dick mit Kajal umrandete Augen, alle Stacheln triumphierend und schuldbewusst aufgestellt. »Wie es aussieht, fahre ich nächste Woche nach Paris«, sagte sie sehr von oben herab, ein fiebriger Abklatsch Mariannes, ohne die stählerne Härte, ohne das Ätzende.
»Verstehe. Und wie willst du nach Paris kommen?«, fragte Tante Mat gepresst.
»Mit dem Zug, nehme ich an.«
»Aber wieso denn bloß, um alles in der Welt?«, platzte es ganz untypisch aus Tante Mat heraus, und Nina schrie: »Weil meine Mutter es will!«, so leidenschaftlich, so voller selbstgerechter, theatralischer Dankbarkeit, dass Tante Mat in sich zusammensackte. Nina schob das Gesicht vor und machte ihre Augen in stummer Forderung ganz groß – das Weiß im Vergleich zu den mascaraverklebten Wimpern und den dunklen Pupillen so grell, dass es ein Theaterpublikum in die Sitze zurückgeworfen hätte.
»Spar dir die Theatralik, Liebes. Wenn Marianne dich mit nach Paris nehmen will, kann ich nicht das Geringste dagegen tun. Aber wenn alle Stricke reißen, weißt du ja, dass du hier immer ein Zuhause hast.«
»Da bin ich aber froh!« Nina warf den Kopf zurück, dass ihre Haare nur so flogen, ruinierte ihren Abgang jedoch dadurch, dass sie mit hochgezogenen Knien über die Telefonschnur hinwegsteigen musste.
Eine Hand auf dem Treppenpfosten, die ersten drei Stufen mit einem Satz nehmend, rannte sie in ihr Zimmer und knallte die Tür so heftig zu, dass Gipsstaub von der Decke herabrieselte. All das gehörte zu Tante Mats Leben mit Nina: das Wegrennen, das Türenknallen, der Plattenspieler. Be my, be my baby – my one and only baby – be my, be my baby now-ow-ow … Und Tante Mat flüsterte mit – be my, be my baby – und zog den hässlichen Kater auf ihren Schoß, wo er sich widerstrebend und zufrieden niederließ.
Nina konnte kaum glauben, wie einfach es war, wegzugehen. Sie packte einen Koffer, sagte Auf Wiedersehen und ging zu Fuß zur U-Bahn. Tante Mat hasste Szenen und machte kein großes Getue um ihren Abschied, was Nina verletzte, aber nicht überraschte. Sie hatte keine Ahnung, dass sich hinter Tante Mats Fürsorge Liebe versteckte, da sie selbst Liebe mit Sehnsucht gleichsetzte.
Die wenigen U-Bahn-Stationen ab Fulham Broadway fühlten sich an wie eine Ozeanreise, dann lag die Straße ihrer Mutter vor ihr. Sie schwang sich von der Cromwell Road weg und endete an einem mit staubigem Lorbeer bewachsenen umzäunten Platz. An den hohen weißen Häusern blätterte der Putz, Stromkabel waren lose an die Fassaden getackert, und in sämtlichen Fenstern hingen unterschiedliche Vorhänge. Nina ging schnell, überprüfte die Hausnummern und stand dann mit ihrem Koffer auf der obersten Stufe der Vortreppe. Ob ihre Mutter zur Feier des Tages einen Kuchen gekauft hatte? Tante Mat kaufte zum Tee oft Victoria Sponge Cake, einen mit Marmelade und Sahne gefüllten und mit grobkörnigem Zucker bestreuten Biskuitkuchen. Ninas Finger schwebte über der Klingel. Jacobs. Nicht Hollings, wie ihr Vater, sondern Jacobs. Sie drückte entschlossen auf den Klingelknopf und wartete.
Mariannes Wohnung lag im fünften Stock. »Absolut wundervoll für die Figur, aber das Treppenhaus müsste dringend mal renoviert werden.« Es war mit einem zerschlissenen Läufer ausgelegt und roch nach Vogelkäfigen, obwohl zahlreiche Schilder darauf hinwiesen, dass Haustiere strengstens verboten waren. »Keine Ahnung, wer sie sein könnten, diese armen Dinger mit ihren Haustieren, am besten denkt man gar nicht darüber nach.« Die Wohnungen im obersten Stock waren klein und asymmetrisch geschnitten, die Ecken ausgefüllt von verkleideten Leitungsrohren, die zumindest ein bisschen willkommene Wärme ausstrahlten.
Nina legte ihre Zahnbürste auf das Waschbecken im Schlafzimmer und packte ihre Sachen, auch Shampoo und Haarbürste, in die unterste Schrankschublade. Marianne hatte drei Kleiderbügel aus Draht frei geräumt, und Nina hängte ihre Blusen und Röcke übereinander, während ihre Mutter rauchend zusah.
»Übrigens werden wir wohl doch nicht nach Paris gehen«, sagte sie.
»Oh!« Ihren Schlafanzug in der Hand – er roch nach Zuhause –, drehte Nina sich um. »Wieso nicht?«
Der Blick ihrer Mutter huschte unruhig hin und her. »Ich habe eine Rolle angeboten bekommen. Ist das nicht wundervoll?«
»Absolut wundervoll. In welchem Stück?«
»Ach, nichts Besonderes. Eigentlich tue ich nur dem Regisseur einen Gefallen.« Marianne schlüpfte aus ihren hochhackigen Schuhen und ging auf Strümpfen in die Küchenecke, wo ein Miniherd auf einer gefliesten Platte stand, drückte ihre Zigarette aus und füllte den Kessel. »Wie lange willst du eigentlich bleiben?«
Bleiben?
»Ich – ich weiß nicht.«
Unwirsch knallte Marianne den Kessel auf die Herdplatte, drehte sich dann aber lächelnd um. »Matilda war bestimmt außer sich«, sagte sie. »War sie?«
Tante Mat hatte Nina beim Packen geholfen, hatte ihr gezeigt, wie sie die Blusen falten musste, und ihr sogar Seidenpapier zum Dazwischenlegen angeboten, aber Nina war entschlossen, es ihrer Mutter in jeder Hinsicht recht zu machen. »Man hätte meinen können, ich will mit einem Zirkus durchbrennen.«
Marianne lächelte und musterte die zierliche Gestalt ihrer Tochter. »Mein Gott, Nina, du siehst furchtbar aus«, sagte sie. Es war wie ein beiläufiger Tritt in den Magen. Dann ging sie zum Sofa und setzte sich. »Hier …« Sie klopfte neben sich auf die Sitzfläche.
Nina nahm Platz und legte den Schlafanzug auf ihren Schoß.
»Liebling, ist es dir wirklich ernst mit der Schauspielschule?«
Nina war in Gedanken noch bei der Wohnung in Paris, die sich gerade in Luft auflöste.
»Nina?«
Sie hatten schon oft über die Schauspielschule gesprochen. Nina hatte Fotos von Filmstars an ihren Wänden hängen, aber abgesehen von dem gelegentlichen Kitzel, ihre Mutter in einem Stück zu sehen, hatte ihr Leben nur aus Tante Mats Wohnzimmer, Schuluniformen, Spiegeleiern und Kinobesuchen am Samstagnachmittag bestanden.
»Hast du irgendeine Vorstellung, was das kosten würde? Sieh mich mal an.«
In ihrem Alter machte es Nina verlegen, jemandem ins Gesicht zu sehen.
»Du hast etwas von Natalie Wood – etwas Unverdorbenes. Wir sind zu dunkel, um das Mädchen von nebenan spielen zu können, das liegt an unserer französischen Herkunft.« Mariannes Augen blitzten zornig auf. »Dieses lächerliche Stück. Sie wollen, dass ich eine Mutter spiele! Keine junge Frau mit einem Baby, sondern eine Mutter! Ich trete auf. Ich bin über irgendetwas schockiert. Ich schenke den Tee ein. Ich gehe ab. Wahrscheinlich soll ich dabei auch noch eine Schürze tragen.«
Nina wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Schau nicht so trübselig drein.« Marianne war wieder gut gelaunt. »Man muss der Realität ins Gesicht sehen.«
Da Marianne nach Ansicht von Tante Mat der Realität nie ins Gesicht sah, fand Nina es beruhigend, dass sie es jetzt doch einmal tat.
»Und die Realität ist, Liebling, dass du alle Chancen hast, die mir genommen wurden, als ich –« Sie unterbrach sich. »Ach was, du bist inzwischen alt genug, die Wahrheit zu vertragen: als ich schwanger wurde.«
»Oh, du warst schwanger? Wann denn?«
»Nina! Bist du wirklich so schwer von Begriff? Mit dir natürlich!«
Ninas Gedanken rasten, um Schritt zu halten.
»Diese dummen Puten von der Schauspielschule haben allesamt Regisseure geheiratet«, fuhr Marianne fort, ohne auf Nina zu achten. »Oder Chefdramaturgen. Über die Hälfte von denen war homosexuell, von daher war das wohl eher kein reines Vergnügen, aber jetzt kann ich es ja zugeben, Liebling. Dass ich deinem Vater begegnet bin, war eine absolute Katastrophe. Aber er war nun einmal so romantisch. Und er ist immer so schnell gefahren! Mein Engel …« Sie ergriff Ninas kalte Hände und hielt sie fest. Nina sah sie voller Liebe an. »Siehst du bitte nach dem Kessel? Er pfeift nicht, und das Wasser verkocht sonst.«
Das Stück kam und ging, kein neues folgte. Marianne probte mit ihrer Tochter Monologe für Vorsprechtermine, die sie noch nicht ausgemacht hatten, und jammerte darüber, dass sie kein Geld hatten. Sie erzählte Nina, was sie war, was sie nicht war, was sie sein könnte, wenn sie nur das Geld hätten, und so wie immer gab Nina sich alle Mühe, die Anerkennung ihrer Mutter zu gewinnen. »Wir werden nicht ewig hier wohnen, das hier ist nur ein Provisorium«, sagte Marianne, und Nina stimmte ihr zu, machte sich klein und tat ihr Bestes, ihrer Mutter zu gefallen. Denn wenn es ihr nicht gelang, Marianne zu beeindrucken, verlor diese die Beherrschung. Nun mach endlich, du bist doch kein kleines Kind mehr! – Hast du immer noch nicht gelernt, wie man sich am Telefon ausdrückt? – Geh in das Geschäft da. – Besorg uns ein Taxi. – Kannst du mal versuchen, beim Rauchen nicht wie ein Hausmädchen auszusehen?
Und dann: Du bist, was ich hätte sein können. Liebevoll, während sie Ninas Haare zurechtstrich.
Spätabends, bei kleinen, billigen Brandys, gestand sie unter Tränen, wie sehr es sie geschmerzt hatte, ihre winzige Tochter der Obhut ihrer Schwägerin zu überlassen, und dass sich jeder Tag ohne sie angefühlt hatte, als würde ihr das Herz brechen. Sie verzieh Nina die Vergangenheit, und Nina nahm dankbar das Joch der Zukunft auf sich.
Alle paar Wochen besuchte Nina Tante Mat zum Tee und kam sich jedes Mal vor wie ein Kuckuck, der versucht, in sein geborgtes Nest zurückzukehren – nicht gerade unwillkommen, aber doch mit Missbilligung beäugt.
»Immer noch nicht in Paris?«, fragte Tante Mat, und Nina fühlte sich angegriffen – bis sie eines Nachmittags erkannte, dass hinter der Frage Angst steckte, nicht Kritik. Tante Mat wollte nicht, dass sie wegging.
Als sie sich zum Abschied auf der Treppe umarmten, hatte Nina zum ersten Mal wirklich das Gefühl, von ihr fortzugehen. Sie klammerte sich einen Moment an sie, aber Tante Mat vergoss keine einzige Träne.
Zu Hause lag Marianne mit einem Eisbeutel auf der Stirn auf dem Sofa. Nina wollte schon auf Zehenspitzen in ihr Zimmer schleichen, blieb dann aber stehen.
»Mummy?«, sagte sie im Nähergehen.
»Was ist?«, fragte Marianne mit geschlossenen Augen.
»Mummy –« Nina setzte sich. »Ich glaube, Tante Mat würde für die Schauspielschule und … und so weiter … bezahlen, wenn es bedeutet, dass wir in London bleiben.«
Sie wartete auf die Wirkung ihrer Worte.
Marianne hob den Kopf, nahm den Eisbeutel von der Stirn und drehte ihren langen Hals, bis ihre Augen auf ihrer Tochter ruhten.
»Aha«, machte sie. »Glaubst du?«
Und damit stand fest, dass Nina, für die jede Zurschaustellung eine Qual war, sich ebendiese zum Beruf machen würde.
Luke Kanowski pendelte zwischen Schule, Anstalt und zu Hause hin und her und vermochte den Kopf nicht weit genug zu heben, um in die Zukunft zu schauen. Unter den kummervollen, stumm billigenden Blicken Christi und der Jungfrau Maria machte er seine Hausaufgaben und trainierte außerdem für den Querfeldeinlauf rund um das Anstaltsgelände. Irrenslalom, sagten seine Mutter und er dazu.
Anders als die schier gigantische Anstalt war das Sestoner Gymnasium eine Nummer zu klein geraten, wie ein zu enges Paar Schuhe. Die muffigen Klassenzimmer waren überfüllt, die Aula, schimmlig und trostlos, fungierte auch als Turnhalle. Das Gymnasium war besser als das kleine Internat ein paar Meilen weiter, wurde von diesem aber trotzdem mit snobistischer Herablassung behandelt, und die Haare der Gymnasiasten waren ordentlicher als die der Internatsschüler, die auf derartige Belanglosigkeiten keinen Wert legten. Alle aber kannten nur ein Ziel: die Universität. Die Sestoner Jugend wollte weg. Nach Oxford. Nach Cambridge. Nach London. An dem Tag im September, an dem der Direktor des Gymnasiums die frisch gebackenen Abschlussklässler in einer Rede zu motivieren versuchte, hohe Ziele ins Auge zu fassen, gingen Lukes Klassenkameraden in das neu eröffnete Café in der Stadt, um über ihre ehrgeizigen Pläne zu reden. Luke besuchte seine Mutter.
Der Direktor hatte gesagt: »Einige von euch Jungen werden die Chance bekommen, nach Ende des Schuljahres das sogenannte Oxbridge-Trimester anzuhängen, die beste Voraussetzung dafür, an einer dieser Universitäten angenommen zu werden …«
Luke wusste, dass er einer dieser Jungen war. Dass seine Fähigkeiten trotz seiner ärmlichen und fragwürdigen familiären Verhältnisse, seiner ausländischen Eltern, seiner gemutmaßten jüdischen Abstammung, seiner exzessiven Energie und seiner schwankenden Aufmerksamkeitsspanne begierig registriert worden waren.
»So schwer es auch fällt zu glauben, dass ausgerechnet ihr es schaffen könntet, die Höhen der Vortrefflichkeit zu erklimmen, sagt mir die Erfahrung, dass sie beileibe nicht außerhalb eurer Reichweite liegen.«
Luke kletterte über den Anstaltszaun, ging quer über den teils kahlen Rasen zum Haupteingang und läutete.
Maudy, eine junge Schwester mit üppigen Brüsten und gelben Zähnen, die ihn mochte, öffnete ihm. »Hi, Luke, wie geht’s, wie steht’s?«
Sie warteten im Drahtkäfig, während Schwester Lynne, die bereits in den Sechzigern war, die zweite Tür aufschloss.
Als sie durchgingen, sagte Lynne im Plauderton: »Sie hatte eine sehr gute Nacht, deine Mum.«
»Prima«, sagte Luke. Er wollte nicht stehen bleiben – wollte es nie. Er hatte oft das Bedürfnis, andere Leute anzuschnalzen, als seien sie Kühe, um sie zur Eile anzutreiben.
»Aber heute Nachmittag ging es ihr nicht so gut. Sie musste ein paar Stunden auf die Hawthorn, damit sie sich beruhigen konnte.«
Das ließ ihn stehen bleiben. Station Hawthorn bedeutete, dass seine Mutter ruhiggestellt worden war. Entweder hatte man sie in eine Zwangsjacke gesteckt, oder sie war mit Händen und Füßen an ein Bettgestell gebunden worden. Er war an Kummer gewöhnt, hatte gelernt, damit umzugehen und zu vergessen, Vorfälle zu verdrängen und weiterzumachen. Was nicht hieß, dass sie in Ordnung waren. Seine Mutter war allein gewesen. Sie hatte gelitten. Er vergrub die Hände in den Taschen, blinzelte, kaute mit den Vorderzähnen auf etwas Imaginärem herum, ließ die Augen über die Decke wandern, drängte das Gefühl tief in sein Innerstes zurück. Und als er wieder dazu in der Lage war, fragte er: »Was war denn?«
»Nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest, Schatz. Doktor Herrick wollte nur verhindern, dass sie sich wehtut«, sagte Lynne. »Inzwischen geht es ihr wieder besser, sie ist höchstens noch ein bisschen müde. Sicher wirst du sie aufmuntern.«
Der Aufenthaltsraum war riesig. Willkürlich hier und da platzierte Sessel, ein Klavier. Topfpflanzen, die aussahen, als stammten sie aus grauer Vorzeit, lehnten sich an die hohen, kalkschlierigen Fenster. Mehrere auf dem Linoleumboden verteilte Läufer, gerippte Heizkörper. Den langen Flur im Rücken, blieb Luke in der Tür stehen. Er hörte die üblichen Geräusche von Menschen, die mit sich selbst redeten oder leise vor sich hin summten; Türen schepperten und klapperten, wenn Patienten von hier nach dort gebracht wurden. Irgendwo spielte ein Radio eine Art klassische Musik, gnadenlos heiter, die Art von Musik, zu der es sich marschieren ließ.
Er konnte seine Mutter nirgends entdecken und zwang sich, noch einmal genauer hinzusehen. Da. Sie saß in einem Sessel in der Nähe des Klaviers. Die Erleichterung war oft schlimmer als die eigentliche Krise. Er wünschte sich, er wäre besser gewappnet. Seine Hände zitterten, als er sich den Klavierhocker holte und sich zu ihr setzte.
Speichel glitzerte in ihrem Mundwinkel, ihre Haare waren nicht gekämmt worden. Es dauerte einen Augenblick, bis sie registrierte, dass er da war, ihre Aussprache war undeutlich.
»Oh, ich dachte, du bist Doktor Herrick«, sagte sie. Dann lächelte sie für ihn.
»Nein, bin ich nicht.« Er reichte ihr die Haarbürste aus der Tasche, die neben ihr stand. Sie nahm sie und hielt sie locker in der Hand.
»Gestern musste ich schon wieder nachsitzen«, sagte er.
Langsam fing sie an, sich die Haare zu bürsten.
»Ich hatte mein Französischbuch vergessen«, erzählte er. »Und außerdem habe ich nicht aufgepasst.«
Die Stille zog sich hin. Dann sagte sie: »Dabei könntest du ihm Französisch beibringen, diesem albernen Mann.« Und, nachdem sie in ihrem Gedächtnis herumgekramt hatte: »Diesem Mr Gordon.«
Luke stieß die Luft aus. Erst da merkte er, dass er sie angehalten hatte.
»Richtig«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Mr Gordon.«
Als er wieder ging, zwinkerte Maudy ihm zu. »Siehst du? Sie war ganz in Ordnung, deine Mum.«
Er hätte sie am liebsten gepackt und geküsst, trotz gelber Zähne und allem, und vergaß völlig, was gerade geschehen war, während er sich diesen Kuss vorstellte. Er mochte die Art, wie ihre Bluse über der Brust spannte und zwischen den Knöpfen ein wenig aufklaffte, und hoffte, dass er nicht sein Leben lang auf Mädchen in Schwesternuniform abfahren würde, nur wegen der Anstalt. Es wäre nicht gerade sehr originell; nicht die Art von sexueller Neurose, zu der man stehen konnte. Dass die zerfledderten Magazine, die die Jungen in die Schule schmuggelten, voll von ihnen waren, machte die Sache nicht besser.
»Bis Mittwoch«, sagte Lynne, als er ging.
»Bis Mittwoch«, antwortete er.
Er hielt sich nicht weiter auf. Er musste nach Hause.
In der High Street stieg er aus dem Bus, zog ein Einkaufsnetz hervor, fand ganz unten in seiner Schultasche Geld – vermischt mit Krümeln und Bleistiften – und kaufte fürs Abendessen Fisch. Mr Bradley vom Spirituosenladen händigte ihm trotz seiner Schuluniform eine Flasche Wodka aus, denn wenn er es nicht getan hätte, wäre Lukes Vater gekommen und hätte ihn auf Polnisch angeschrien. Weder Luke noch Mr Bradley wollten diese spezielle Peinlichkeit noch einmal erleben.
Der Direktor hatte gesagt: »Das Oxbridge-Trimester ist hart. Nicht alle von euch werden dem gewachsen sein. Besprecht es mit euren Eltern …«
Schultasche und Einkaufsnetz schlenkernd, ging er nach Hause, setzte sich an den Küchentisch und verbrachte eine erfreuliche Stunde mit der Französischen Revolution, bevor er den Fisch briet und Brot aufschnitt. Sein Vater kam herein, als Luke die Teller auf den Tisch stellte, setzte sich und legte seine halb gerauchte Zigarette auf die Untertasse neben seinem Platz.
»Manche Eltern werden vielleicht Fragen haben. Ihr könnt euch von meiner Sekretärin einen Termin geben lassen.«
»Danke, Lucasz. Bist ein guter Junge«, sagte Tomasz, als er seinen Teller mit einem Stück Brot sauber wischte. Er stand auf, schob langsam den Stuhl zurück, griff sich seine Zigarette, die Wodkaflasche und ein Glas und verließ die Küche.
Luke räumte den Tisch ab und wartete, bis sein Vater die Außentoilette benutzt hatte und nach oben verschwunden war, ging dann ebenfalls aufs Klo, wusch sich und machte, dass er auch nach oben kam.
In seinem Zimmer blieb er neben dem Bett stehen und betete den Rosenkranz. Jahrelang hatte Tomasz darauf bestanden, dass Luke zur Messe ging, obwohl er selbst damit aufgehört hatte und nie mehr von seinem Glauben oder dessen Nichtvorhandensein sprach. Auch über die Vergangenheit sprach er nicht, nicht über seine ehemaligen Kameraden, nicht über seine Kriegserlebnisse. Als er nach England gekommen war, hatte Helene zunächst in Frankreich zurückbleiben müssen, in der Schlange vor der Suppenküche, die sich von Calais bis nach Paris erstreckte. Es dauerte ein ganzes Jahr, bevor sie ihm folgen durfte. In dieser Zeit war sein Geschwader außerhalb von Seston einquartiert gewesen, in demselben Gebäude, in dem Helene fast zehn Jahre später Dauerpatientin wurde. Die merkwürdige Ironie, dass die Anstalt nacheinander seinen beiden Eltern als Zuhause gedient hatte, entging Luke nicht, konnte ihm nicht entgehen.
»Ihr könnt vor den Herbstferien mit mir oder Mr Whiteson über eure Anträge sprechen, die in alphabetischer Reihenfolge in einem speziell dafür vorgesehenen Fach in Miss Higgins Büro liegen. Vergesst nicht, sie dort abzuholen. Und lasst jetzt bloß nicht in euren Anstrengungen nach, Jungs. Das wäre der schlechteste Zeitpunkt dafür.«
Luke hatte nur eine Vorstellung von den Zahlen im Leben seiner Mutter: ein Sohn; ein Ehemann; eine Totgeburt; zwei Fehlgeburten; zwei Selbstmordversuche. Dass er selbst das Licht der Welt erblickt hatte, war für sie ein glühender Beweis für die Unzerstörbarkeit des Lebens gewesen, hatte sie gesagt und ihm einen Namen gegeben, der für Licht und Glück stand und drei Länder überspannte – Luc; Lucasz; Luke. Aber er konnte nicht über die Gegenwart hinausblicken. Seine kranken Eltern, das winzige Haus, das Labyrinth der Anstalt; aus diesen Bestandteilen war er zusammengesetzt. Da Tomasz seine Frau nie besuchte, hatte sie niemanden außer Luke.
Er stand da und lauschte seinen Gedanken nach, dann nickte er, weil er gerade entschieden hatte, dass er nicht auf die Uni gehen würde. Er lächelte, weil es irgendwie komisch war, dass er das je für möglich gehalten hatte.
Und so entschied er sich für die Papierfabrik, und seine Kindheit endete.
Als Bürogehilfe verdiente er zwei Pfund zehn Shilling die Woche. Er arbeitete von halb neun am Morgen bis halb sechs am Abend und besuchte jeden zweiten Tag Helene.
In der Schule war er für seine immense Energie bestraft und zu Sport und zusätzlichen Hausarbeiten verdonnert worden und hatte beides als Ablenkung und Herausforderung begrüßt. Der Sport hatte ihm geholfen, besser zu schlafen. Jetzt, wo er älter war, waren die Nächte unbestimmter und dunkler, und die Welt war in jedem Fall ein viel zu dunkler, quälender Ort, und so machte er das Licht an, wenn er nicht schlafen konnte, und schrieb. Er hegte weder einen heimlichen Groll noch gab es verschorfte Wunden, an denen er herumkratzen musste; stattdessen fand er, wie schon immer, intensive Erfüllung in glückseliger Flucht. Er war ein Wissenschaftler der Fantasie; er konnte reisen. Er verfasste Gedichte und Theaterstücke, versteckte sie vor seinen eigenen kritischen Augen unter dem Bett, führte Tagebuch und brachte sich selbst das Spielen auf einer gebraucht gekauften EKO-Gitarre bei. Er las Zeitungen, den New Musical Express und Melody Maker von Anfang bis Ende und noch einmal von vorn, inklusive der Anzeigen ganz hinten, und hortete sie wie die Gedichte unter seinem Bett.
Er bekam eine Gehaltserhöhung von einem Shilling.
Er beschäftigte sich mit Akkordwechseln, Tonartwechseln, Reimschemata und Shakespeare. Er las drei bis vier Bücher die Woche, erschöpfte die begrenzten Bestände der Bücherei, liebte die mädchenhafte Begeisterung der Bibliothekarin beim Eintreffen der neuesten Agatha Christie oder des neuesten James Bond und unterhielt sich mit ihr über Charaktere und unerwartete Wendungen im Handlungsverlauf. Er las Platon, Proust – um zu sehen, was die ganze Aufregung sollte – und John Fowles’ Der Sammler, dreimal. Hebt den Dachbalken hoch, Zimmerleute, immer und immer wieder. Uhrwerk Orange, zweimal. Die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Er las alles und jedes, und dann wieder seinen Shakespeare. Und wieder.
Er wurde befördert.
Er glaubte, er sei aus der Religion herausgewachsen, war aber fasziniert von der katholischen Leidensverehrung, wie er es für sich bezeichnete, und baute mitten in seinem Zimmer ein Kruzifix aus den Scherben der Flaschen, die sein Vater wegwarf. Für die Figur des Christus benutzte er die Scherben mit den Etiketten und empfand das in jugendlicher Selbstüberschätzung als ironisch.
Er ging jede Woche ins Kino, entweder in Seston oder in Lincoln, wohin er mit dem Bus fuhr; Bonnie und Clyde,Blow Up, Belle de Jour, Wenn Katelbach kommt – alles Filme, die wie Erscheinungen exotischer Götter waren; schockierende, wunderschöne Einblicke in andere Köpfe und Beweis dafür, dass nicht nur seine Augen verzerrte, grellfarbige Linsen waren. Er sah sie sich drei-, viermal an, bis er die Erzählung verlor und nur noch den Takt der Aufnahmen zählte, nur noch die Muster im Schnitt sah und die Form der Handlung wie Musik spürte. Dann sah er sie sich noch einmal an. Die äußere Welt schrumpfte. Sein innerer Horizont nahm Gestalt an. Er kaufte einen Fernseher, den sein Vater erst misstrauisch beäugte, bald aber liebte. Jeden Abend schlief Tomasz bei der Nationalhymne ein und wurde vom schrillen Kreischen, das den endgültigen Sendeschluss anzeigte, wieder geweckt. Luke ertappte ihn dabei, wie er den Bildschirm auch noch anstarrte, nachdem er das Gerät ausgeschaltet hatte, das letzte bisschen Leben aus dem immer blasser werdenden weißen Punkt saugte.
Wenn Luke fernsah, saß er, die Knie bis an die Brust hochgezogen, so dicht vor der flackernden, vor statischer Aufladung pelzigen Mattscheibe, wie er nur konnte. Er sah sich sämtliche Theaterstücke auf BBC an, notierte sich die Namen der Autoren und schrieb die Dialoge mit, in einer Art Hochgeschwindigkeitsgekritzel, ohne auch nur einen Blick auf das Blatt zu werfen.
Und die Songs, die Songs – irgendwo fand eine Party statt, und er war nicht dabei. Spät nachts verbrauchte er die Batterien seines Radios, auf der Suche nach allem, das auch nur halb so viel Energie hatte wie er selbst. Jede Woche hörte er etwas, das die Vorwoche in Grund und Boden stampfte, Musik, die mit jeder Stunde aus ihrer Haut barst; erwachsen und jünger wurde. Die Who, Them, die Stones, die Kinks, Aretha Franklin, James Brown, Bob Dylan. Bob Dylan. Er hatte nicht gewusst, dass Musik auf diese Weise erwachsen werden konnte. Hatte nicht gewusst, dass es dort einen derart großen Denker gab. Er kaufte alle Platten, die er sich leisten konnte, beobachtete die Vinylscheibe, den Aufkleber, die sich drehenden Worte: richtig herum, seitlich, auf dem Kopf. Rund und rund bei 45 Umdrehungen die Minute. Das Leben in seinem Inneren zerriss ihn; er schrieb sich in linierten Kladden aus sich selbst heraus, immer in Hetze, immer ausschauend, arbeitend, in Bewegung, und wusste doch die ganze Zeit, dass er einfach nur stillstand.
Er trug weiße Hemden und schmale schwarze Krawatten. Er kämmte sich die Haare mit Pomade nach hinten, ließ sie wachsen, ließ sich Koteletten stehen, rasierte sie wieder ab, wusch die Pomade aus, schnitt sich die Haare, ließ sie wieder länger werden. Er fing an, samstags abends im Club des Arbeitervereins zu jobben, wo einmal die Woche, zwischen Bingo- und Komikerabend, Bands auftraten. Er musste dafür jeden Möchtegern-Popstar und Romeo in Seston aus dem Feld schlagen, und als er die Stelle hatte, fühlte er sich, als habe Gott mit dem Finger von oben auf ihn herabgedeutet und mit donnernder Stimme gesagt: »Lucasz Kanowski, du wirst hinter einem Tresen stehen, und du wirst Mädchen kennenlernen, und es wird Musik geben …« Und genau so war es. Die Musik war größtenteils grauenhaft; Seston war nicht gerade ein Highlight auf dem Tourenplan der Bands – es wusste selbst, dass es ein nichtssagender, halb toter Ort war. Aber auch wenn die Musik nicht berauschend war, die Mädchen waren es. Fast alle hatten etwas Klingendes, Singendes an sich. Sie rochen alle gleich – nach Haarspray und Mentholzigaretten, nach intensiv parfümiertem Lippenstift. Jill, Sheila, Sandra, Mavis; selbstbewusste Mädchen, die auf sich aufpassen konnten, ihm klarmachten, dass er auf keinen Fall etwas tun durfte, und dann dafür sorgten, dass er es tat. Sie wollten die Hitze all der Dinge, die ihnen nicht erlaubt waren – aber keine Babys. Der Himmel wusste, dass auch Luke keine Babys wollte, und er schöpfte katholischen Genuss aus der Qual, sich zurückhalten zu müssen. Er musste einfallsreich sein, und er war es – in den Toiletten des Clubs, in der Gasse dahinter, an Bushaltestellen, in Vorgärten, Gärten, Bussen und auf Bänken. Er stellte fest, dass der Kick ihrer Befriedigung ähnlich wie ein Segen genug war, um die ständig suchende, unaufhörliche Raserei seiner Gedanken zur Ruhe zu bringen, sodass es kein Büro mehr gab, keine Anstalt, keinen Vater, keine Mutter, nur dieses Mädchen, ihre Hitze und ihre lächelnd geflüsterten Weigerungen – würde er es so weit schaffen? So weit? So weit? Bis es vorbei war und er allein zurückblieb; glücklich, wenn sie mutig genug gewesen war, ihn ebenfalls zu berühren, frustriert, wenn nicht, und die Wahrheit seines Lebens wie ein kalt fallender Regen zu ihm zurückkehrte.
Er bekam eine weitere Gehaltserhöhung.
Er durchlief eine Phase, in der er seinen Akzent von Tag zu Tag veränderte, um zu sehen, ob irgendjemand im Büro es merkte. Er wechselte von Französisch zu Polnisch zu Lincolnshire zu hochvornehmer Oberschicht, aber der einzige Spitzname, der an ihm hängen blieb, war Froschfresser. Frosch.
Er arbeitete als Büroangestellter in einer Papierfabrik und wurde Frosch genannt. Er war dabei, den Verstand zu verlieren.
April 1968
Der Londoner Frühling war nass und rau. Bitterkalter Regen fiel auf das Metall, den Matsch, die Baustellen und die Hochhäuser, die die weiche steinerne Silhouette der Stadt durchbrachen. Mit unbekümmerter Brutalität war der Post Office Tower bei Hagel und sengender Sonne hoch in den Himmel gewachsen. Rund um ihn herum brachten Wildlederhüte, Miniröcke, Ladenfronten, Friseurgeschäfte, Touristen, Herumtreiber und die Musik, die aus Kneipen dröhnte, die Welt der vornehmen Spießer durcheinander. Die Souterrains von Soho ergossen sich schwelgerisch in die Gegenströmungen der alten Garde in ihren schäbigen Regenmänteln; der Jazz, die aufreizende Ihr-könnt-mich-mal-Mentalität, die Besäufnisse füllten die neuen Plastikstraßen mit Leben und Dreck. Obst- und Gemüseläden in Kensingtons überfüllten kleinen Einkaufsarkaden wurden von Boutiquen bedrängt. Die Stadt stemmte sich gegen den reichen Gürtel ihrer Vororte an. Hausfrauen, alt mit fünfundzwanzig, engagierten Kindermädchen und sahen ihrem Niedergang entgegen, und Pendler mit tintenbeklecksten Fingern lasen in den Zügen Zeitungsartikel über Ausschweifungen.
Nina Jacobs, in ihrem dritten LAMDA-Jahr, trat mit den anderen in die Welt hinaus. Gruppen der Schauspielschüler unternahmen Streifzüge nach London wie kleine Rehrudel, die den Wald erkunden; in die Theater des West End, die Boutiquen der King’s Road. Nina freundete sich mit Chrissie Southey an, einem Mädchen mit einer ungebändigten Flut bernsteingoldener Haare und einer frechen, wissenden Sexualität. Ihre Eltern hatten ein Haus in Chelsea, und Nina und Chrissie waren oft dort und probierten in ihrem Zimmer Kleider an, kicherten über Zeitschriften, experimentierten mit ihrem Augen-Make-up und stürzten sich dann in die Vergnügungen der Carnaby Street.
»Ihr kriegt mich nicht!«, rief Chrissie, als sie und Nina eines Tages die Straße entlangflitzten, weg von einer Gruppe magerer Jungen, die ihnen weismachen wollten, sie seien Fotografen.
»Dummschwätzer!«, schrie Nina und rannte fast einen Ansichtskartenständer um. Lachend fielen sie in den Laden ein und kauften von ihrem letzten Geld französische Zigaretten.
Nina träumte von Erfolg, von der Gnade der Anerkennung. Die Schule in ihrer staubigen Backsteinhülse hatte sie geistig und körperlich genährt und aufgepäppelt. Sie hatte dort gespielt, hatte mit kindlichem Eifer hart gearbeitet, aber jetzt würde sie auf den Markt geworfen werden.
»Husch, husch!« Damit scheuchte ihre Mutter sie jeden Morgen aus der Wohnung, und als die Tage immer schneller auf ihr letztes Trimester zurasten, hatte sie das Gefühl, eine Axt über sich schweben zu sehen. Gewerkschaftsausweis. Repertoireauswahl. Vorsprechtermine. Agenten.
Die Abschlussproduktionen des dritten Jahres verwandelten die Bühne, auf der sie gelernt und geprobt hatte, in ein Schaufenster. Produzenten und Agenten saßen im engen Auktionssaal des dunklen Zuschauerraums und bekritzelten einzeilig getippte Besetzungslisten mit Kugelschreiberhieroglyphen. Ninas Jahrgangsgruppe täuschte Kameraderie nur noch vor, die Ziellinie war zu nah, sie waren jetzt Konkurrenten. Die Arbeitslosigkeit im Land mochte so niedrig sein wie nie zuvor, für Schauspieler war sie nach wie vor so hoch wie eh und je. Bewährte Freundschaften zerbrachen und wurden aus plötzlicher Loyalität und unklaren Motiven neu geschmiedet. Schüler, die eine Charakterrolle zugewiesen bekamen, obwohl sie selbst sich in einer Hauptrolle sahen oder nur zwei kümmerliche Textzeilen hatten, während ein Rivale ganze Reden halten durfte, waren von Bitterkeit erfüllt – aus Angst vor der gleichgültigen Welt außerhalb ihrer Spielkiste. Nina hatte die Herausforderungen an Selbst und Psyche geliebt, die das Arbeiten an den Texten darstellte, aber die Bühne machte ihr Angst, und trotz all ihrer Schönfärberei in Bezug auf die eigene Person erlaubte sich ihre Mutter kein einziges Mal die Bequemlichkeit eines falschen Lobs.
»Nina, mach deine Stimme frei! Du klingst wie Prinzessin Margaret. Wo ist deine Stimme?«
Ein Gastregisseur, Richard Weymouth, wurde angekündigt. Er würde von nun an mit ihnen arbeiten. Die Schauspielschüler gingen mit aufgesetzter Professionalität, einer gemutmaßten Annäherung an ihr zukünftiges Leben, zum Vorsprechen. Nina, nervös und stolz, bekam die Rolle der Irina, der jüngsten von Tschechows Drei Schwestern.
»Oh, Nina!«, rief Marianne und umarmte sie. »Gut gemacht, gut gemacht.« Und den Mund in ihre Haare gepresst, fügte sie flüsternd hinzu: »Ich habe mir diese Rolle immer gewünscht und sie nie bekommen. Ich freue mich so für dich!«
Nina hatte Drei Schwestern geliebt, als sie das Stück im ersten Jahr einstudiert hatten. Sie war entschlossen, ihre Angst zu überwinden und ihm gerecht zu werden. Irina hatte etwas Kindliches, das jedoch zerstört wurde; sie sehnte sich nach der Fluchtmöglichkeit der Liebe, fand ihre Rettung aber stattdessen in harter Arbeit. Ninas Seele erkannte sie blind, als wäre sie selbst nur eine Ausschneidefigur und der erfundene Charakter aus Fleisch und Blut.
»Ich habe furchtbare Angst«, sagte sie nach der Schule im Café in der Earl’s Court Road zu Chrissie.
Sie kippten Zucker in ihre Cappuccinos und löffelten den Schaum. So dünn sie beide auch waren, versuchten sie doch ständig, noch mehr abzunehmen – mit ihrer Lippenstift- und Kaffeediät, wie sie es nannten. Der Cappuccino war ihr Mittagessen.
»Richard Weymouth wird dir helfen, er ist verrückt nach dir.«