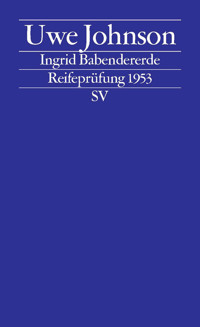47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tag für Tag, über ein Jahr hinweg, erzählt Gesine Cresspahl ihrer zehnjährigen Tochter Marie aus der eigenen Familiengeschichte, vom Leben in Mecklenburg in der Weimarer Republik, während der Herrschaft der Nazis, in der sich anschließenden sowjetischen Besatzungszone und den ersten Jahren in der DDR. Zugleich schildert der Roman das alltägliche Leben von Mutter und Tochter in der Metropole New York im Epochejahr 1967/1968, inmitten von Vietnamkriegs- und Studentenprotesten. In den »Jahrestagen« entfaltet Uwe Johnson ein einzigartiges Panorama deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert – eine »Lese-Weltreise« (Reinhard Baumgart) in die bewegte New Yorker Gegenwart des Jahres 1968 und zugleich in die Geschichte einer deutschen Familie seit der Weimarer Republik. Ein Register zu Uwe Johnsons Roman "Jahrestage" ist unter dem Titel "Kleines Adressbuch für Jerichow und New York" separat erhältlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 3038
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Uwe Johnson
Jahrestage
Aus dem Leben von Gesine Cresspahl
Suhrkamp
Suhrkamp Verlag
Impressum
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage
der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4455.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1970, 1971, 1973, 1983
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg auf Grundlage der von Willy Fleckhaus gestalteten Originalausgabe
eISBN 978-3-518-73599-2
www.suhrkamp.de
Peter Suhrkamp
Helen Wolff
sollen bedankt sein
Jahrestage
August 1967 - Dezember 1967
Lange Wellen treiben schräg gegen den Strand, wölben Buckel mit Muskelsträngen, heben zitternde Kämme, die im grünsten Stand kippen. Der straffe Überschlag, schon weißlich gestriemt, umwickelt einen runden Hohlraum Luft, der von der klaren Masse zerdrückt wird, als sei da ein Geheimnis gemacht und zerstört worden. Die zerplatzende Woge stößt Kinder von den Füßen, wirbelt sie rundum, zerrt sie flach über den graupligen Grund. Jenseits der Brandung ziehen die Wellen die Schwimmende an ausgestreckten Händen über ihren Rücken. Der Wind ist flatterig, bei solchem drucklosen Wind ist die Ostsee in ein Plätschern ausgelaufen. Das Wort für die kurzen Wellen der Ostsee ist kabbelig gewesen.
Das Dorf liegt auf einer schmalen Nehrung vor der Küste New Jerseys, zwei Eisenbahnstunden südlich von New York. Die Gemeinde hat den breiten Sandstrand abgezäunt und verkauft Fremden den Zutritt für vierzig Dollar je Saison, an den Eingängen lümmeln uniformierte Rentner und suchen die Kleidung der Badegäste nach den Erlaubnisplaketten ab. Offen ist der Atlantik für die Bewohner der Strandvillen, die behäbig unter vielflächigen Schrägdächern sitzen, mit Veranden, doppelstöckigen Galerien, bunten Markisen, auf dem Felsdamm oberhalb der Hurrikangrenze. Die dunkelhäutige Dienerschaft des Ortes füllt eine eigene Kirche, aber Neger sollen hier nicht Häuser kaufen oder Wohnungen mieten oder liegen in dem weißen grobkörnigen Sand. Auch Juden sind hier nicht erwünscht. Sie ist nicht sicher, ob Juden vor 1933 noch mieten durften in dem Fischerdorf vor Jerichow, sie kann sich nicht erinnern an ein Verbotsschild aus den Jahren danach. Sie hat hier einen Bungalow auf der Buchtseite von Freunden auf zehn Tage geliehen. Die Leute im Nachbarhaus nehmen die Post an und lesen die Ansichtenkarten, die das Kind aus dem Ferienlager an »dear Miss C.« schreibt, aber sie beharren auf der Anrede »Mrs. Cresspahl«, und mögen auch sie für eine Katholikin irischer Abstammung ansehen.
Ge-sine Cress-pål
ick peer di dine Hackn dål
Der Himmel ist lange hell gewesen, blau und weißwolkig, die Horizontlinie dunstig. Das Licht drückt die Lider nieder. Zwischen den kostspieligen Liegestühlen und Decken ist viel Strand unbelegen, aus den benachbarten Gesprächen dringen Worte wie aus einer Vergangenheit in den Schlaf. Der Sand ist noch schwer vom gestrigen Regen und läßt sich zu festen weichen Kissen zusammenschieben. Quer über den Himmel ziehen winzige Flugzeuge Spruchbänder, die Getränke und Läden und Restaurants anpreisen. Weiter draußen, über der gedrängten Herde der Sportfischerboote, üben zwei Düsenjäger Orientierung. Die Brandung stürzt in den Einschlag eines schweren Geschosses und zerspritzt in den prasselnden Geräuschen, die das Dorfkino abends in Weltkriegsfilmen vorführt. Sie wacht auf von einzelnen Regentropfen und sieht wieder das bläuliche Schindelfeld einer Dachneigung im verdüsterten Licht als ein pelziges Strohdach in einer mecklenburgischen Gegend, an einer anderen Küste.
An die Gemeindeverwaltung von Rande bei Jerichow. Als ehemalige Bürgerin von Jerichow, und als ehemals regelmäßige Besucherin von Rande, bitte ich Sie höflichst um Auskunft, wie viele Sommergäste jüdischen Glaubens vor dem Jahr 1933 in Rande gezählt wurden. Mit Dank für Ihre Mühe.
Abends ist der Strand hart von der Nässe, mit Poren gelöchert, und drückt den Muschelsplitt schärfer gegen die Sohlen. Die auslaufenden Wellen schlagen ihr so hart gegen die Knöchel, daß sie sich oft vertritt. Im Stillstehen holt das Wasser ihr in zwei Anläufen den Grund unter den Füßen hervor, spült sie zu. Nach solchem Regen hat die Ostsee einen gelinden, fast gleichmäßigen Saum ans Land gewischt. Beim Strandlaufen an der Ostsee gab es ein Spiel, bei dem die Kinder dem Vordermann jenen Fuß, der eben nach vorn anheben wollte, mit einem raschen Kantenschlag hinter die Ferse des stehenden Beins hakten, dem Kind das sie war, und der erste Fall war unbegreiflich. Sie geht auf den Leuchtturm zu, dessen wiederkehrender Blitz zunehmende Schnitze aus dem blauen Schatten hackt. Alle paar Schritte versucht sie, sich von den Wellen aus dem Stand schubsen zu lassen, aber sie kann das Gefühl zwischen Stolpern und Aufprall nicht wieder finden.
Can you teach me the trick, Miss C.? It might not be known in this country.
An der israelisch-jordanischen Front ist wieder geschossen worden. In New Haven sollen Bürger afrikanischer Abstammung Schaufenster einschlagen und Brandbomben werfen.
Am nächsten Morgen ist der früheste Küstenzug nach New York auf dem freien Feld vor der Bucht aufgefahren, invalides Gerät mit Pfandplaketten unter dem Firmennamen. Jakob hätte so verwahrloste Wagen nicht vom Abstellgleis gelassen. Die verstriemten Fenster rahmen Bilder, weißgetünchte Holzhäuser in grauem Licht, Privathäfen in Lagunen, halbwache Frühstücksterrassen unter schweren Laubschatten, Flußmündungen, letzte Durchblicke zum Meer hinter Molen, die Ansichten vergangener Ferien. Waren es Ferien? Im Sommer 1942 setzte Cresspahl sie in Gneez in einen Zug nach Ribnitz und erklärte ihr, wie sie da vom Bahnhof zum Hafen gehen sollte. Sie war so verstört von der Trennung, ihr fiel nicht Angst vor der Reise ein. Der Fischlanddampfer im Hafen von Ribnitz war ihr vorgekommen wie eine fette schwarze Ente. Auf der Ausfahrt in den Saaler Bodden hatte sie den ribnitzer Kirchturm im Blick behalten, den von Körkwitz dazugezählt, dann die Düne von Neuhaus auswendig gelernt, die ganze Fahrt bis Althagen rückwärts gewandt, um den Rückweg zur Eisenbahn, nach Jerichow später nicht zu verfehlen. 1942 im Sommer wollte Cresspahl das Kind eher aus dem Weg haben. Aus seinem Weg hatte er sie 1951 geschickt, in den Südosten Mecklenburgs, fünf Stunden von Jerichow. Der Bahnhof von Wendisch Burg lag höher als die Stadt, vom Ende des blausandigen Bahnsteigs war der Ostrand des Untersees zu sehen, stumpf im Nachmittag. Sie merkte erst an der Sperre, daß Klaus Niebuhr sie die ganze Zeit in ihrem unschlüssigen Dastehen beobachtet hatte, wortlos, bequem auf das Stangengeländer gestützt, neun Jahre älter als das Kind, das sie erinnerte. Er hatte ein Mädchen namens Babendererde mitgebracht. Sie war eine von denen mit dem unbedachten Lächeln, und Gesine nickte vorsichtig, als Klaus ihren Namen nannte. Sie fürchtete auch, daß er wußte, warum Cresspahl sie vorläufig nicht in Jerichow haben wollte. Ferien waren es kaum. Der Zug rollt gemächlich auf kleinstädtische Vorplätze, Fahrgäste in Büroanzügen treten aus der Dämmerung unter den Dächern hervor, jeder allein mit seinem Aktenkoffer, und legen sich im Zug auf den niedergestellten Sitzen schlafen. Jetzt züngelt die Sonne über den Hausfirsten, wirft Fäuste voll Licht über tiefliegendes Feld. Die Stichbahn von Gneez nach Jerichow war in weitem Abstand an den Dörfern vorbeigeführt, die Stationen waren rote Bauklötze mit giebligen Teerdächern, vor denen wenige Leute mit Einkaufstaschen warteten. Die Fahrschüler stellten sich auf den Bahnsteigen so auf, daß sie vor Gneez alle im dritten und vierten Abteil hinter dem Gepäckwagen versammelt waren. An dieser Strecke lernte Jakob die Eisenbahn. Jakob in dem schwarzen Kittel sah aus seiner Bremserkabine so geduldig auf die Gruppe der Oberschüler herunter, als wollte er Cresspahls Tochter nicht erkennen. Mit neunzehn Jahren mag er die Leute noch nach Ständen unterschieden haben. Von den rostbrandigen Sümpfen New Jerseys über stelzige Brücken schwankt der Zug in die Pallisaden und abwärts in den Tunnel unter dem Hudson nach New York, und sie steht schon lange in der Reihe der Wochenendurlauber und Tagesurlauber im Mittelgang, gelegentlich um einen halben Fuß vortretend, angetreten zum Rennen auf die Wagentür, die Rolltreppe, die verwinkelten Bauverschalungen des Pennsylvania-Bahnhofs, in die Westseitenlinie der Ubahn, in die Linie nach Flushing, auf die Rolltreppe aus dem blauen Gewölbe auf die Ecke der 42. Straße am Bahnhof Grand Central. Später als eine Stunde darf sie nicht an ihren Arbeitstisch kommen, und eine Stunde zu spät nur heute, nach dem Urlaub.
21. August, 1967 Montag
Aufklarendes Wetter in Nord-Viet Nam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi. Die Marine bombardierte die Küste mit Flugzeugen und feuerte Achtzollgranaten in die entmilitarisierte Zone. Im Süden wurden vier Hubschrauber abgeschossen. Die Unruhen in New Haven gingen gestern weiter mit Bränden, eingeschlagenen Schaufenstern, Plünderung; weitere 112 Personen sind festgenommen worden.
Neben dem Zeitungenstapel wartet eine kleine gußeiserne Schale, über die die gekrümmte Hand des Händlers vorstößt, ehe sie noch die Münze hat abwerfen können. Der Mann blickt feindselig, dem haben sie sein Geld einmal zu oft weggerafft im Vorübergehen auf der offenen Straße.
Dafür hab ich mir also den Hals zerschießen lassen, meine Dame.
Die Leiche jenes Amerikaners, der am vorigen Mittwochabend in Prag nicht in sein Hotel zurückkam, ist gestern nachmittag in der Vltava gefunden worden. Mr. Jordan, 59 Jahre, war Mitarbeiter des jüdischen Hilfswerks JOINT. Er hatte sich eine Zeitung kaufen wollen.
Die Sohle der Lexington Avenue ist noch verschattet. Sie erinnert sich an die Taxis, die einander am Morgen auf dem Damm drängen, im Einbiegen aufgehalten von einem Verkehrslicht, dessen Rot die Fußgänger zum Gang über die östliche Einbahnstraße ausnutzen können, in dessen Grün sie die wartenden Wagen behindern dürfen. Sie hat nicht gezögert, auf die Verbotsschrift zuzutreten. Sie kommt hier seit vordenklicher Zeit, mit angelegten Ellenbogen, auf den Takt der Nachbarn bedacht. Sie weicht dem blinden Bettler aus, der mit vorgehaltenem Becher klimpert, der unwillig grunzt. Sie hat ihn wieder nicht verstanden. Sie geht noch zu langsam, ihr Blick wandert, sie ist mit der Rückkehr beschäftigt. Seit sie aus der Stadt war, hat zwischen den hohen Fenstertürmen das Sirenengejaul gehangen, das schwillt, verkümmert, hinter ferneren Blocks wild aufbricht. Aus den Seitenstraßen schlägt hitziges Gegenlicht quer. Mit den Augen gegen den blendenden Zement geht sie neben einer Fußfassade aus schwarzem Marmor, deren Spiegel die Farben der Gesichter, Blechlacke, Baldachine, Hemden, Schaufenster, Kleider schwächer tönt. Sie tritt beiseite in einen weißlichtigen Gang, aus dem Ammoniak ins Offene dampft, Biß für Biß abgetrennt von der federnden schmalen Tür. Diesen Eingang kennen nur die Angestellten.
Sie ist jetzt vierunddreißig Jahre. Ihr Kind ist fast zehn Jahre alt. Sie lebt seit sechs Jahren in New York. In dieser Bank arbeitet sie seit 1964.
Ich stelle mir vor: Unter ihren Augen die winzigen Kerben waren heller als die gebräunte Gesichtshaut. Ihre fast schwarzen Haare, rundum kurz geschnitten, sind bleicher geworden. Sie sah verschlafen aus, sie hat seit langem mit Niemandem groß gesprochen. Sie nahm die Sonnenbrille erst ab hinter dem aufblitzenden Türflügel. Sie trägt die Sonnenbrille nie in die Haare geschoben.
Sie hatte kaum Spaß an der Wut der Autofahrer, die auf der Lexington Avenue von einer Ampel Tag für Tag benachteiligt werden. Sie kam hier an mit einem Auto, einem schwedischen Tourenwagen, der zwei Jahre lang am Schneesalz verrottete, am Fuß der 96. Straße, gegenüber den drei Garagen. Zur Arbeit ist sie immer mit der Ubahn gefahren.
Ich stelle mir vor: In der Mittagspause liest sie noch einmal, daß gestern nachmittag ein Mann in einem Kahn auf der Moldau in Prag spazierenfuhr, bis er zur Brücke des Ersten Mai kam. An einem Wasserbrecher hing ein Jude aus New York, der aus seinem Hotel gegangen war, um eine Zeitung zu kaufen. (Sie hat gehört, daß englischsprachige Zeitungen in Prag nur in Hotels verkauft werden.)
Bis vor fünf Jahren kannte sie von Prag nur die Straßen bei Nacht, durch die ein Taxi vom Hauptbahnhof zum Bahnhof Střed fährt.
You American? Hlavní nádraží dříve, this station, earlier, Wilsonovo nádraží. Sta-shun. Woodrow Wilson!
Sie hätte ja sagen müssen, weil sie einen amerikanischen Paß in der Tasche hatte. Den Namen in dem Paß hat sie vergessen. Das war 1962.
Ich stelle mir vor: Sie kommt am Abend, bei schon abgedecktem Himmel, aus der Ubahnstation 96. Straße auf den Broadway und sieht im Brückenausschnitt unter dem Riverside Drive eine grüne Lichtung, hinter dem fransigen Parklaub den ebenen Fluß, dessen verdecktes Ufer ihn auslaufen läßt in einen Binnensee in einem Augustwald in trockener verbrannter Stille.
Sie wohnt am Riverside Drive in drei Zimmern, unterhalb der Baumspitzen. Das Innenlicht ist grün gestochen. Im Norden sieht sie neben dichten Blattwolken die Laternen auf der Brücke, dahinter die Lichter auf der Schnellstraße. Die Dämmerung schärft die Lichter. Das Motorengeräusch läuft ineinander in der Entfernung und schlägt in ebenmäßigen Wellen ins Fenster, Meeresbrandung vergleichbar. Von Jerichow zum Strand war es eine Stunde zu gehen, am Bruch entlang und dann zwischen den Feldern.
22. August, 1967 Dienstag
Über Festland-China sind gestern zwei Düsenjäger der U. S. Marine abgeschossen worden. Das Kriegsministerium erklärt 32 Mann für amtlich tot in Viet Nam. Das Marinekorps hat 109 tote Vietnamesen aus dem Norden gezählt. Die Bande im Süden verspricht ganz ehrliche Wahlen.
Gestern in New Haven sind abermals Schaufenster eingeschlagen und Brände gelegt worden. Die Polizei trug blaue Helme, Gewehre in der Hand, schoß Tränengas ab. Inzwischen sind 284 Bürger verhaftet, zumeist Afrikaner und Puertorikaner.
Der Zeitungsstand auf dem Broadway, an der Südwestecke der 96. Straße, ist ein grünes Zelt, herumgebaut um einen Kern aus Aluminiumkästen. Links sind die hiesigen Zeitschriften in Bahnen überlappt ausgelegt, rechts neben dem Eingang die Stapel der Tageszeitungen, rechts außen die Einfuhren aus Europa, gesichert mit verkrusteten Gewichten. Der Stand zeigt den Leuten, die um die Straßenecke leben, das Wetter an; wenn er mit Stangen und Tuch mehr Dach ansetzt, ist bald Regen zu erwarten. Der alte Mann mit der speckigen Schirmmütze, der die Morgenschicht arbeitet, nimmt sich das Recht auf seine Laune. Seine rechte Hand ist verstümmelt; er besteht aber darauf, daß die Kunden ihm das Geld zwischen die krummen Finger stecken, und jeden Morgen übt er, Münzen mit dickem Daumen aus der krüppligen Handgrube zu drücken. An diesem Morgen grüßt er nicht zurück.
Er kennt diese Kundin: sie kommt an allen Arbeitstagen um zehn Minuten nach acht aus der 96. Straße, sie bringt immer die passende Münze, sie versucht die Titelzeilen der New York Times zu lesen, wenn sie die Zeitung unter dem Gewicht hervorzupft. Sie geht meist mit leeren Händen zur Arbeit, mit der Zeitung unterm Ellenbogen läuft sie in die Ubahnstation hinunter zu immer dem selben Zug (den er gleich darauf durch die Gitter in der Mitte des Broadway einfahren hört). Sie sagt guten Morgen, als hätte sie es auf einer Schule im Norden gelernt; sie ist aber nicht im Land geboren. Der Händler kennt auch das Kind dieser Kundin vom Sonnabend, wenn beide mit dem Einkaufswagen die Straße abfahren; das Kind, ein zehnjähriges Mädchen mit einem ähnlich kugeligen Kopf, aber sandblonden, ausländischen Zöpfen, sagt guten Morgen, als hätte es das auf der 75. Schule einen Block weiter gelernt, und kommt heimlich an Sonntagmorgen, sich eine Zeitung zu holen, die ganz und gar aus gezeichneten Bilderstreifen besteht. Davon weiß die Kundin nichts, noch daß das Kind selten bezahlen muß. Die Kundin kauft keine Zeitung als die New York Times.
Morgen werden Sie mal nicht grüßen, meine Dame. Alle diese Fisimatenten.
Gesine Cresspahl kauft die New York Times wochentags am Stand, der Bote könnte ihre Frühstückszeit doch verfehlen. Am Bahnsteig faltet sie das Blatt einmal und noch einmal längs, damit sie es im Gedränge durch die Ubahntür behält und in der Enge zwischen Ellenbogen und Schultern die erste Seite des achtspaltigen Stabs von oben bis unten lesen kann, fünfzehn Minuten unter der Straße dahingerissen, bis sie zu Fuß weitergehen kann. Wenn sie nach Europa fliegt, läßt sie den Nachbarn seine Exemplare aufheben, zurückgekehrt holt sie die versäumte new yorker Zeit Wochenenden lang nach aus fußhohen Stapeln. In der Mittagspause räumt sie ihren Arbeitstisch frei und liest in den Seiten hinter dem Titelblatt, die Ellenbogen gegen die Tischkante gestemmt, nach der europäischen Manier. Bei einem Besuch in Chicago lief sie drei Kilometer durch eine schneewindige Straße aus blinden Wohnkästen, bis sie in einer prochinesischen Buchhandlung noch die überalterte Stadtausgabe aus New York auftrieb, als sei nur dem auswärtigen Druck zu glauben. Auf dem Rückweg von der Arbeit sind die drei Längsfalten so kräftig eingekerbt, daß die Spalten sich gefügig aufklappen, nach rechts umlegen, nach links schwenken lassen, wie die Tasten eines Instruments, unter den Fingern einer Hand; die andere Hand braucht sie für den Haltegriff in den überfüllten, schwankenden Wagen. Einmal nach Mitternacht ging sie, vorsichtig und den Blick geradeaus, durch die heißen Nebenstraßen, vorbei an flüsternden Gruppen und einer Schlägerei um eine betrunkene oder bewußtlose Frau, auf den Broadway, der jetzt dicht mit Polizisten, Prostituierten, Rauschkranken bestanden war, und kaufte die früheste Ausgabe der New York Times und schlug sie auf unter der Acetylenlampe am Giebel des Kiosks und fand die Nachricht, die nun wahrer war als die reißerische Überschrift, die sie den Nachmittagsblättern nicht hatte glauben mögen (das war, als Frau Enzensberger in Berlin den Stellvertreter des Präsidenten mit Bomben aus Puddingpulver erledigen wollte). Sie behält das geknickte, flappige Blatt unter dem Arm bis hinter ihre Wohnungstür und liest beim Essen noch einmal die Berichte aus der Finanz; allerdings aus dienstlichen Gründen. Wenn sie an einem Tag am Strand die Zeitung verpaßt hat, hält sie abends ein Auge auf den Fußboden der Ubahn und auf alle Abfallkörbe unterwegs, auf der Suche nach einer weggeworfenen, angerissenen, bekleckerten New York Times vom Tage, als sei nur mit ihr der Tag zu beweisen. Sie ist mit der New York Times zu Gange und zu Hause wie mit einer Person, und das Gefühl beim Studium des großen grauen Konvoluts ist die Anwesenheit von Jemand, ein Gespräch mit Jemand, dem sie zuhört und antwortet mit der Höflichkeit, dem verhohlenen Zweifel, der verborgenen Grimasse, dem verzeihenden Lächeln und solchen Gesten, die sie heutzutage einer Tante erweisen würde, einer allgemeinen, nicht verwandten, ausgedachten: ihrem Begriff von einer Tante.
23. August, 1967 Mittwoch
Die Luftwaffe flog gestern 132 Angriffe auf Nord-Viet Nam. Die Zeitung setzt unter ein Bild von den Trümmern eines Flugzeugs in Hanoi, daß die Kommunisten dies für ein abgeschossenes Flugzeug erklären. Das Foto war wichtig genug für die erste Seite, aber erst auf der sechsten, verstellt von Neuigkeiten aus Jerusalem, finden wir die amtlichen Todeserklärungen für vierzig Soldaten, nur die Toten aus New York und Umgebung namentlich genannt, fünfzehn Zeilen Lokales.
In der Nacht in New Haven gingen fünfhundert Polizisten Patrouille in den Negervierteln, durchsuchten Autos, hielten Scheinwerfer gegen die Fenster, verhafteten hundert Leute. Und wäre sie gestern nachmittag am Foley Square gewesen, hätte sie einen Führer der radikalen Afrikaner rufen hören können, daß Krieg sei mit den Weißen und Gewehre vonnöten, als sie die 95. Straße West hinunterging, entgegen dem immer noch feucht verwischten Parkbild mit dem Fluß inmitten. Sie stellt sich vor, daß sie die Gesichter der Polizisten beobachtet hätte, deren eines zu sehen ist unter der erhobenen schwarzen Faust in der Zeitung, mit einem ungläubigen Ausdruck fast altersweiser Art, noch im Nachgeschmack der vorangegangenen Prügelei.
Im August 1931 saß Cresspahl in einem schattigen Garten an der Travemündung, mit dem Rücken zur Ostsee, und las in einer englischen Zeitung, die fünf Tage alt war.
Er war damals in seinen Vierzigen, mit schweren Knochen und einem festen Bauch über dem Gürtel, breit in den Schultern. In seinem graugrünen Manchesteranzug mit Knickerbockers sah er ländlicher aus als die Badegäste um ihn, er betrug sich vorsichtig und seine Hände waren klobig, aber der Kellner sah es, wenn er die Hand hob, und setzte ihm das Bier bald neben die Hand, nicht ohne Redensarten. Darauf antwortete Cresspahl mit leisem, vergeßlichem Knurren. Er sah an seiner zerknitterten Zeitung vorbei auf einen Tisch in der sonnigen Mitte des Gartens, an dem eine Familie aus Mecklenburg saß, jedoch in einer zerstreuten Art, als habe er seine veralteten Nachrichten satt. Er war damals füllig im Gesicht, mit trockener schon harter Haut. In der Stirn war sein langer Kopf schmaler. Sein Haar war noch hell, kurz in kleinen wirbligen Knäueln. Er hatte einen aufmerksamen, nicht deutbaren Blick, und die Lippen waren leicht vorgeschoben, wie auf dem Bild in seinem Reisepaß, den ich ihm zwanzig Jahre später gestohlen habe.
Er war vor fünf Tagen aus England abgefahren. Er hatte in Mecklenburg seine Schwester verheiratet an einen Vorarbeiter beim Wasserstraßenamt, Martin Niebuhr. Er hatte das Essen im Ratskeller von Waren gestiftet. Er hatte sich Niebuhr zwei Tage lang angesehen, ehe er ihm tausend Mark gab, als Darlehen. Er hatte das Grab seines Vaters auf dem Friedhof von Malchow auf zwanzig Jahre im voraus bezahlt. Er hatte seiner Mutter eine Rente hinterlassen. Hatte er sich nicht losgekauft? Er hatte einen Vetter im Holsteinischen besucht und ihm einen Tag Korn einfahren helfen. Er hatte seinen Paß um fünf Jahre verlängern lassen, nach den Vorschriften für die Einbürgerung. Er hatte noch fünfundzwanzig Pfund in der Tasche und wollte nur wenig davon ausgeben, bis er zurück war in Richmond, in seiner Werkstatt voll teuren Werkzeugs, bei verläßlicher Kundschaft, in seinen zwei Zimmern am Manor Grove, in dem Haus, auf das er ein Gebot gemacht hatte. Er hatte auf der Reise noch einmal gesehen, wo er ein Kind gewesen war, wo er das Handwerk gelernt hatte, wo er zum Krieg eingezogen wurde, wo die Kapp-Putschisten ihn in einen Kartoffelkeller gesperrt hatten, wo jetzt die Nazis sich mit den Kommunisten schlugen. Er hatte nicht vor, noch einmal zu kommen.
Die Luft war trocken und ging schnell. Die warmen Schatten flackerten. Der Seewind schlug Fetzen von Kurkonzert in den Garten. Es war Friede. Das Bild ist chamois getönt, vergilbend. Was fand Cresspahl an meiner Mutter?
Meine Mutter war 1931 fünfundzwanzig Jahre alt, die zweitjüngste von den Töchtern Papenbrocks. Auf Familienbildern steht sie hinten, die Hände verschränkt, den Kopf leicht schräg geneigt, nicht lächelnd. Man sah ihr an, daß sie noch nie anders denn aus freien Stücken gearbeitet hatte. Sie war so mittel groß wie ich, trug unser Haar in einem Nackenknoten, dunkles, locker fallendes Haar um ihr kleines, gehorsames, ein bißchen gelbliches Gesicht. Sie sah jetzt besorgt aus. Sie hob selten den Blick vom Tischtuch und knetete ihre Finger, als wäre sie gleich ratlos. Sie allein hatte gemerkt, daß der Mann, der sie ebenmäßig ohne ein Nicken beobachtete, ihnen nachgegangen war von der Priwallfähre bis an den nächsten freien Gartentisch. Der alte Papenbrock lag mit seinem ganzen Gewicht gegen seine Lehne und quengelte mit dem Kellner, oder mit seiner Frau, wenn die Bedienung an anderen Tischen stand. Meine Großmutter, das Schaf, sagte wie in der Kirche: Ja, Albert. Gewiß, Albert. Der Kellner stand an Cresspahls Seite und sagte: Nich daß ich weiß. Wochenende. Kommen viel vom Land rüber. Gute Familien. Mein Herr.
Ich war hübsch, Gesine.
Und er sah doch eher aus wie ein Arbeiter.
Dafür hatten wir einen Blick, Gesine.
Cresspahl stand an der Fähre zum Priwall, als die Papenbrocks in die Vorderreihe kamen, auf der Fähre stand er gegen den Schlagbaum gestützt, den Rücken zu ihnen. Auf der anderen Seite ließ er sie an sich vorbeigehen zu Alberts Lieferwagen und verlor sich bald unter den Spaziergängern in der dick überlaubten Villenstraße. Am Abend fuhr Cresspahl mit einem gemieteten Auto zurück nach Mecklenburg, über den Priwall, entlang der Pötenitzer Wiek, entlang der Küste nach Jerichow. Mein Vater, als sein Boot nach England in Hamburg ablegte, nahm sich ein Zimmer im Lübecker Hof in Jerichow.
Gesine Cresspahl wird an manchen Mittagen eingeladen in ein italienisches Restaurant an der Dritten Avenue. Hinter dem Haus ist ein Garten zwischen efeubewachsenen Ziegelwänden. Die Tische unter den bunten Sonnenschirmen sind mit rotweiß karierten Decken belegt, der Straßenlärm fällt nur dumpf übers Dach, und das Gespräch befaßt sich mit den Chinesen. Was machen die Chinesen?
Die Chinesen stecken die britische Botschaft in Peking an und verprügeln den Geschäftsträger. Das machen die Chinesen.
24. August, 1967 Donnerstag
Über Nord-Viet Nam sind fünf Kriegsflugzeuge abgeschossen worden. Siebzehn Mann sind amtlich tot im Süden, und einer von ihnen war Anthony M. Galeno aus der Bronx.
In der Bronx hat die Polizei ein Waffenlager ausgehoben, Panzerfaust, Maschinenpistole, Dynamit, Sprengpulver, Handgranaten, Gewehre, Flinten, Pistolen, Zündkapseln. Die vier Sammler, private Patrioten, wollten zunächst den Kommunisten Herbert Aptheker umbringen und dann die Nation vor ihren übrigen Feinden schützen.
Als Gesine Cresspahl im Frühjahr 1961 in diese Stadt kam, sollte es für zwei Jahre sein. Der Gepäckträger hatte das Kind auf seinen Karren gestellt und fuhr es mit Schwung durch die vergammelte Halle der Französischen Linie; das Kind nahm beide Hände auf den Rücken, als er seine ausstreckte und die Kappe abnahm. Marie war fast vier Jahre alt. Sie hatte nach sechs Tagen auf See den Mut verloren, in dem neuen Land auf den Rhein, auf den Kindergarten in Düsseldorf, auf die Großmutter zu hoffen. Gesine dachte an Marie immer noch als an »das Kind«, das Kind konnte sich kaum gegen sie wehren. Sie war besorgt, dieser Umzug könne vereitelt werden durch das Kind, das unter seinem weißen Kapotthut finster und verschüchtert gegen das Schmutzlicht der 48. Straße West blinzelte.
Sie hatte zwanzig Tage Zeit, eine Wohnung zu finden, und an jedem wehrte sich das Kind gegen New York. Das Hotel fand eine deutschsprachige Aufpasserin für sie, eine steifnackige betagte Schwarzwälderin in einem teerschwarzen Kleid voller Rüschen und Knopfleisten, die mit dünnem Sopran Lieder von Uhland singen konnte, aber die Emigrantin hatte mehr von ihrem Dialekt behalten als von dem Hochdeutsch, das vor fünfundzwanzig Jahren in Freudenstadt gesprochen wurde; das Kind antwortete ihr nicht. Das Kind zog mit Gesine durch die Stadt, ließ sie nicht von der Hand, stand dicht an sie gedrückt in den Bussen und Ubahnen, wachsam bis zum Mißtrauen, und ließ sich erst im späten Nachmittag von eintönigen Fahrtbewegungen in den Schlaf tölpeln. Sie zog den Kopf zwischen die Schultern, wenn Gesine ihr aus den Wohnunganzeigen der New York Times vorlas, ihr lag nicht an den bewachten Fahrstühlen, nicht an der Klimamaschine; sie fragte nach Schiffen. Sie sah mit einer Art Befriedigung umher in den Wohnungen, die Gesine erschwingen konnte, knausrig geschnittenen und schäbig möblierten Zimmern, drei Fenster zum nachtdunklen Hof und eins auf die kahle harte Gegenfront, teuer weil frei von Negern als Nachbarn; sie kamen den Gartenfenstern in Düsseldorf nicht gleich, die mußte sie sich nicht bieten lassen. Das Kind nahm sich kein englisches Wort an, sie ließ sich die Grüße und Zurufe und Schmeicheleien in Imbiß-Stuben im Bus in der Hotelhalle gefallen als sei ihr das Gehör ausgegangen, Antwort gab sie nur mit einem verzögerten wütenden Kopfschütteln bei niedergeschlagenen Lidern. Sie war so still versessen auf die Rückkehr, sie wurde wieder und wieder wohlerzogen genannt. Sie fing an, das Essen zu verweigern, weil das Brot, das Obst, das Fleisch anders schmeckten. Gesine überwand sich zu Bestechung und erlaubte ihr Trickfilmprogramme im Bildfunk anzusehen; das Kind kehrte sich ab vom Schirm, nicht trotzig. Das Kind stand am Fenster und sah hinunter in die von hochstöckigen Fassaden verdunkelte Straße, in der alles anders war: die knallbunten Taxirudel, die uniformierten, trillernden Portiers unter ihren Baldachinen, die amerikanische Fahne auf dem Harvardklub, mit Knüppeln spielende Polizisten, der weiße Dampf aus den Schächten der Fernheizung, leuchtend in der fremden Nacht. Sie fragte nach Flugzeugen. Gesine war erleichtert, wenn das Kind nach vieltägigem Betrachten fragte, warum manche Leute hier eine dunkle Hautfarbe haben, oder warum alte Frauen aus dem Schwarzwald Juden sind; das meiste Gespräch war stumm, blickweise, in Gedanken:
gäbst du überhaupt auf, mir zuliebe?
Gib mir diese zwei Jahre. Dann gehen wir nach Westdeutschland für so lange du willst.
Denkst du denn aufzugeben
Dem Kind zuliebe ließ Gesine am zwölften Tag das Suchen in Manhattan sein und verlegte sich auf die Villenviertel in Queens. Der Zug kletterte aus dem Tunnel unter dem East River auf die hohen Stelzen gegenüber den Vereinten Nationen, und das Kind sah entmutigt und rechthaberisch auf die übermenschlich hohe Zackenlinie des anderen Ufers und dann auf die ärmlichen niedrigen Kästen, die einstöckige Wüstenei (wie ein Dichter sagt) rechts und links der Bahn. Aber in Flushing fanden sie Parkstraßen, breit zwischen Rasenhängen, von alten Bäumen beschattet, locker eingefaßt von abständigen Häusern aus weißem Holz und schiefrigen Dächern nach dem Muster der Bauern, und Gesine bat dem Kind nicht mehr heimlich ab. Das Kind sagte: Wollen wir nicht lieber an einem Strand suchen gehen?
Der Makler in der Hauptstraße war ein gesetzter, leise sprechender Mann über die Fünfzig, ein Weißer. Wenn er die Brille abnahm, sah er erfahren aus. Alter ließ ihn verläßlich scheinen. Er hatte möblierte Wohnungen in den Baumgebieten vorrätig, mit Treppen zu Gärten, mit Schwimmbädern um die Ecke. Gesine konnte hier bezahlen. Der Mann lächelte dem Kind zu, das steif vor Empörung die Ansiedlung für geschehen hielt. Er sprach über die Gegend, nannte sie anständig und jüdisch und sagte: Haben Sie keine Sorge, wir halten die shwartzes schon draußen. Gesine nahm in einem Griff das Kind vom Stuhl, die Tasche vom Tisch und war auf dem Bürgersteig, auch sorgfältig bedacht, die Glastür mit einem Knall gegen den Rahmen zu werfen.
Abends saßen sie in einem Restaurant auf dem Flughafen Idlewild und sahen die Maschinen auf das Feld hinausziehen, vor dem schwärzlichen Himmel aufs Meer hinaus starten. Sie versuchte dem Kind zu erklären, daß der Makler sie für eine Jüdin gehalten hatte, für einen besseren Menschen als eine Negerin. Das Kind wollte wissen was das heißt: You bastard of a Jew, und verstand, daß Wunder möglich sind, sah den Koffer mit dem Spielzeug aus dem Hotel angefahren kommen, wußte sich schon im Flugzeug, morgens zu Hause. Gesine war bereit, aufzugeben. Unter solchen Leuten ist nicht zu leben.
Die westdeutsche Regierung will die Verjährung für Morde und Massenausrottung in der Nazizeit ganz und gar aufheben, vielleicht.
Die leichte Artillerie kann man mit der Post bestellen, aber für eine Pistole braucht man einen Waffenschein, und sie traut sich nicht zur Polizei.
25. August, 1967 Freitag
Seit gestern abend fiel Regen in die Stadt, dämpfte das Trampeln der Wagen auf der Schnellstraße am Hudson zu flachem Rauschen. Morgens ist sie aufgewacht vom Schlürfen der Autoreifen auf dem triefenden Damm unterm Fenster. Das Regenlicht hat Dämmerung zwischen die Bürokästen an der Dritten Avenue gehängt. Die kleinen Läden im Fuß der Hochhäuser schicken geringes, dörfliches Licht in die Nässe. Als sie die Neonbatterie in der Decke ihres Arbeitsraums einschaltete, malte das vom Dunklen zusammengedrückte Licht einen Blick lang Wohnlichkeit in die kantige Zelle. An diesem Tag soll das Kind aus dem Ferienlager zurückkommen.
Abends sind die Stirnen der Bank, wenig oberhalb ihres Stockwerks, mit Nebel verhängt. Von der Straße gesehen blinken die Fenster der Direktion wässerig, untergehende Schiffe.
Auf das Kind wartet sie am Abend im Imbiß-Saal des Busbahnhofs an der George Washington-Brücke, rauchend, in fauler Unterhaltung mit der Serviererin, die Zeitung unterm Ellenbogen. Die Zeitung liegt im selben Knick, in dem sie das Papier unterm Regendach des Kiosks herausgefischt hat, aufgespart für die Stunde Wartens. Sie erlaubt sich, nicht auf der ersten Seite anzufangen, sondern aus dem Inhaltsverzeichnis Meldungen auszusuchen.
Ein Bundesgericht hat Anklage erhoben gegen fünfundzwanzig Personen wegen der 407 000 Dollar in Reiseschecks, die im vorigen Sommer vom Flughafen J. F. Kennedy verschwunden sind. Sie haben den Mann, der die Schecks zum Viertel ihres Wertes weiterverkaufte, auch den, der sie für die Hälfte absetzte, und die Einwechsler, aber sie haben nicht den, der sie tatsächlich vom Gepäckkarren geschubst hat; der ihnen vermutlich Bescheid gegeben hat, ist am 11. Juli erschossen in einem Graben bei Monticello gefunden worden. Die Mafia telefoniert.
Das Kind hat ihr eine Postkarte mit der Zeit der Ankunft geschickt, es ist eine Fotografie, auf der sie zu sehen ist mit anderen Kindern in einem Ruderboot. Marie hat ein Bein im Wasser hängen, und um das Schienbein hat sie einen breiten, schwärzlichen Verband. Sie blickt angstlos, still zwischen den Grimassen der anderen. Sie ist mit dem Schienbein gegen die Bindung des Wasserskis geknallt. Sie mißt vier Fuß zehn Zoll. Ihre Schrift hat die Bogen und Schleifen der amerikanischen Vorlage. Beim Malnehmen schreibt sie den Multiplikator unter, nicht neben den Multiplikanden. Sie denkt in Fahrenheitgraden, in Gallonen, in Meilen. Ihr Englisch ist dem Gesines überlegen in der Artikulation, der Satzmelodie, dem Akzent. Deutsch ist für sie eine fremde Sprache, die sie aus Höflichkeit gegen die Mutter benutzt, in flachem Ton, mit amerikanisch gebildeten Vokalen, oft verlegen um ein Wort. Wenn sie achtlos Englisch spricht, versteht Gesine sie nicht immer. Wenn sie fünfzehn ist, will sie sich taufen lassen, und sie hat die Nonnen in der Privatschule am oberen Riverside Drive dazu gebracht, sie M’ri zu nennen statt Mary. Allerdings sollte sie von dieser Schule verwiesen werden, weil sie die Plakette GEHT RAUS AUS VIET NAM nicht im Unterricht abnehmen wollte. Sie steigt aus der blauen Schuluniform mit dem Wappen auf dem Herzen, sobald sie nach Hause kommt; sie hat eine Vorliebe für enge Hosen aus weißem Popelin, deren Saum sie mit einem Schälmesser abtrennt, und für Turnschuhe. Sie hat kaum eine Freundschaft aus den sechs hiesigen Jahren aufgegeben, sie spricht noch von Edmondo aus dem spanischen Harlem, der seine Gefühle schon im Kindergarten bloß mit Schlägen ausdrücken konnte und 1963 fürs Leben in eine Klinik kam. In vielen Wohnungen entlang des Riverside Drive und der West End Avenue ist sie über Nacht geblieben. Sie ist begehrt als Aufpasserin für kleine Kinder, sie ist aber streng gegen kleine Kinder, bisweilen derb. Sie hat das Ubahnsystem Manhattans im Kopf, sie könnte als Auskunftperson gehen. Was sie in ihrem Zimmer auf der Maschine schreibt, bewahrt sie auf in einer Mappe, die sie mit unfälschbaren Schleifen zubindet. Sie geht heimlich an den Kasten mit Gesines Fotografien, sie hat sich von ihrem Taschengeld ein Bild kopieren lassen, auf dem Jakob und Jöche zu sehen sind, vor der Lokomotivführerschule in Güstrow. Sie hat ihre Freunde in Düsseldorf vergessen. Westberlin kennt sie aus der Zeitung. Viele Geschäfte auf dem Broadway sind ihr tributpflichtig, Maxies mit Pfirsichen, Schustek mit Scheibenwurst, der Schnapsladen mit Kaugummi. Sie wippt in den Knien, wenn sie sich versprochen hat und gesagt, daß Neger eben Neger sind, sie wippt in den Knien und bewegt die aufgestellten Handflächen wie schiebend gegen Gesine und sagt: O. K.! O. K.!
Auf der zweiten Seite der Zeitung ist ein Bild, das einen amerikanischen Piloten zeigt, der auf einer Karte erklärt, wo er zwei nordvietnamesische Piloten abgeschossen hat; man sieht ihn im Profil, seine Lippen von den Zähnen gezogen, er scheint schlapp und befriedigt zu lächeln. Die amtlichen Toten der Amerikaner stehen heute auf der zwölften Seite, sieben Zeilen ohne Zusammenhang mit den Nachrichten darüber. »Ein Mann aus Long Island unter den Toten« sagt die Überschrift. In der Meldung sind es dann achtundzwanzig.
Marie sagt:
– Meine Zöpfe sind nicht deine Zöpfe, und ich schneide sie ab, wann ich will.
– Mein Großvater war wohlhabend.
– Mrs. Kellogg rasiert sich.
– Ich kann Blut sehen. Ich will Ärztin werden.
– Meine Mutter denkt, daß die Neger gleiche Rechte haben, und da hört sie auf zu denken.
– Neger haben auch einen anderen Körperbau als wir.
– Präsident Johnson ist in der Hand des Pentagons.
– James Fenimore Cooper ist der Größte.
– Mein Vater war Delegierter bei der Internationalen Fahrplankonferenz in Lissabon. Er vertrat die Deutsche Demokratische Republik.
– Düsseldorf-Lohausen ist eine Drehscheibe des internationalen Luftverkehrs.
– Meine Freunde in England schreiben mir zwölfmal im Jahr.
– Meine Mutter ist im Bankfach.
– Meine Mutter ist aus einer Kleinstadt an der Baltischen See, man muß sie das nicht fühlen lassen.
– Meine Mutter hat die schönsten Beine auf dem ganzen Fünferbus, oberhalb der 72. Straße.
– Väter haben so einen verhungernden Blick.
– Bring our boys home!
– Schwester Magdalena ist eine Sau.
– John Vliet Lindsay ist der Größte.
– Meine Mutter fliegt immer mit mir in derselben Maschine, damit wir zusammen sterben.
– Wenn John Kennedy lebte, wäre alles besser.
– Meine besten Freunde sind Pamela, Edmondo, Rebecca, Paul und Michelle, Stephen, Annie, Kathy, Ivan, Martha Johnson, David W., Paul-Erik, Bürgermeister Lindsay, Mary-Anne, Claire und Richard, Mr. Robinson, Esmeralda und Bill, Mr. Maxie Fruitmarket, Mr. Schustek, Timothy Shuldiner, Dmitri Weiszand, Jonas, D. E. und Senator Robert F. Kennedy.
– Meine Mutter kennt den schwedischen Botschafter.
– Heirate doch, aber ich will keinen Vater.
– Ich kann Spanisch besser als meine Mutter.
– Nach zwei Jahren wollte meine Mutter zurück nach Deutschland, und ich habe gesagt: Wir bleiben.
Unter den nationalen Nachrichten verweist die New York Times nun noch auf den Tod eines Großindustriellen, der 1895 als Laufjunge mit anderthalb Dollar pro Woche angefangen hat und mit einem Vermögen von zweieinhalb Milliarden Dollar starb, und die Zeitung widmet seinem Andenken über zweihundert Zeilen.
Das Kind geht an der gläsernen Wand des Restaurants vorbei. Sie hat den Kopf nicht gewandt, geht weiter inmitten des Gedränges aus Eltern und Abschiedsverhandlungen. Sie ist mager geworden, ihre Haut ist trockengebrannt. Sie sieht älter aus als zehn Jahre. Sie trägt die Viet Nam-Plakette am Kragen ihrer Windjacke. Ihre Zöpfe schwenken ein wenig zu den Seiten, wenn sie in den Glasscheiben des Ausgangs hinter sich zu sehen versucht. Sie bleibt stehen und wendet sich um, ohne daß ihre linke Schulter unter Gesines ausgestreckter Hand weggleitet.
Ich habe dich gesehen: sagt sie, alle Silben betonend, alle Worte gleich langsam. Sie wiederholt: I saw you, und diesmal liegt ein einzelner, triumphierender Sopranton auf dem Wort für gesehen. Sie sieht ihrem Vater nicht ähnlich.
26. August, 1967 Sonnabend
Zwei Unteroffiziere der Armee sind verhaftet, weil sie Herrn Popov von der Sowjetischen Botschaft und Herrn Krejew von den Vereinten Nationen geheime Dokumente übergeben haben, in Supermärkten, in Restaurants, ganz wie in den Filmen, und die Herren sind zu Luft außer Landes.
Bei Bombenangriffen in Nord-Viet Nam kamen die U. S. A. China bis auf 29 Kilometer nahe, und sie verloren das 660. Flugzeug, und der Kriegsminister sagt den erstaunten Senatoren: Mit Bomben kriegen wir die nicht an unseren Tisch.
Die Preise sind so gestiegen, im Juli mußten wir 4,6 Prozent mehr für Obst und Gemüse bezahlen als im Juni, und ein Mitglied der amerikanischen Nazipartei hat seinen Führer erschossen, als der seine Wäsche in einen Münzsalon brachte, in Arlington in Virginia, und Seifenflocken flatterten um den Toten.
Wäre sie hier geblieben, wenn nicht in der Wohnung an der Straße am Fluß? Sie wäre kaum geblieben, hätte sie nicht, ohne noch zu suchen, die schmale Anzeige gefunden, die drei Zimmer am Riverside Drive versprach, »alle mit Blick auf den Hudson«, zu haben auf ein Jahr für 124 Dollar im Monat. Die Stimme am Telefon klang erstaunt über Gesines Fragen. Gewiß war die Wohnung überlaufen mit Anwärtern, »aber wir warten auf jemand, den wir mögen«. Kinder waren zugelassen in dem Haus. »Sollten Sie farbig sein, kommen Sie unbesorgt.« Gesine war auf ihrem ersten Besuch in New York im Fünferbus den Riverside Drive hinuntergefahren, dem inneren Rand einer ausgedehnten Kunstlandschaft, die mit einer Promenade am Fluß beginnt, landeinwärts geht mit einer Schnellstraße aus getrennten Fahrbahnen und nahezu gärtnerischen Zufahrtschleifen, mit einem geräumigen, hügeligen Park fünfzig Blocks lang, mit Denkmälern, Spielplätzen, Sportplätzen, Liegewiesen und bankgesäumten Spazierwegen. Erst dann rahmt den Park die eigentliche Straße, die an vielen Stellen gekrümmt ist, über zierliche Bodenbuckel schwingt, schmale Abfahrtfinger hinter wiederum Grüninseln zu den Häusern ausstreckt, ein Unikum in Manhattan, eine Veranstaltung von Gartenkunst, eine Straße mit Aussicht auf Bäume, auf Wasser, auf Landschaft. Gesine hatte sich damals gewünscht, jemals zu wohnen in einer der hohen Burgen des Wohlstands, reich geschmückt im orientalischen, italienischen, ägyptischen, immer prächtigen Stil, eher ehrwürdiger durch Verwitterung, und sie hatte die Straße für nicht erschwinglich gehalten.
Der Broadway, wo er die 96. Straße kreuzt, ist ein Marktplatz aus meist kleinen Häusern, mit viel Laufkundschaft unterwegs in der irischen Bar, dem Drugstore an der Südwestecke, dem Eßgeschäft gegenüber, am Zeitungskiosk, und damals und heute standen abgerissene Männer an den Hauswänden, Hehler wie Diebe, Betrunkene, Irre, viele afrikanischer Abstammung, arbeitslos, krank, manche bettelnd. Die Sprachen auf diesem Broadway sind vielfältig, verwirrend arbeiten Akzente aller Kontinente an Versionen des Amerikanischen, im Vorbeigehen zu hören sind das Spanisch aus Puertoriko und Cuba, das westindische Französisch, Japanisch, Chinesisch, Jiddisch, Russisch, die Jargons der Illegalen und immer wieder das Deutsche, wie es vor dreißig Jahren in Ostpreußen, Berlin, Franken, Sachsen, Hessen gesprochen wurde. Das Kind hörte eine hochbusige Matrone, altmodisch in einem großblumigen Kleid mit Schleifen, auf deutsch einreden auf den kleinen Mann, der bekümmert unter seinem schwarzen Hut neben ihr schlich, und das Kind blieb vergeßlich stehen, merkte Gesines Hand erst nach einer Weile ziehen. Es war ein weißlicher Vormittag, mit vielen Leuten auf der Straße, die sich vorsichtig gegen die von Feuchtigkeit verdickte Luft bewegten, und die Kreuzung versprach die Erinnerung an Italien für viele Morgende. Die 97. Straße, abfallend nach Westen, war düster zwischen den alterskranken schmächtigen Hotels, schmutzig mit verschleimtem Abfall im Rinnstein, fleckigen Säcken und verbeulten Mülltonnen auf dem Bürgersteig, und öffnete sich an ihrem Ende auf ein weites schwingendes Feld aus dem fließenden Damm des Riverside Drive, Wiesenhängen, dem walddichten Sommerpark. In dem Spielplatz sprangen Kinder unter glitzernden Wasserstrahlen umher. Im Schatten am Parkgitter lagen und saßen Familienrunden auf dem kühlen Gras. Hinter den fülligen Blattwolken hielt sich das blaugraue Bild des jenseitigen Ufers, des meilenbreiten Flusses. Sie standen eine Weile gegenüber dem Haus aus gelben Steinen, um dessen Fuß ein Band exotischer Stiermuster geschlungen war. Zu wohnen an dieser Stelle schien so weit vom Griff, Gesine begann Teile ihres Geldes in Bestechungssummen aufzuteilen, sah sich in umständlichen, gefährlichen Verhandlungen.
Wenn ich jetzt dich vorschicken könnte
Du sagst: Es soll Ihr Schade nicht sein, mein Herr. Du sagst: Die Vorzüge dieser Wohnlage bewegen mich, mein Herr, Ihnen meine Erkenntlichkeit zu versprechen.
So hast du nie reden können.
Die Wohnung beginnt mit einem winzigen Flur, dessen linke Seite eine Küche in der Wand hat und mit dem wuchtigen Kühlschrank endet. Der Flur öffnet sich nach rechts in ein großes Zimmer, in dem zwei Mädchen Taschenbücher in Kartons packten, in Gesines Alter, eine mit einem dänischen, eine mit einem schweizerischen Akzent, die beide zuerst das Kind begrüßten, ernsthaft und höflich, wie eine Person. Dies Zimmer geht mit zwei Fenstern in den hellen freien Raum über der Straße, auf den Park. Nach rechts ist die Wohnung fortgesetzt mit einem kleineren Zimmer hinter Flügeltüren mit verhängten Glasscheiben, und es hat ein Fenster gegen den Park. Hier hatte die Dänin ihr Bett. Auf der anderen Seite des Flurs, neben dem Bad, das ein Fenster auf den Park hat, ist hinter einer festen Tür das frühere Zimmer der Schweizerin, mit einem Fenster auf den Park. Im Winter ist durch das kahle Geäst das Steilufer New Jerseys zu sehen, und die Breite des Flusses, dunstige Luft können die architektonische Wüste auf der anderen Seite verwischen in das Trugbild unverdorbener Landschaft, in die Einbildung von Offenheit und Ferne. Die beiden Mädchen waren Stewardessen, die nach Europa versetzt werden sollten. Sie wollten ihre Möbel zurücklassen können auf ein Jahr. Sie wollten die Wohnung gleich übergeben. Sie sollte nichts kosten als die Miete. Sie fragten Marie, ob sie hier bleiben wolle, und Marie sagte: »Yes«. Der Hausverwalter, ein schwerer förmlicher Neger mit einem strahlenden britischen Akzent, gab auf den Cent genau auf Gesines Anzahlung heraus. Die Mädchen luden zum Mittagessen ein und ließen sich beim Packen helfen und halfen die Koffer aus dem Hotel holen, und das Kind schien betrübt, als sie nachts zum Flugplatz fuhren. Die kamen nicht wieder nach einem Jahr, aber wir besuchen die Dänin in den Ferien. Wir hatten eine Wohnung, und fragten nicht weiter. An die Stelle der Fabrikmöbel sind in den sieben Jahren viele handgemachte gekommen, zuerst in Maries Zimmer, dem schweizerischen, dann auch im mittleren, schwarzbraunes Holz, ein lindgrünes verglastes Bücherregal, blaue Rupfenvorhänge, ein flauschiger Teppich, auf dem das Kind bäuchlings aus der Zeitung vorliest, das Kinn auf den Händen, pendelnd mit den Beinen. Den ganzen Tag sitzt um die Wohnung ein ebenmäßiges Feld aus Regenrauschen. Hier wird es keine Überschwemmungen geben.
Marie sammelt Bilder aus der Zeitung, und an diesem Tag schneidet sie das aus, das im Vordergrund die auf die Seite geworfene Leiche des Naziführers neben seinem Wagen zeigt, im Hintergrund auf dem Dach des Waschsalons einen Polizisten an der Stelle, von der der andere Nazi schoß. »Der Rabbi Lelyveld« liest sie vor: »sagt, der Naziführer sei eher ein Ärgernis als eine Gefahr gewesen«. Das Kind sagt auf englisch, in einem belehrenden Ton: Ich verstehe am Unterschied des Rabbis, was er nicht ausspricht.
27. August, 1967 Sonntag
Die Ostdeutschen an der Macht sagen: Soeben führen wir die Fünftagewoche zu 43¾ Stunden ein, eine einzigartige sozialistische Errungenschaft. Die amerikanische Nazipartei sagt: Die Leiche unseres Führers gehört der Partei. Die Frau des verhafteten Unteroffiziers sagt: Das kann doch nicht wahr sein, mein Mann ist kein Spion. Die New York Times sagt: In den U. S. A. wurde die Vierzigstundenwoche 1938 eingeführt.
Und das Wetter in Nord-Viet Nam war wieder gut genug für Bombenangriffe, und das Pentagon läßt durchblicken, daß die ja ihre eigenen Maschinen in China verstecken, und gestern morgen überfielen drei Männer das Schuyler Arms Hotel in der 98. Straße, schossen den Nachtportier an und entkamen mit 68 Dollar. Das war gegen drei Uhr, zwei Blocks von hier.
Und die New York Times widmet der Tochter Stalins, beginnend auf der ersten Seite, mehr als acht volle Spalten, 184 Zoll. Diese ungeratene Tochter Etzels saß demnach bei den Goten auf Long Island, in einem Garten unter einer Schwarzeiche, und sagte: Sie sei im allgemeinen für die Freiheit.
Sie sagt: übermittelt die New York Times: Ich glaube, daß Leute, wenn sie frei sind, zu tun, was immer sie wollen, und auszudrücken, was immer sie wollen, und sogar frei sind, Aufstände zu machen, - sie tun es.
Sie meint die Aufstände der Neger in Detroit.
Sie trug also ein einfaches weißes Kleid und beige Schuhe, als sie im Kreis von Freunden und Journalisten auf eine gelöste und muntere Weise Gedanken äußerte. Die New York Times hält für nötig, daß wir dies wissen.
Die Hoffnung des Heils sagt: Ich mag Hunde lieber als Katzen. Ich hatte mal einen Hund - aber jetzt nicht mehr.
Auf die Frage, ob sie ein Bankkonto besitze, antwortet die Tochter des Führers des sozialistischen Lagers mit ja. Dann kichert sie, und fragt zurück: Sie auch?
Die New York Times bringt in unsere Erfahrung, daß der Flüchtling aus Neigung hat lernen müssen, wie man Schecks ausstellt.
Die Tochter des größten sozialistischen Staatsmannes sagt: Obwohl ich immer eine persönliche Bindung an meinen Vater fühlte, war ich niemals ein Bewunderer dessen, was als System »Stalinismus« genannt wurde.
Sie hat da um ein Glas Wasser gebeten, »mit Eis, bitte«.
Über ihre Kinder sprach sie also mit gesenkter Stimme, aufs Gehölz am Rande des Gartens hinausblickend.
Sie sagt: Der wichtigste schlimme Einfluß in meines Vaters Leben war, was ihn die Priesterschaft aufgeben und zum Marxisten werden ließ.
Sie sagt: Ich glaube, ein religiöses Gefühl ist angeboren, so wie man zum Dichter geboren ist.
Die New York Times: sagt die New York Times: wird am 10. September beginnen, Auszüge aus dem Buch der Tochter Stalins zu drucken. Sie sagt es weder am Anfang noch am Ende, sie sagt es beiläufig und am Rande. Die New York Times hat Vertrauen auf ihre Leser.
28. August, 1967 Montag
In einem Bericht über abgestimmte Feuerüberfälle des Viet Cong im ganzen Süden des Landes nennt die New York Times für diese Seite an Verlusten (Toten oder Verwundeten) aus Cantho 268 (später 248), aus Hoian 79, aus Hue 1, aus Quangda und Dienban 53 oder mehr, nahe Pleiku mäßige, aus Banmethuot 13, nahe Saigon leichte, und gibt als Endsumme 355.
Jerichow zu Anfang der dreißiger Jahre war eine der kleinsten Städte in Mecklenburg-Schwerin, ein Marktort mit zweitausendeinhunderteinundfünfzig Einwohnern, einwärts der Ostsee zwischen Lübeck und Wismar gelegen, ein Nest aus niedrigen Ziegelbauten entlang einer Straße aus Kopfsteinen, ausgespannt zwischen einem zweistöckigen Rathaus mit falschen Klassikrillen und einer Kirche aus der romanischen Zeit, deren Turm mit einer Bischofsmütze verglichen wird; lang und spitz läuft er zu, und wie die Mütze eines Bischofs hat er Schildgiebel an allen vier Stirnen. Um den Marktplatz im Norden, zur See hin, standen ein Hotel, die Bürgermeisterei, eine Bank, die Raiffeisenkasse, Wollenbergs Eisenwarenlager, Papenbrocks Haus und Handlung, die alte Stadt, hier gingen Nebenstraßen ab, Kattrepel, Kurze Straße, die Bäk, Schulstraße, Bahnhofstraße. Am südlichen Ende, um Kirche und Friedhof herum, war die erste Stadt gewesen, fünf Gänge zwischen Fachwerkhäusern, bis sie abbrannte, 1732, erst im neunzehnten Jahrhundert wieder zugestellt mit gedrungenen Backsteinhäusern, Schulter an Schulter unter sparsamen Dächern, da steht heute das Postamt, das Konsumkaufhaus, die Ziegelei hinter dem Friedhof, die Ziegeleivilla. Um die Stadt herum waren viele Scheunen übrig, die Nebenstraßen waren bald Feldwege, und neben Schaufenstern in der Hauptstraße standen hölzerne Hoftore. Da, auf hundertzwanzig Hektar, wohnten Ackerbürger, Kaufleute, Handwerker. Cresspahl kam von Süden, auf der Gneezer Chaussee, und fuhr über die Hauptstraße am Marktplatz vorbei heraus aus Jerichow, denn er fing nun an, die Stadt zu erwarten. Da war die Stadt zu Ende, bis zur See lagen Felder.
Jerichow war keine Stadt. Es hatte ein Stadtrecht von 1240, es hatte einen Gemeinderat, es bezog Elektrizität vom Kraftwerk Herrenwyk, es hatte ein Telefonnetz mit Selbstanschluß, einen Bahnhof, aber Jerichow gehörte der Ritterschaft, deren Güter es umgaben. Das war nicht mit dem Brand gekommen. Die Ritterschaft hatte den Bauern, die das Land urbar gemacht hatten, ihre Höfe genommen, ihre Felder den eigenen zugeschlagen, sie leibeigen gemacht, und das schwächliche, über die Ohren verschuldete Fürstenhaus hatte ihnen das Recht dazu im grundgesetzlichen Erbvergleich von 1755 bestätigt. Von den Dörfern, die Jerichow stark gemacht hatten, gab es noch drei, winzige, ärmliche Siedlungen. In diesem Winkel regierte der Adel, Arbeitgeber, Bürgermeister, Gerichtsherr über seine Tagelöhner, als Raubritter berühmt geworden, als Unternehmer wohlhabend. Jerichow war wiederum nicht weit von dem Rodedorf, als das es angefangen hatte. Von der Schiffahrt war es ausgeschlossen durch die großen Häfen, seine Entfernung vom Meer. Wo ein Hafen für Jerichow hätte sein können, saß das Fischerdorf Rande, schon am Anfang des Jahrhunderts reich genug für Grand Hotels, Erbgroßherzog, Stadt Hamburg. Jerichow war eine Station geblieben auf dem Weg nach Rande, früher die Diligencen wie jetzt die Omnibusse gaben die zahlkräftigen Badegäste nicht ab. Der Handel kam nicht über die schmalen Chausseen, die großen Straßen zogen tief im Süden an ihm vorbei. Der Ritterschaft war Jerichow so recht, als ein Kontor, ein Lagerplatz, ein Handelsort, eine Verladestelle für den Weizen und die Zuckerrüben. Die Ritterschaft brauchte keine Stadt. Jerichow bekam seine Bahnlinie nach Gneez, zur Hauptstrecke zwischen Hamburg und Stettin, weil die Ritterschaft das Transportmittel brauchte. Jerichow war zu arm, sich eine Kanalisation zu bauen; die Ritterschaft brauchte sie nicht. Es gab kein Kino in Jerichow; die Ritterschaft war nicht für die Erfindung. Jerichows Industrie, die Ziegelei, war ritterschaftlich. Ihnen gehörte die Bank, die meisten der Häuser, der Lübecker Hof. Der Lübecker Hof hatte eine Klärgrube. Die Ritterschaft kaufte in Jerichow Ersatzteile für ihre Maschinen, sie benutzte die Verwaltung, die Polizei, die Rechtsanwälte, Papenbrocks Speicher, aber ihre großen Geschäfte machte sie in Lübeck ab, ihre Kinder schickte sie auf Internate in Preußen, den Gottesdienst hielten sie in ihren eigenen Kapellen und begraben ließen sie sich hinter ihren Schlössern. In der Erntezeit, wenn der Weg nach Ratzeburg oder Schwerin zu weit war, fuhren die Herren abends zum Lübecker Hof und spielten Karten an ihrem eigenen Tisch, gewichtige, leutselige, dröhnende Männer, die sich in ihrem Plattdeutsch suhlten. Cresspahl bei seinem Bier hielten sie, wegen des großstädtischen Kennzeichens an seinem Auto, für einen Handelsreisenden.
Seine Hauptstraße, die schmale Schneise aus der Rodezeit, nannte Jerichow die Stadtstraße.
Cresspahl erkundigte sich beim Frühstück nach dem Wetter. Er ging in die kleinen Läden, kaufte Schreibpapier oder Hemden von der besseren Sorte und fragte nebenbei. Er stand eine Weile auf dem Weg hinter dem Hof von Heinz Zoll, der hier die besseren Tischlerarbeiten machte, und besah sich das Holzlager im offenen Schuppen. Er fing an, sein Bier im Krug zu trinken, bei Peter Wulff. Peter Wulff war in seinem Alter, weniger prall damals, ein nicht beflissener, maulfauler Wirt, der Cresspahls geduldiges Warten beobachtete wie der ihn. Cresspahl schrieb eine offene Postkarte nach Richmond und gab sie dem Hoteldiener zum Einwerfen. Er besuchte den Rechtsanwalt Jansen. Er ging nach Rande und aß im Hotel Stadt Hamburg zu Abend. Er las alle Anzeigen im Gneezer Tageblatt auf der Seite für Jerichow und Umgebung. Er ging nicht langsamer, wenn er an Papenbrocks Einfahrt vorbeikam, aber seine Gänge brachten ihn da vorbei, und er wußte nach einer Weile, daß der junge Mann, der im Hof beim Sackabladen die Aufsicht führte, Horst Papenbrock war, der Erbe, damals 31 Jahre. Zwischen fliehendem Kinn und fliehender Stirn war Horsts Gesicht so spitz wie ein Fisch. Cresspahl sah den alten Papenbrock durchs offene Fenster am Schreibtisch, schwitzend über seinem behaglichen zarten Bauch, so heftig nickend vor Höflichkeit, als dienerte er im Sitzen. Offenbar handelte er mit der vornehmen Kundschaft nicht gern, oder nicht lange, Papenbrock, der so knausrig war, daß er sich einen Personenwagen nicht leistete und die Familie im Lieferauto zum Kaffeetrinken nach Travemünde fuhr. Meine Mutter sah Cresspahl nicht. Er sah meine Großmutter in der Bäckerei verkaufen helfen, eine ergebene flinke Alte mit einer etwas süßlichen Redeweise, besonders zu Kindern. Hier grüßte Cresspahl im Vorbeigehen, durch die offene Tür.
und ich war nie ein Schaf, Gesine.
Dich haben sie auf die Seite geschmissen, dir haben sie die Pfoten zusammengebunden, dir haben sie den Hals mit Knien gegen die Tenne gedrückt, dir haben sie mit einer stumpfen Schere die Wolle abgerissen, und du hast das Maul nicht aufgemacht, Louise geborene Utecht aus der Hageböcker Straße in Güstrow, du Schaf.
Cresspahl wußte, daß Horst Papenbrock und der Ackerbürger Griem Nazis waren und zu ihren Schlägereien nach Gneez mußten, weil die Sozialdemokraten in Jerichow ihre Nachbarn, Verwandten, Stadtverordneten waren. Er wußte, daß Papenbrock mit seiner Getreidehandlung, seiner Bäckerei, seinen Lieferungen aufs Land der reichste Mann in Jerichow war, und daß er außerdem noch Geld verlieh. Er wußte, daß die Geschichte hier lediglich eine Franzosenschanze hinterlassen hatte, an der Küste, acht Kilometer entfernt. Er wußte, daß noch ein Tischler sich in Jerichow nicht halten konnte.
Jerichow ist umgeben von Weizenfeldern, im Süden hinter dem Bruch ist der Gräfinnenwald, dann fassen übermannshohe Hecken Wiesen ein. Das Wetter ist das der See. Der meiste Wind ist westlich, vornehmlich im hohen Sommer und Winter. Hier ist es kühl. Hier sind die meisten trüben Tage im Land. Hier regnet es seltener als anderswo in Mecklenburg, und Gewitter kommt nicht oft vorbei. Die Apfelblüte ist spät, Mitte Mai, der Winterroggen ist reif am 25. Juli. Der Frost setzt später ein und verschwindet früher als im übrigen Land, aber er dringt kaum in den Boden, denn die Luft ist immer bewegt vom Wind, hier.
29. August, 1967 Dienstag
An der Dritten Avenue, nördlich der 42. Straße, sind noch Bürgerhäuser aus dem vorigen Jahrhundert stehengelassen, vier und fünf Stockwerke mit einstmals vornehmen Fronten aus braunem Sandstein oder teuren Ziegeln, aber im Stein sitzt fetter Ruß, die Fenster sind schmierig und verstaubt, und nur noch im Erdgeschoß leben kleine Geschäfte, Imbißhallen, Bars, die den toten Baukörper über sich mit ihren Leuchtschriften und Markisen verstellen. Die Geschäfte haben genug für Laufkundschaft, Ansässige können sie kaum bedienen. Die Zukunft der Straße sollen die Bürohäuser aus Stahl und Glas sein, die auf blockbreiten zehnstöckigen Gesäßen Stufen ansetzen, vom zwanzigsten Stockwerk an in immer gleichen Schichten hochgestapelt sind, noch zwanzig Meter breit in der fünfzigsten Etage. Das Mattglas und Metall zwischen den Fensterbändern kann dunkelblaue, graue, grüne, gelbe Farben zeigen, bei einigen Gebäuden sind auch Mauersteinsäulen an die tragenden Streben geklebt, einen Unterschied machen noch die Namen auf der ebenerdigen Verkleidung aus Marmor. Die Häuser sind leicht demontierbar, und ihre Namen sind nicht eingemeißelt und nicht eingemauert, sondern aufgekittet oder angeschraubt, bequem abzunehmen.
Das Haus, in dem Miss Cresspahl ihr Geld verdient, besteht aus einem zwölfstöckigen Sockel, der von einer Straße bis zur anderen reicht, und darüber einer gestaffelten Terrasse, auf die ein glatter Turm aufsetzt. Das Glas zwischen den blanken Rippen ist mit blaugrauen Bändern umwickelt. Die meisten Fenster sind von Jalousiestäben blind, noch schimmert wenig Neonlicht zwischen den Ritzen. Von der gegenüberliegenden Straßenseite, den Kopf im Nacken, sollte sie ihre beiden Fenstereinheiten ausmachen können, aber sie verzählt sich regelmäßig. Auf der Ebene der Straße ist die äußere Schicht des Hauses zur Hälfte eingerichtet als eine gewöhnliche Bank hinter übermannshohen Schaufenstern, die weder getönt noch gerillt noch verhängt sind und den Blick hineinziehen zu den kunstledernen Sitzmöbeln, Rauchertischen, Schreibtischen auf Teppichinseln, Schreibpulten, Schalterreihen unter dem Auge automatischer Kameras, der hochpolierten Pfannentür des Tresorraums. Die Bank, ein Wohnzimmer so groß wie ein Wartesaal, ist noch leer. In der anderen Hälfte des Hauses sitzt zu ebener Erde ein Restaurant, das seine Kunden mit lindgrünen Vorhängen vor dem Licht des Tages schützt. Der Haupteingang mit seinen vier Schwingtüren zieht so viele Leute vom Bürgersteig, daß der Trott der Passanten an dieser Stelle aus dem Schritt kommt. Hinter einer Wand aus hellem Marmor mündet das Foyer nach links in drei Fahrstuhlgassen, im Hintergrund geht der Trakt der Hausmeisterei ab, die rechte Wand nimmt ein langer Stand mit Zeitungen, Süßigkeiten und Rauchwaren ein. Jede Fahrstuhlgasse wird einzeln vom Aufseher gesteuert, dessen blaugraue Uniform über dem Herzen in gestickter Schreibschrift den Namen des Unternehmens trägt. Es gelingt ihr, ihm zuzunicken. Beim Eintreten in eine Kabine, über der Grünlicht eine Aufwärtsfahrt anzeigt, sieht sie die in den Fußboden eingelassene Nummer des Hauses, die dem Benutzer anzeigen soll, ob er es verwechselt hat. Unter den etwa fünfundzwanzig Insassen sieht sie heute kein bekanntes Gesicht. Als die stählernen Doppeltüren vor ihr zusammenklappen, ist es neun Minuten vor neun Uhr.
Die Nachrichtentoten dieses Tages sind zwanzig Amerikaner, fünfzehn Südvietnamesen, achtundneunzig Nordvietnamesen, die letzteren geschätzt. Aus der Liste der amtlichen Toten führt die Zeitung nur zwei an, die zufällig aus dem Staat New York waren, als verschlüge die genaue Gesamtzahl ja doch nichts gegen einhundertfünfundneunzig Millionen Landesbürger. Der erschossene Nazi darf auf einem militärischen Ehrenfriedhof begraben werden, denn ihm ist lediglich Mordhetze gegen Neger und Juden nachzuweisen. Eine Mrs. Hart ist dagegen, dies Grab neben denen derer zu wissen, die im Krieg gegen die Nazis gefallen sind. In Westfalen hat ein Prozeß begonnen gegen vier Deutsche, die im Konzentrationslager Mauthausen Häftlinge in eiskaltem Wasser ertränkt haben sollen. Mindestens eine Million amerikanischer Hausfrauen sind alkoholsüchtig. Und diesmal ist die Tochter Stalins in der Zeitung, weil sie für ein Fernsehinterview nicht 250 000 Dollar haben will. Sie macht es für umsonst. Sie scheint erheblichere Einkünfte vorauszusehen.
– Und wie war es im Büro, Gesine?
Mrs. Williams ist wieder da, und sie war nun nicht in Griechenland, aus Angst vor dem Militär. Die Angestellten wurden in einem dritten Rundschreiben aufgefordert, in der Mittagspause die Tische abzuschließen und Taschen bei jedem Gang mitzunehmen, wegen neuer Diebstähle auf dem neunten Stockwerk. Das neueste Gerücht ist, wir hätten Xerox gekauft. Mein Chef mußte am Nachmittag nach Hawaii, sein Sohn kommt dahin von Süd-Viet Nam zur Erholung.
– Und was stand in der Zeitung?
Mahalia Jackson liegt in Westberlin in einem Krankenhaus.
30. August, 1967 Mittwoch
Der Viet Cong brach in ein Gefängnis in Quangngai und befreite 800 Gefangene. Die Zeitung nennt die Namen von vier amtlichen Kriegstoten aus der näheren Umgebung, nicht aber die Zahl aller. Dem toten Nazi wurde der Weg zum Grab im Nationalfriedhof von Culpeper, Virginia, von einer Einheit Soldaten versperrt, weil die Partei nicht das Hakenkreuz vom Leichenwagen nehmen wollte; jetzt liegt er wieder beim Bestatter.
»Liebe Gesine.
Ich habe bis acht auf dich gewartet, dann hat Pamela Blumenroth mich zum Übernachten eingeladen. Bitte ruf nicht an.
Keine Post, außer für mich.
Was du brauchst ist im Eisschrank.
Mrs. Ferwalter ist sauer auf dich oder mich. Sie hat seit einer Woche nicht angerufen.
Wir müssen was mit D. E. machen. Er glaubt nicht, daß du allein in New Jersey warst.
Der Telefonverwechsler hat wieder zugeschlagen. Diesmal nannte er sich George und wollte mit einer Luise sprechen. Der Anruf kam aus Rhode Island.
Warst du allein in New Jersey?
Wenn du etwas Neues über den Zustand von Mahalia Jackson liest, bring es mir mit.
Diesen Griem in Jerichow, hast du den gekannt? Lebt der noch?
Ich habe in Wahrheit nur bis halb acht gewartet. Was ist das eigentlich für ein Büro, wo Leute behalten werden bis acht in der Nacht? Lohnt sich das für uns?
Mit affektioniertem Gruß,
Mary Fenimore Cressp. Cooper.«
Für »Eisschrank« benutzt sie ein britisches Slangwort, aus Treue zu London-Südost.