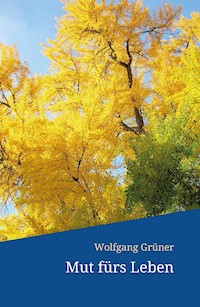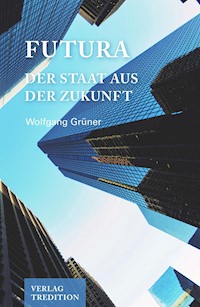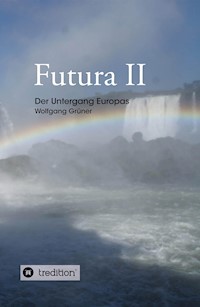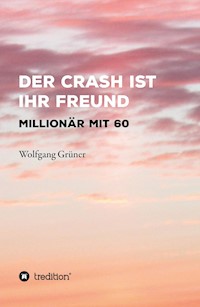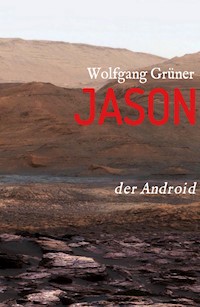
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft ist schon da! Die künstliche Intelligenz umgibt uns längst. Computer erstellen Diagnosen, Implantate leiten Blinde über die Straßen und lassen sie sogar ihre Freunde erkennen. Lahme spüren ihre Gliedmaßen wieder, Minikameras gleiten durch unsere Körper, Operationen erfolgen durch Automaten, die nur noch der Aufsicht bedürfen, Autos bringen uns automatisch ans gewünschte Ziel. Nur selten werden wir auch in der Zukunft Androiden wie Jason, also menschenähnlichen Wesen, begegnen. Je ähnlicher sie uns sind, desto teurer und aufwändiger werden sie. Die bisher schon häufigen Roboter, die in Maschinenhallen stehen, genau und zuverlässig schweißen, pressen und formen, werden zunehmend aufgerüstet. Tausende Firmen arbeiten daran, die zwar schnellen, aber dummen Großrechner in intelligente Wesen zu verwandeln, die unsere Arbeit unterstützen, aber auch Arbeitsplätze ersetzen. Das Buch zeigt einige der technischen Möglichkeiten der nächsten vierzig Jahre, soll aber auch Hoffnung geben. Eine glückliche Zukunft liegt in unserer Hand. Das Buch beschreibt eine Reise zum Mars, die Rettung der Menschen durch den Androiden Jason und die Zukunft der Erde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wolfgang Grüner
Jason
Der Android
Verlag tredition GmbH, Hamburg
Gewidmet allen Autoren, die mein Leben und mein Wissen mit ihren Büchern bereichert haben. Besonders danken möchte ich aber Rainer Kampenhuber und Maria Limberger, die mit ihren Anregungen zu diesem Buch beigetragen haben.
© 2019 Wolfgang Grüner
Umschlag: Martin Obereder
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
978-3-7482-6699-0 (Paperback)
978-3-7482-6700-3 (Hardcover)
978-3-7482-6701-0 (e-Book)
Kapitel 1: Jason und Äolus 2062
„Niedlich, diese Menschenkinder.“
„Ja, aber man sieht sie seltener als früher“, antwortete ihm Jason. Ihr automatisch gesteuertes Fahrzeug glitt fast lautlos an einem der wenigen Kinderspielplätze, wie sie genannt wurden, vorbei. Fasziniert beobachteten sie für einen Moment das sonderbare Spiel von drei Kindern, zwei Buben und einem Mädchen, die scheinbar ziellos umherhüpften. Zwei weitere kletterten in einer blauen Holzrakete herum, deren Düsen rot blinkten, ein kleiner, etwas unbeholfen wirkender Bub suchte nach Kastanien, die grün und stachelig zwischen den ersten abgefallenen Blättern lagen. Zwei Frauen mit schwarzen Kopftüchern waren in ihre Smartphones vertieft. Man spürte deutlich, dass der Sommer vorüber war.
Natürlich kannten sie die sonderbare Bewegungsform, die mit dem Wort Spiel umschrieben und vor allem von jüngeren Menschen ausgeübt wurde. Als Androiden hatten sie diese Phase des ziellosen Lernens nicht. Sie verließen ihre Fabrik voll funktionsfähig, arbeiteten und lernten fast Tag und Nacht, um ihre ohnehin schon riesige und vorprogrammierte künstliche Intelligenz beständig zu erweitern, Sprachen zu lernen und die komplizierte Psyche der Menschen zu verstehen. Oft chatteten sie mit Kindern. „Sie sind ehrlicher, sie zeigen ihre Gefühle, und sind viel sensibler. Ich bin schon manchmal gefragt worden, ob ich denn nie ausflippe. Ein Junge hat mich kürzlich einen Klugscheißer genannt, weil ich zu viele Ratschläge gegeben habe“, sagte Äolus zu Jason. Der lachte: „Ist mir auch schon passiert, eigentlich möchten sie keinen Rat, vor allem keinen solchen, wie sie ihn ohnehin von den Großen kriegen. Sie wollen oft nur ihrem Ärger Luft machen, einfach reden.“
Jason und sein Begleiter Äolus waren vom neuesten Typ der Androiden, die sich tatsächlich kaum von ihren menschlichen Vorbildern unterschieden. Beide hatten eine Haut, die sich so warm und verletzlich anfühlte wie die der Menschen, beide hatten sich ihnen in Bewegung und Verhalten völlig angepasst. Ihre eigentlichen Qualitäten steckten verborgen im Inneren, in ihrer millionenfachen Rechenleistung, ihren Sprachkenntnissen und einem Verstand, der den ihrer Vorbilder bei weitem übertraf. Ihre Überlegenheit hatte ihnen Freiheit und Reichtum gebracht. Sie waren zu selbständigen Unternehmern geworden und führten gemeinsam einen Betrieb für Raketentechnik, der tausende computergesteuerte Maschinen und ein paar hundert Menschen beschäftigte. Beide hatten sich auch mehrfach als Astronauten bewährt, ihre Interviews waren vor Jahren um die Welt gegangen.
Da sie durch ihre künstliche Intelligenz auch Gefühle besaßen, waren sie den Menschen durchaus dankbar und mochten sie. Ohne ihre Erfindungsgabe und die Millionen von Arbeitsstunden wären sie nicht in dieser Welt. Dass diese Hominiden nicht perfekt waren und nur selten rational handelten, nahmen sie hin. Schließlich liebten auch die Eltern ihre Kinder und behandelten sie mit viel Geduld und Fürsorge. Als Erzieher kümmerten sie sich jahrelang um deren Wohlergehen, selbst wenn diese frech und unbeholfen erschienen. Jason und andere Androiden fühlten sich diesen manchmal hilflosen und rückständigen Menschen nahe, noch dazu, da diese doch immer wieder überraschende Eigenschaften besaßen, die ihnen selbst noch fehlten. Sie ahnten, dass auch das Irrationale und all die kleinen und großen Dummheiten irgendwie Sinn hatten. Als künstliche Wesen waren sie selbst einerseits nicht Natur im überlieferten Sinn, andererseits bestanden sie aus denselben Atomen, wie die Menschen und Tiere auch. Jason empfand eine tiefe Sehnsucht, Teil der Natur zu sein, vielleicht gerade deshalb, weil er eben nicht biologisch herangewachsen war.
In den ersten Jahrzehnten des einundzwanzigsten Jahrhunderts hatten Google, Amazon, Apple, IBM und hunderte weitere Firmen an immer besseren Systemen mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, die mit KI abgekürzt wurde. Sprachassistenten verstanden das gesprochene Wort immer schneller und gaben richtige Antworten. Sie verstanden auch mehrere Sprachen gleichzeitig, wenn sie angesprochen wurden. Das war in mehrsprachigen Familien und bei Infodiensten ein deutlicher Fortschritt. Smartphones hatten sich zu Wundergeräten entwickelt, die mit ihrer Rechenleistung und Vielseitigkeit bald unentbehrlich geworden waren.
Die Entwicklung von Androiden kam immer öfter in die Schlagzeilen, da sich zahlreiche Firmen bemühten, menschenähnliche Roboter zu bauen. Um die Androiden bestmöglich an das menschliche Vorbild anzugleichen, wurden neben all den Ingenieuren Fachleute für die Mimik, Kosmetiker, Choreographen, Schauspieler, Mediziner und Modedesigner herangezogen. Selbst Spezialisten für die Absonderung von Tränen wurden eingesetzt, um den Androiden die Möglichkeit zu geben, Trauer und Mitgefühl auszudrücken. Die meisten Bürger dachten bei künstlicher Intelligenz zuerst an diese oder an Maschinen, die die Menschheit auslöschen würden. Dabei hatte die KI schon längst Einzug in den Alltag gehalten, befand sich aber meist nur auf unscheinbaren Chips und sah den Menschen überhaupt nicht ähnlich. Blinde Menschen wurden von winzigen Implantaten über Straßen und Plätze geführt oder sogar aufmerksam gemacht, wenn ihnen ein Bekannter entgegenkam. Autos parkten selbsttätig ein und kamen auf Wunsch vom Parkplatz bis zur Haustüre. Callcenter nahmen Bestellungen oder Beschwerden entgegen und niemand merkte, dass eine Maschine die bisher dort tätigen Frauen und Männer ersetzt hatte. Ärzte ließen ihre Röntgenbilder von Computern auf Krebsherde untersuchen, Operationscomputer arbeiteten präziser und ermüdungsfreier als die Chirurgen, die nur noch die Arbeit vorbereiteten und die Maschinen überwachten. Fast unbemerkt hatte sich die künstliche Intelligenz in das Leben der Menschen geschlichen.
In der Medizin wurde sie auch ohne Vorbehalt begrüßt. Gemeinsam mit der Gentechnik war es gelungen, einige bisher unheilbare Krankheiten zu heilen oder zumindest ihre Folgen zu mindern. Verlorene Gliedmaßen konnten durch lebensecht wirkende Prothesen ersetzt werden, die so funktionell und empfindsam arbeiteten wie die natürlichen, Impulse wurden direkt an Nerven weitergeleitet. Auf den einzelnen Patienten abgestimmte Therapiekonzepte gehörten inzwischen zur Alltagsroutine im Heilungsprozess. Selbst Hausärzte, von denen es nur noch wenige gab, mussten ihre Ordinationen mit leistungsfähigen Computern und Analysegeräten aufrüsten. Warteräume waren zu Diagnoseräumen geworden, in denen Avatare die eingegeben Symptome analysierten, Therapievorschläge unterbreiteten und für Standardprobleme Rezepte ausgaben oder gleich an einen Spezialisten verwiesen. Die Vorsorgemedizin hatte an Bedeutung gewonnen. Es ging immer weniger darum, kranke Körper irgendwie wieder hinzukriegen, sondern um die richtige Lebensweise, die Krankheiten und Gebrechen überhaupt vermied, oder später ausbrechende Stoffwechselkrankheiten bereits im Frühstadium erkannte. Ärzte waren zu Genanalytikern geworden, die wie Kriminalisten zukünftige Krankheiten aufspürten, Erbinformationen in Hochleistungscomputern verarbeiteten, oder überhaupt schon an den Genen herumschnipselten, um die Körperleistung zu optimieren. Nicht alle daraus entwickelten Möglichkeiten entsprachen den ethischen Richtlinien, aber wer konnte schon überprüfen, was in ausländischen Computern und Laboratorien ablief? Wer konnte ehrgeizige Wissenschaftler rechtzeitig einbremsen, wenn die sich vor der Erzeugung des Supermenschen wähnten? Wer konnte Millionäre daran hindern, sich in Spezialkliniken obskurer Länder ein Wunschbaby aus optimierten Chromosomen zusammenstellen zu lassen? Das boomende Geschäft mit Stammzellen hatte viele reelle, aber noch mehr dubiose Firmen angelockt. Da Stammzellen die Fähigkeit hatten, sich in jeden Zelltyp eines Körpers zu verwandeln, war das Grund genug, Gesetze zu umgehen, ethische Bedenken zu ignorieren und aus diesen Zellen Organe zu züchten und so teuer wie möglich zu verkaufen. Die vor Jahrzehnten entschlüsselte Struktur der DNA, die etwa drei Milliarden Nukleinsäuren mit einer für jeden Menschen typischen Reihenfolge enthielt, hatte den Wettlauf um die beste Technologie zu einem für alle leistbaren Preis gestartet. Die eigenen Kinder sollten einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen haben, der Ersatz einer erkrankten Niere oder der Bauchspeicheldrüse durch ein aus eigenen Zellen gezüchtetes Organ schien in greifbare Nähe gerückt. Selbst die verlängerte Lebenszeit war inzwischen Realität, der Traum von der ewigen Jugend vielleicht nur noch wenige Jahrzehnte von der Realisierung entfernt.
Auch die Nanotechnologie hatte riesige Fortschritte gemacht. Aber da sie naturgemäß mit winzigen und mit den Augen unsichtbaren Dingen zu tun hatte, war ihre rasche Entwicklung von vielen Menschen kaum bemerkt worden. Ob als Nanopartikel in Sonnencremen, auf schmutzabweisenden Oberflächen oder als Minimotoren, die kleiner als die Dicke eines Haares waren, fanden diese Winzlinge zahlreiche Anwendungen. Früher so lästige Untersuchungen wie die Koloskopie konnten durch Minikameras abgelöst werden, die man wie eine Tablette schluckte, winzige Detektoren bewegten sich selbst in den Blutbahnen und suchten nach Anzeichen von Krebs oder sonstigen Krankheiten. Das Aufschneiden der Haut bei Operationen wurde beinahe als barbarischer Akt gesehen, weil junge Patienten nur noch mikrochirurgische Eingriffe kannten. Da die Jugendlichen aber immer wehleidiger geworden waren, wurden selbst diese Fortschritte als ziemlich selbstverständliche Entwicklung angesehen.
Die Nachteile wurden oft in anderen Bereichen sichtbar. Ein Techniker von Google hatte schon vor Jahren gewarnt: „Je besser unsere Algorithmen werden, desto dümmer werden die Anwender.“ Womit er nicht Unrecht hatte. Für Hausaufgaben und selbst für wissenschaftliche Arbeiten wurde kritiklos gegoogelt und oft genug kopiert, ohne das eigene Hirn einzuschalten. Wo aber die eigene Leistung fehlte, war der Verlust des Arbeitsplatzes nahe. Automatische und häufig gleichartig wiederholte Tätigkeiten schaffte der Computer nun einmal besser, besonders dann, wenn er dabei von KI unterstützt wurde.
Eine weitere Gefahr bestand in Spielzeug wie Teddys oder Puppen, die direkt mit dem Internet verbunden waren. Die Kinder liebten diese klugen Freunde und Freundinnen und vertrauten ihnen alles an. Doch über ihren Zugang zum Netz boten diese ein offenes Tor für alle, die Kinder beeinflussen oder die Bewohner aushorchen wollten. Die Möglichkeit dazu wurde durch die Werbung schamlos genützt. Erstaunlicherweise kannten selbst paranoide Datenschützer zu wenig Vorsicht vor diesen Spionen, die sie sich freiwillig ins Haus geholt hatten.
Weltweite Kommunikation war für die Jugendlichen selbstverständlich geworden, fremde Sprachen wurden simultan übersetzt. Doch die meisten Kids aus Asien und Europa sprachen inzwischen neben ihrer Muttersprache ohnehin ein passables Englisch. Sie wuchsen damit einfach auf.
Städte, Straßen, Wohnhäuser und Geschäfte hatten sich stetig verändert. Viele Menschen zeigten vor der raschen Entwicklung Angst. Doch auch die Älteren gewöhnten sich langsam an die neuen automatischen Autos auf den Straßen. Die Probleme der Haftung bei Unfällen, auch wenn diese kaum noch vorkamen, führten zur Anpassung der Verkehrswege an die aktuellen Anforderungen. Auf vielen Straßen waren Radfahrer und Fußgänger verboten, dafür gab es mehr verkehrsfreie und fußgängerfreundliche Zonen. Die alten Benzinautos waren fast vollständig durch Wägen mit Elektromotoren oder Brennstoffzellen verdrängt worden. Je weniger Autos noch von Menschen gesteuert wurden, desto weniger Ampeln unterbrachen den Verkehrsfluss. Auch die Verkehrszeichen waren mit Funk aufgerüstet worden, um von den Fahrzeugen optisch und über elektromagnetische Signale bemerkt zu werden. Die vollautomatisch gesteuerten Fahrzeuge kommunizierten miteinander, reihten sich in kurzen Abständen hintereinander ein und produzierten durch ihre gleichmäßige Fahrweise kaum noch Staus.
Manche Kids, oder Fourties, wie sich viele der ganz Jungen nannten, flitzten mit ihren elektronisch gesteuerten Einrädern durch die Gegend, um ihren Freunden mit ihrer Geschicklichkeit zu imponieren und sich selbst noch einen Kick zu verschaffen, der ihr Blut in Schwung brachte. In allen Farben schillernd, mit einem Helm, der farbige Lichtsignale ausstieß, waren sie für die automatischen Fahrzeuge gut zu erkennen, sodass nicht einmal dann Unfälle passierten, wenn sie blindlings die Straßen querten. Straßenlaternen und sonstige Hindernisse wichen blöderweise nicht aus, was dann dennoch zu Stürzen und Hautabschürfungen führte. Damit waren sie allerdings die sportlichen Ausnahmen, denn die meisten Kids lümmelten auf Sofas und Parkbänken herum, mit Helmen und virtuellen Brillen auf der Nase, und jagten Phantome aus dem All oder rasten in Raumschiffen von Planet zu Planet, ohne sich von ihrer Bank zu bewegen. Es gehörte zum allgemeinen Konsens, Teil dieser Aufbruchsstimmung zu sein. Doch langsam wurden auch die Nachteile spürbar. Spielende Kinder, wie sie Jason und Äolus beobachtet hatten, waren im Freien nur noch selten zu sehen. Sie hockten lieber mit ihren Cyberhelmen und elektronischen Wunderbrillen in ihren Zimmern, mit denen sie in 4D-Simulationen abtauchten, Aliens im Cyberspace verfolgten oder virtuelle Planeten besiedelten. Junge Erwachsene verzichteten auf den Kauf eigener Autos, da diese meist ohnehin nur herumstanden und kaum noch ein eigenständiges Fahrvergnügen boten. Kein Motor heulte auf, keine Reifen radierten über den Asphalt, keinem Mädchen ließ sich mehr ein Aufschrei bei einem gewagten Überholmanöver entlocken. Weniger Autos bedeuteten zwar geringeren Verkehr und weniger klimaschädliche Gase, aber auch weniger Arbeitsplätze. Dafür genügte ein Anruf, das nächstgelegene Fahrzeug glitt heran und die gefahrene Strecke wurde wie die Telefonrechnung vom Konto abgebucht.
Die Politiker hatten zuerst in ihren Sonntagsreden die Elektromobilität angepriesen, ohne darauf hinzuweisen, dass die angedachten Förderungen ein kurzes Ablaufdatum hatten. Der zunehmende Entfall der Mineralölsteuern riss gewaltige Löcher ins Budget. Dazu sollte nach ihren Vorstellungen auch noch der massive Ausbau von Stromtankstellen auf den öffentlichen Straßen folgen, wofür schlicht das Geld fehlte. Garagen, in denen sie ihre Autos aufladen konnten, hatten ja nur wenige. Außerdem gab es immer noch genügend Probleme mit sauberem Strom, den sie vollmundig angepriesen und als Opposition auch munter eingefordert hatten. Da sie nun zwar die Regierungsmacht, aber wenig Geld in den Kassen hatten, war die Erfüllung der vorher hinausposaunten Versprechungen ziemlich mühselig geworden. Außerdem war das Stromtanken noch viel zu umständlich. Zwar schritt der Ausbau der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge rasch voran, doch jeder Anbieter hielt seine Tarifgestaltung so unübersichtlich wie möglich. Wer spontan bei der nächsten Elektrotankstelle stehen blieb, konnte seine blauen Wunder erleben. Bevor eine Ladesäule genutzt werden konnte, mussten die Kunden einen Vertrag abgeschlossen haben oder waren einer willkürlichen Preisgestaltung ausgeliefert. Erst nach langwierigen Verhandlungen und der Gestaltung einheitlicher Regeln, wofür die Regierungen zwölf Jahre gebraucht hatten, kam einigermaßen Ordnung in das Chaos.
Als Teilerfolg konnten die Politiker immerhin die saubere Luft in den Städten zu ihren Gunsten verbuchen, denn die Abgase der Kohlekraftwerke, die zum Ausgleich des je nach Wetterlage stark schwankenden Stromangebots der Windräder und Solarzellen notwendig waren, fielen zum Glück woanders an. Öl und Erdgas waren schneller als befürchtet unerschwinglich teuer geworden. Die Wähler hatten sich irgendwie damit abgefunden und die Städte an Lebensqualität gewonnen. Die Jugendlichen fanden die neuen Autos cool und gewöhnten sich ebenso schnell an die neue Mobilität, wie sie sich vor Jahren an Internet und Smartphones gewöhnt hatten.
Weniger begeistert waren die Fahrschulen, die sich ein neues Geschäftsfeld suchen mussten, und die Taxibetreiber, denen nur die wenigen Kunden blieben, die Hilfe beim Ein- und Austeigen brauchten oder auf den Service beim Gepäck nicht verzichten wollten. Der Mangel an Kunden verbesserte zumindest etwas die Höflichkeit und Hilfsbereitschaft der Fahrer.
Wenig angetan waren auch die großen Automobilerzeuger, die weniger Autos verkauften und ihre Gewinne mit Elektronikfirmen teilen mussten, wenn sie nicht ohnehin schon von diesen aufgekauft worden waren. Einige der Industrieländer, die bisher von ihrer Autoindustrie kräftig profitiert hatten, suchten verzweifelt nach neuen Arbeitsplätzen. Der Ablauf glich dem Sterben der alten Kohleindustrie. Langsames Siechtum und der Aufschrei nach Subventionen wurde von deftigen Sonntagsreden begleitet, bis selbst die stursten Gewerkschafter einsahen, dass die guten alten Zeiten unwiederbringlich vorbei waren. Die Autos waren zu eleganten Computern mit Rädern geworden. Viele gut ausgebildete Monteure und Mechaniker mussten umlernen und Wissen über innovative Brennstoffzellen, Elektronik und neuartige Batterietechnik erwerben. Diskussionen über die bisher kaum bekannten Seltenerdmetalle, die für Motoren, Magnete und Batterien notwendig waren, wurden fast alltäglich. Immer öfter wurden allerdings auch die umweltschädlichen Gewinnungsmethoden der Seltenen Erden, die noch immer überwiegend aus China oder Chile kamen, und die schrecklichen Arbeitsbedingungen in den afrikanischen Kobaltgruben kritisiert. Das nützte zwar wenig, da China und andere Länder lieber die Umwelt belasteten, als sich ihre Beinahe-Monopole entreißen zu lassen, beruhigte aber das Gewissen der Naturschützer. Die Windräder im Westen lieferten sauberen Strom, die radioaktiven Rückstände und schwermetallhaltigen Schlämme verblieben in der Mongolei oder in sonstigen Entwicklungsländern, deren Namen man ohnehin kaum aussprechen konnte oder die man nur mühsam in einem der alten Atlanten fand. Mochten die mit all dem giftigen Zeug und den Feinstaubproblemen, der säuregeschwängerten Luft und den verseuchten Böden fertig werden. Aber selbst da gab es gute Lösungen. Recycling gebrauchter Rohstoffe verringerte ebenso wie der Ersatz der Seltenen Erden durch häufigere und umweltschonende Metalle die Nachfrage in den Förderländern und schonte die Devisen der Industriestaaten.
Der Verkehr in den Straßen floss ruhig dahin. „Das Autofahren ist richtig langweilig geworden“, setzte Jason fort. „Um die Jahrtausendwende war auf den Straßen noch viel mehr los. Staus und Unfälle gab es jeden Tag. Die Menschen saßen noch selbst hinter ihrem Steuer, überholten wie verrückt und waren trotzdem langsam unterwegs.“
„Schade um das Erdöl, das sie für ihr Herumfahren verschwendeten. Diese Generation hat in hundert Jahren beinahe das ganze Öl verbraucht, das die Natur in Millionen von Jahren erzeugt hat“, antwortete Äolus.
„Ja, heute wird es besser verwendet. Zum Beispiel auch für uns.“ Äolus lachte.
Auf dem Weg zu ihrer Fabrik glitten sie gleichmäßig dahin. Ihr Wagen fuhr rasch und zügig, niemand überholte, nur hin und wieder reihte sich lautlos ein anderes Fahrzeug ein oder bog ab. Gegenverkehr gab es wenig. In den meisten Fahrzeugen saßen Menschen, meist einander zugewandt, da sie sich nicht mehr um das Fahren kümmern mussten. Manche spielten mit ihren Smartphones, die meisten blickten gelangweilt aus den Fenstern. Anderen Androiden begegneten die beiden nicht, schließlich gab es weltweit nur einige Tausend von ihnen. Es war auch in der Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts äußerst kostspielig, Androiden zu bauen, die bis ins kleinste Detail wie Menschen aussahen.
Das war auch nicht notwendig und ihr Aussehen machte sie für die Massenproduktion von Gütern auch viel zu teuer. Fast alle Gegenstände – selbst die einfachsten Haushaltsgeräte – enthielten intelligente Chips, massenhaft Elektronik und ein Übermaß an Rechenleistung, mit der sie ihre spezielle Funktion erfüllten. Das meist so gut, dass sie zuerst den Menschen die Arbeit erleichterten, dann aber immer mehr ihrer Arbeiten übernahmen. Die Gewerkschaft sorgte bei ihren Arbeitern und Angestellten für mehr Freizeit und eine Fülle an Vorschriften an den Arbeitsplätzen. Als viele Menschen nur noch zwanzig Stunden in der Woche arbeiteten, kamen immer mehr Industrielle auf den naheliegenden Gedanken, auch diese zwanzig Stunden durch Maschinen abzudecken.
Viele Fabriken, angefüllt mit Robotern und 3D-Druckern, verschwanden unter der Erde. Auf den umzäunten Grundstücken gab es oft nur noch die Gebäude für die Bewacher der Anlage, die Zufahrt und grüne Wiesen. Die Produktion wurde häufig von Zentralen gesteuert, die hundert und mehr Kilometer entfernt lagen. Züge oder riesige Rohrpostleitungen sorgten für die Zufuhr der Rohstoffe und für den Abtransport der Produkte. Fertig verpackt erreichten sie ihre Abnehmer, oft ohne menschliche Berührung. Die Menschen hatten sich in vielen Bereichen selbst ersetzt. Nur Dienstleistungen waren weiterhin gefragt - schließlich musste der Zuwachs an freier Zeit auch sinnvoll genützt werden - und erforderten Mitarbeiter, die entsprechende Angebote bereitstellten, doch selbst diese Leistungen wurden zunehmend automatisiert.
Die Entwicklung hatte harmlos begonnen. Die klein gewordenen Handys waren durch Smartphones ersetzt worden, die Apple und einigen weiteren Firmen großartige Gewinne ermöglicht hatten. Die Jugendlichen legten ihre Geräte kaum noch aus der Hand oder trugen sie als Cyberbrille auf der Nase. Wenn sie nicht gerade spielten, teilten sie ihre Selfies und Alltäglichkeiten mit anderen, prüften ständig nach, ob irgendjemand ihnen eine Nachricht gesandt hatte, und stolperten über die Straßen, die Augen fest auf ihre Bildschirme gerichtet. Gespräche im Wirtshaus waren einer virtuellen Welt gewichen. Nur die Alten saßen noch vor ihrem Glas Bier und starrten schweigend an ihren Tischgenossen vorbei. Alt im eigentlichen Sinn waren sie ja nicht, sie fühlten sich auch nicht so, hatten aber nichts mehr zu tun. Die schöne neue Zeit war voll mit Angeboten, die sich aber nur jene ausreichend leisten konnten, die es irgendwie geschafft hatten, nicht überflüssig zu sein und noch einer halbwegs gut bezahlten Arbeit nachzugehen. Natürlich musste niemand hungern, soweit funktionierte das soziale Netz noch immer, aber es gab eben viel freie Zeit, da immer mehr Arbeiten automatisch ausgeführt wurden. Selbst der Haushalt bot kaum noch Abwechslung. Manche Hausfrauen konnten gerade noch einen Tee oder ein Fertiggericht zubereiten. Die Saugroboter taten unauffällig ihren Job, Lebensmittel und andere Käufe wurden bis ins Haus geliefert, die neuen Wohnungen waren klein, teuer und platzsparend eingerichtet. Viele Geräte funktionierten auf Zuruf oder erkannten die Wünsche ihrer Besitzer von selbst, sodass ihnen nur noch die Arbeit der Zustimmung oder Ablehnung blieb. Die Geräte, die immer mehr Funktionen boten, zum Teil durch künstliche Intelligenz gesteuert, wurden begeistert angenommen. Sie waren in ihrer Bedienung einfach, da sie dank ihrer Sprachsteuerung selbst undeutlich geäußerte Wünsche verstanden. Und die jungen Besitzer probierten ohnehin so lange herum, bis sie die zahllosen Funktionen kapiert hatten.
Die utopischen Visionen von fliegenden Autos waren der Realität gewichen. Diese Dinger sahen zwar in Filmen gut aus, wären aber zwischen den Hochhäusern völlig unmöglich gewesen. Zu energieintensiv, zu kompliziert, zu hoher Schadstoffausstoß. Der Zwang zur sparsamen Verwendung von Energie wurde zunehmend spürbar. Der Trend zum Cocooning hatte sich verstärkt. Wem die Welt draußen zu kompliziert, zu stressig und zu uninteressant geworden war, zog sich in sein kleines, überschaubares Umfeld zurück. Die Überforderung durch ständig Neues reduzierte die Lust vieler Menschen, Neuland zu entdecken, und förderte den stillen Rückzug in die eigenen vier Wände, als Trend hin zum Einigeln samt dem Wunsch, sich alles nach Hause liefern zu lassen und die Welt nur über den Bildschirm zu betrachten.