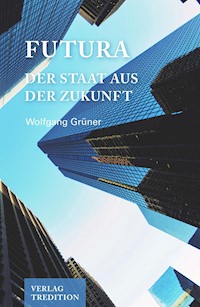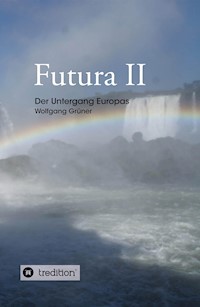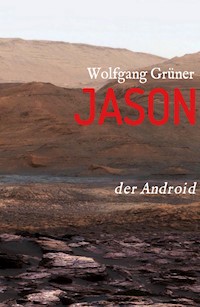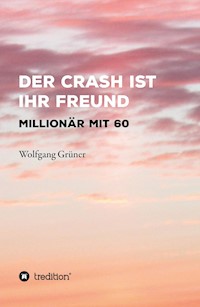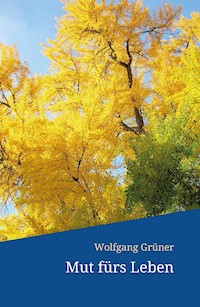
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mut fürs Leben. Meine Biographie, mein Werdegang, Anekdoten, Reisen und Gedanken zum Land, seiner Gesellschaft und seiner Geschichte.
Das E-Book Mut fürs Leben wird angeboten von tredition GmbH und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Steyr,Seitenstetten,Wirtschaft,Reisen,Bergsteigen,Soziales,Geschichte der letzten 70 Jahre,Gesellschaft,Linz,Aktien
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mut fürs Leben
Aus dem Leben eines Unberühmten
Wolfgang Grüner
© 2019 Wolfgang Grüner
Umschlag: Martin Obereder
Fotos: Wolfgang Grüner
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
978-3-7497-6759-5 (Paperback)
978-3-7497-7958-1 (Hardcover)
978-3-7497-7959-8 (e-Book)
»Denket immer daran, mich zu vergessen«.
Klaus Staeck
Danke an meine Familie und meine Freunde, die mein Leben und meine Reisen begleitet haben und es auch weiter tun, danke an Rainer Kampenhuber für die Korrektur des Buches und Martin Obereder für die Gestaltung des Titels, danke auch den zahlreichen Autoren, die durch ihre Texte mein Leben bereichern.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Kindheit
Kapitel 2: Seitenstetten
Kapitel 3: Reisen
Kapitel 4: Von Wien nach Linz
Kapitel 5: Neuorientierung
Kapitel 6: Berge und Reisen
Kapitel 7: Familie und Freunde
Kapitel 8: Der schöne Rest des Lebens
Kapitel 1: Kindheit
In einem meiner Albträume, die mich damals nachts aufschrecken ließen, steckte ich tief in einem steinernen Brunnenschacht und streckte meine Hand aus. Ich war vielleicht fünf Jahre alt. Der Boden war schlammig, aber fast trocken. Die Wand des Brunnens war aus kopfgroßen Steinen gemauert, zu glatt, als dass so ein kleiner Knirps wie ich sie aus eigener Kraft hätte erklettern können. Ich sah den Himmel als kreisrunden Ausschnitt meiner engen Wirklichkeit. Ein Gesicht war oben zu sehen, doch durch das helle Gegenlicht konnte ich die Person nicht erkennen. Eine Hand streckte sie mir entgegen, aber meine kleinen Arme waren zu kurz um sie zu fassen. Ihre Stimme klang beruhigend. Ich wachte dann meist schweißnass auf, da mir mein Verstand gegen diese Angst zuflüsterte, dass ich das ja gar nicht träumen hätte können, wenn ich nicht überlebt hätte. Doch nie erlebte ich im Traum die Befreiung, nie dieses in die Arme-Schließen durch meinen Retter oder meine Retterin, nie die getrockneten Tränen der überschwänglichen Freude, in Sicherheit zu sein.
Manchmal nagte auch die Erinnerung an ein unerreichbares Fenster hoch oben mit dem Gesicht meiner Mutter, ich selbst eingesperrt in ein Spitalszimmer mit Fremden und immer neuen Pflegerinnen. Die Betten waren mit einem Gitternetz versehen. Dass es Typhus war, verursacht durch verseuchtes Brunnenwasser – damals hatten wir noch keine Wasserleitung in der Wohnung – verstand ich als Vierjähriger nicht. Ich fragte mich nur, was ich angestellt hatte, dass mich niemand in die Arme nahm, ich weder mit meiner Mutter noch mit meinen Geschwistern spielen durfte. Zehn Jahre später verschwanden diese Träume von selbst.
Amerikaner im Jeep waren in der Zeit meiner Volksschule Teil des Stadtbildes. Ein Offizier war auch bei uns in der Wohnung einquartiert, im Café Petzwinkler unter uns sogar ziemlich viele. Meist wurden sie als Befreier und oft auch als cool empfunden, auch wenn dieser Begriff damals noch unbekannt war. Als Schüler wurde ich einmal ein paar hundert Meter im Jeep mitgenommen und bekam eine Banane. Was heute so selbstverständlich ist, gehäuft in den Regalen der Supermärkte liegt, war damals eine kostbare Rarität. Der überwundene Krieg wurde in heroischen oder erschreckenden Bildern aufgearbeitet oder verdrängt. Die Trümmer und beschädigten Wohnungen konnten nicht verdrängt werden, die verlangten nach harter Arbeit und aufwändiger Renovierung. Auch mein Vater kam aus diesem Krieg zurück. Die Ehe meiner Eltern einige Jahre vor meiner Geburt, ich erinnere mich an ein Bild mit meinem Vater in schöner Uniform, scheiterte an der Realität, dass er nun als langweiliger Beamter und Ehemann keine besonderen Perspektiven bot, es auch im Krieg nicht weit gebracht hatte und zu wenig flexibel war, die neuen Chancen zu nützen. Glanz und Nimbus des tausendjährigen Reiches waren dahin. Diese ältere Generation an Soldaten hatte zwar – so sie zurückkehrte – den Krieg überlebt, war allerdings oft irgendwie beschädigt, seelisch oder körperlich. Entweder gebrochen durch die Grausamkeit des Krieges und die enttäuschten Hoffnungen oder infiziert von autoritären Vorbildern und dem Druck, sich selbst und den anderen Völkern beweisen zu müssen, dass man zu den Guten gehört hatte. Zumindest meistens. Oder doch überwiegend. Oder dass man angesichts des Zwanges gar nicht anders handeln durfte. Konnte angesichts dessen, was man erleiden musste, irgendetwas anderes, vor allem der banale Alltag, noch wichtig genug sein?
Ein neuer Mann trat in das Leben meiner Mutter, doch sie heiratete ihn nicht, denn die Kirche spendete zu diesen Zeiten zwar Trost, der aber gemischt mit der Aussicht auf die ewige Verdammnis war, wenn man zu weit vom Pfad der Tugend abwich. Das erfreuliche Ergebnis waren immerhin meine jüngere Schwester Maria und ein Erwachsener, der zwar nicht mein echter Vater war, diese Rolle aber in den Ferien, die meine Großmutter, meine ältere und jüngere Schwester und ich in Tirol verbrachten, wunderbar erfüllte. Meine ältere Schwester Edith wurde meist zur Mithilfe im Haushalt herangezogen, hatte jedoch auch die Möglichkeit, bei einem benachbarten Bauern zu reiten. Mir erschienen die Haflinger, die sie reiten durfte, die sonst jedoch zum Ziehen der Heuwagen bestimmt waren, riesig und unheimlich. Die Reise nach Brixlegg in Tirol war eine Expedition, mit einer beachtlichen Zahl an Koffern, tagelanger Vorbereitung und achtstündiger Zugfahrt. Dafür winkten uns Kindern sechs Wochen Ferien auf dem Land, Kühe und Pferde, alpenländisches Brauchtum, Heu, Stall und Berge, Baden im Reitherer See, Ausflüge ins Zillertal und zum Achensee, Beerenpflücken und Millionen von blutsaugenden Stechmücken und Bremsen. Die erschlagenen Bremsen reihten wir am Badesteg auf, die Beeren, meist Himbeeren, füllten als Marmelade die Gläser, die wir dann das Jahr über leerten.
Steyr, wo ich geboren wurde, war für Buben wie mich durchaus interessant. Nahe Wiesen, Bäume und ein paar Ruinen boten echte Abenteuerspielplätze. Nicht so wie die heutigen, deren Haupteigenschaft darin besteht, jede Verletzung unmöglich zu machen, um Schadenersatzansprüche zu vermeiden. Entsprechend langweilig wecken sie weder Eigenverantwortung noch bieten sie die Möglichkeit zur Gestaltung. Ich nagelte Bretter zu Baumhäusern zusammen, ohne dass sich jemand darüber aufregte, und spielte in den Ruinen eines zerbombten Hauses. Soldaten auf der Flucht, welche auch immer, hatten viel von ihrem Zeug in die Enns geworfen. Bei Niedrigwasser konnte man, vor allem im Bereich der Rederinsel, einiges davon finden.
Bombentrichter, Munition, Wildnis und Fundstücke aller Art gehörten zu diesem Schlaraffenland für heranwachsende Buben dazu. Dass die Munition auch explodieren konnte, vor allem wenn man das Geschoss vorn unvorsichtig herausdrehte, erhöhte die Spannung. Ein paar Jahre später war dann alles weg, gesäubert und ungefährlich. Dafür wurden die Straßen aufgerissen, Rohre verlegt, wieder zugeschüttet, erneut aufgerissen. Die Rohre wuchsen wie Wurzeln eines Baumes, drangen in die Häuser ein, schlängelten sich die Stiegenhäuser hoch und endeten vorderhand als gusseiserne Bassena in den einzelnen Stockwerken. Bald schienen sie auch damit nicht zufrieden und drangen in die Wohnungen ein. Am Ende gab es – meist immer noch bescheidene – Badezimmer. Boiler begehrten Einlass und schon wenige Jahre später war der Komfort des immerzu fließenden Wassers selbstverständlich. Die alte verzinkte Badewanne, die jeden Samstag in der Küche für uns Kinder aufgestellt wurde, in der wir eingeseift und abgeschrubbt wurden, wanderte auf den Dachboden. Die alten Böden wichen einem glatten Eichenparkett, die desolaten Öfen wandelten sich in kunstvoll aufgemauerte Kachelöfen, die meist wohlige Wärme spendeten, wenn sie nicht vorzogen, die Zimmer in dichte Rauchwolken zu hüllen. Damit sie ihren Dienst taten, mussten sie mit Holz und Briketts gefüllt werden, die leider in einem dunklen Keller ruhten, in dem sicher ein paar Geister oder Verbrecher auf mich lauerten. Woher ich das wusste? Uns Kindern wurden im Lauf der Jahre hunderte Geschichten erzählt und vorgelesen, die von Prinzessinnen, bösen Schwiegermüttern, Zauberern, Hexen und Geistern wimmelten. Ein paar davon mussten auch in unserem Keller wohnen, denn so viele verzauberte Schlösser konnte es gar nicht geben.
Die Volksschule erschloss mir die wunderbare Welt der Buchstaben, womit ich selber all die Sagen und Märchen verschlingen konnte, die die Brüder Grimm, Bechstein und andere Autoren liebevoll gesammelt hatten. Das Steyrer Kripperl begeisterte uns Kinder, eine Freundin unserer Großmutter, Cäcilia Leberstorfer, spielte den Nachtwächter und den Liachtlanzünder, die in jeder Vorstellung vorkamen. Dass Steyr den schönsten Stadtplatz Österreichs und noch eine Menge anderer Schätze aufwies, erkannte ich erst im Lauf der Jahre.
Unsere Großmutter war als Witwe des Gemeindearztes von St. Ulrich und Großraming eine angesehene Frau, eben ein Teil der damaligen Gesellschaft wie auch die Inhaber der Geschäfte Gründler, Meidl, Tillian, Ennsthaler, Hoflehner, Ärzte und Ärztinnen, die Dichterinnen Dunkl und Haushofer und viele andere, denen ich öfter begegnete. Menschen, die einander kannten und schätzten.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war von einem unbändigen Aufbruchswillen erfüllt. Es genügte nicht, die Trümmer zu beseitigen, Neues musste her. Die Kultur der Sieger überrollte das Land. Amerika wurde zum großen Vorbild. Perlonstrümpfe, Jeans, Coca-Cola, die amerikanische Küche, Autos und arbeitssparende Geräte, Mixer und Staubsauger eroberten die Haushalte. Findige Unternehmer und zielstrebige Arbeiter fanden gute Verdienstmöglichkeiten. Natürlich musste der neue Reichtum auch gezeigt werden. Geschäfte mit Massenware wurden gestürmt, doch die Erfolgreicheren verlangten nach Qualität. Unsere Mutter konnte sich als Schneiderin der guten Gesellschaft etablieren, wer auf sich hielt, traf sich in ihrem Salon. Gemeinsam mit ihren fleißigen Lehrlingen brachte sie die neueste Mode an die Frau. Das Rascheln der Seidenpapiere für den maßgenauen Zuschnitt, Kreide und Maßband, Stecknadeln, der große Schneidertisch und Modezeitschriften blieben in meiner Erinnerung, natürlich auch in der meiner Schwestern, lebendig. Die Familienfeste wurden mit edlem Porzellan, Silberbesteck und Bleikristallgläsern gefeiert, zelebriert
Kapitel 2: Seitenstetten
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Menschen und die Internate. Während die ersten drei Dinge gut gelungen waren – es heißt ja schon auf den ersten Seiten des Alten Testamentes: »Gott sah, dass es gut war« – schien das letztere nicht mehr ganz so überzeugend. Vielleicht wurden deshalb die Internate im weiteren Verlauf der Heiligen Schrift nur noch beiläufig erwähnt. Während die Hölle – die katholische Hölle – mit all den Qualen, dem ewigen Feuer und ihren langschwänzigen Hütern begeistert beschrieben und mit faszinierenden Bildern bestückt wurde, erlebten viele, meist Buben und Mädchen im Kindesalter, die Internate, so sie in eine solche Anstalt gesteckt wurden, ambivalent. Manchen gefiel es dort tatsächlich, weit weg von den Eltern, eingebunden in eine Gruppe Gleichaltriger, dem Drill ihrer strengen Herrscher und dem Blick durch vergitterte Fenster unterworfen. Manchen gefiel es nicht. Für diese Buben und Mädchen, je nach Internat und seelischer Robustheit, war es zwar meist nicht die Hölle, eher eine laue Form des Fegefeuers, das häufig die Enge kalter Mauern, manchmal Schönes erleben ließ. Aber das Paradies war es nicht.
Als Zehnjähriger kam ich also ins Internat nach Seitenstetten. Meine Mutter hielt das Gymnasium dort für besser als jenes in Steyr, außerdem sollte ich dem Regime weiblicher Hände entkommen, die in unserem Haushalt die Mehrheit innehatten. In Seitenstetten gab es nur Männer, oder solche, die es werden sollten.
Seitenstetten ist ein kleiner Markt, mitten im niederösterreichischen Mostviertel, mit einem großen, barocken Kloster. Die Ursprünge des Stiftes sind natürlich älter, denn »seit 900 Jahren (1112 – 2012) beten und arbeiten Benediktiner in einer ununterbrochenen Tradition im Vierkanter Gottes in Seitenstetten. Zu denuns seit Jahrhunderten zugewachsenen Aufgaben zählt die Seelsorge in den 14 dem Stift inkorporierten Pfarren, die Erziehung und Bildung im humanistischen-neusprachlichen Gymnasium, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, Wirtschaft, Kunst und Kultur«, schreibt der derzeitige Abt Petrus Pilsinger. Neben der romanischen Ritterkapelle und vielen anderen Kunstschätzen zeugt ein silbernes Weihrauchfass von dieser fernen Zeit. Das heutige Aussehen verdankt das Stift kunstsinnigen Äbten und Künstlern wie Josef Munggenast, Paul Troger, Bartolomeo Altomonte, Kremser Schmidt und einer umfangreichen Renovierung. Die ehrwürdigen Mauern wirkten vor sechzig Jahren kälter als heute, da damals nur Buben die Gänge belebten, die traditionsgemäß nach alter Sitte durch Zucht und Strenge erzogen und zu würdigen Exemplaren patriarchalischer Ordnung geformt werden sollten. Heute beleben auch Mädchen die renovierten Klassenzimmer, die früher rigorose Strenge, die gelegentlich auch handfest unterstützt wurde, ist zeitgemäßer Pädagogik gewichen. Das Internat wurde aufgelassen.
Kapitel 3: Reisen
In unserer Familie waren Reisen ein lebendiger Bestandteil der Freizeitgestaltung. Ausflüge in die nähere Umgebung, die Sommerurlaube und Skiferien in Tirol gehörten dazu, ebenso wie die Reisen zum Gardasee, nach Monterosso, Lignano, Venedig, La Spezia und Verona. In Venedig rannten wir treppauf, treppab über Brücken, die Kanäle entlang, gefühlt in vierhundert Kirchen und Paläste. Das ist natürlich übertrieben, es werden schon ein paar weniger gewesen sein, aber wenn irgendwo ein Tizian, ein Bellini oder ein Denkmal von Canova zu finden waren, liefen wir zuverlässig hin. Dazwischen gab es Spaghetti, Muscheln, Espressi und Rotwein, gelegentlich sogar im vornehmen Hotel Danieli, der schönen Toilette wegen. Eine Fahrt mit einem Schiff von Venedig nach Triest blieb mir besonders in Erinnerung. Wie viele andere in dieser Zeit urlaubten wir eher bescheiden, suchten nach preisgünstigen Unterkünften und einfacheren Lokalen. Auf dem Schiff gab es nun ein üppiges Buffet, bestückt mit allem, was das Herz begehrte und worauf wir der Preise wegen in Venedig verzichtet hatten. Ich langte kräftig zu – ein Junge im Alter von zwölf oder vierzehn Jahren kann schon einiges vertragen. Eine Dame an unserem Tisch stocherte dagegen lustlos im Essen, schien offensichtlich überspannt und heikel zu sein. Plötzlich rannte sie davon und ließ den Teller mit leckeren Speisen einfach stehen. Ich folgte ihr neugierig und sah sie blassgrün an der Reling stehen, würgend und mit ihrem Mageninhalt die Fische fütternd. Jetzt bemerkte ich auch den hohen Seegang, der unser Schiff heftig schwanken ließ. Das Essen schmeckte mir nun erst recht.
Zu Weihnachten – ich war damals sechzehn - bekam ich ein Zelt. Ich hatte eine Brieffreundin in Nizza, und, um ihr überhaupt schreiben zu können, lernte ich in der Freizeit mit einem Schallplattenkurs von Linguaphone Französisch, verbissen und intensiv. Von den Professoren wurde mein Eifer zuerst wohlwollend gesehen, bis sie mich auch während ihrer Stunden gelegentlich beim Lernen der französischen Vokabel erwischten und merkten, dass ich ihr Fach ignorierte. Briefe gingen zwischen Nizza und Seitenstetten hin und her, mit all dem Unsinn, der einem pubertierenden Buben einfiel. Ich beschloss, nach Nizza zu fahren und kaufte mir das schon erwähnte Moped. Meine Mutter zeigte wenig Begeisterung, mich auf eine längere Reise fortzulassen und erlaubte mir widerstrebend die deutschsprachigen Länder. Die Absicht bis Nizza zu fahren, hatte ich verschwiegen. Ich war abenteuerlustig, romantisch, kunstinteressiert und hatte von meinem Fahrzeug keine Ahnung.
Es war wohl weniger Mut als Naivität, was ich heute aus meinen Tagebüchern lese. Gmunden, Bad Ischl, Hallstatt, kurze Etappen, Zeichnungen von Kirchen, Notizen der täglichen Ausgaben, Pässe, Burgen und die Eisriesenwelt, häufig Regen. Die Preise in Schilling scheinen lächerlich. Fünf Schilling für den Zeltplatz, tanken um 11,40. Immer noch Schilling. Am vierten Tag: »Ich habe heute herrlich geschlafen, warm. Spät bei Sonnenschein aufgestanden. Zum Mittagessen aß ich gefüllte Paprika aus der Dose.« Am Großen Wiesbachhorn vorbei, das ich Jahrzehnte später bestiegen habe, ging es über die Großglockner Hochalpenstraße weiter nach Heiligenblut und Lienz bis zu einem einsamen Platz bei Sillian. Dort hörte ich auf Ansichtskarten nach Hause zu schicken, denn jetzt betrat ich das verbotene Italien. Mit elender Langsamkeit durchquerte ich die traumhaften Dolomiten, das Fahrzeug lief einfach nicht schneller. Passo Falzarego, Passo Pordoi, Berge und wieder Berge. In Trient streikte das Moped endgültig. Erst als ein Tankwart die Zündkerze putzte, kam ich vom Fleck. Hätte ich auch wissen können. In Riva am Gardasee zerstörte ein Sturm fast mein Zelt, wie so oft musste ich es noch feucht verpacken.
Den schönen Gardasee führte eine traumhafte Uferstraße entlang, die nach Brescia in ein schnurgerades Asphaltband überging, von Pinien, schlanken Bäumen und roten Sträuchern gesäumt. Offensichtlich hing ich meinen Träumen nach, ich zitiere aus dem Reisetagebuch: »Kurz nach Brescia bremste plötzlich vor mir ein Italiener. Ich reagierte zu spät und fuhr zwischen seinen Bremslichtern durch, kam natürlich nicht weit. Ich flog gegen die hintere Autoscheibe, zerkratzte mir die Oberschenkel an der Lenkstange und schnitt mich stark am Daumen. Wenig später hoben mich ein paar Burschen vom Boden auf, ebenso das Moped, das sie zu einem Mechaniker brachten. Ich wurde zu einem Arzt gefahren, der mich sofort behandelte und die Risswunde am Daumen nähte. Alessandro, der Autofahrer, lud mich zum Abendessen ein. Es gab köstlichen Schinken, den ich leider wegen meines lädierten Gesichtes kaum essen konnte. Schade, er wäre so gut gewesen. Am nächsten Tag, das Moped war irgendwie notdürftig zusammengeflickt worden, fuhr ich weiter«. Alle waren außerordentlich hilfsbereit. Aus heutiger Perspektive hat mich dieser Italiener wie ein Geschenk vom Himmel behandelt, statt wie einen jungen Idioten, der nicht einmal dazu imstande gewesen war, auf einer geraden Straße zu fahren. Den Kratzer auf seinem Auto nahm er einfach hin.
Mailand faszinierte mich, doch rasch ging es nach Genua weiter. Auf den Zeltplätzen gab es immer wieder hilfsbereite Camper, meist Deutsche und Holländer, die mich einluden, bei ihnen zu essen. In Nizza kaufte ich Blumen und machte mich auf die Suche nach meiner Gastfamilie. Ich war stolz, beim Essen zwischen meiner Brieffreundin Eliane und ihrer Schwester Irene zu sitzen, deren Eltern mich liebevoll aufgenommen hatten. Es sprang zwar kein Funke zwischen mir und Eliane über, doch verbrachten wir gemeinsam einige wunderbare Tage. Zu schnell war die Zeit um und ich musste den langen Weg nach Hause antreten. Über Turin und Locarno ging es in die Schweiz, wo ich wieder begann, Karten nach Hause zu schreiben. Vor Sorge war meine Mutter inzwischen zur Polizei gelaufen, die sie zu beruhigen versuchte: „Wenn etwas passiert, erfahren wir es sofort, sonst können wir nichts machen.“ Über die Schweiz und den Bodensee ging es Richtung Österreich. Es regnete häufig. Zu Hause gab es richtig Ärger, weil ich so lange nicht geschrieben hatte. Immerhin einigte sich meine Mutter mit mir auf einen Kompromiss: „Fahre, wohin du willst, aber schreibe, damit ich weiß, dass es dir gut geht.“
Als gute Erinnerung an die Matura blieb mir die Prüfung in Chemie. Mit den Fragen Eisengewinnung, Hochofen und Erdöl konnte nichts schiefgehen. Bei den anderen Fächern schon, aber da hatte ich Glück, schaffte es irgendwie und war froh, die acht Jahre heil überstanden zu haben.
Jetzt war wieder die Zeit für Abenteuer. Wieder begleiteten mich Moped und Zelt. Wenn ich heute die alten Notizen lese, scheint es bis Italien fast täglich geregnet zu haben. In Zell am See kam ich in einem Heustadel unter, wenig später konnte ich die Krimmler Wasserfälle bestaunen, deren Nässe mir diesmal nichts ausmachte. Zwei Tage lang genoss ich den immerwährenden Landregen unter einem festen Dach, doch bald ging es über Innsbruck und den Brenner weiter. Dort hatte ich einen Vorteil, ich ratterte an der langen Autoschlange einfach vorbei. Die EU lag noch in ferner Zukunft. Nach meinem Reisebericht zu urteilen, interessierten mich jede alte Kirche, jedes alte Gemäuer und jedes Kloster. Hin und wieder leistete ich mir ein paar der angebotenen Köstlichkeiten, meist kochte ich aber auf meinem kleinen Gasbrenner oder begnügte mich mit Konserven. Das Geld war knapp und sollte fünfzig Tage reichen. Das Stilfserjoch war eine Herausforderung, nicht alle Straßen waren so gut ausgebaut wie heute. Die Schweizer hatten an Billigreisenden wie mir wenig Freude, alles schien verboten zu sein, dafür sind die Berge dort noch ein bisschen schöner als anderswo. Warum eigentlich? Wie schon im letzten Jahr zeigten sich die Deutschen und die Holländer auf den Zeltplätzen immer wieder gastfreundlich, luden mich ein und wunderten sich, dass ein Bursch in meinem Alter wochenlang unterwegs war. In Mailand verbrachte ich mehrere Tage, fotografierte stundenlang im Dom, besuchte die romanische Kirche Sant´Ambrogio und brauste mit den Italienern durch die belebten Straßen um die Wette. Ihre Mopeds hängten mich spielend ab. In Genua traf ich den ersten unsympathischen Italiener, der aber leider der Verwalter des Zeltplatzes war und für mich keinen Platz hatte. Aus meinen Notizen: »In dieser verfluchten Gegend findet sich kein Fleckchen Wiese, alles ist hässlich, verbaut und mit Abfällen übersät. In Voltri blieb ich aus Benzinmangel stehen. Als ich der dunklen Gegend hilflos umherstrolchte, bot mir ein Italiener seinen kleinen Lieferwagen zum Schlafen an. Ich lud mein Gepäck hinein, stahl eine Melone, die unter einer Plane hervorlugte, und genoss die winzige, aber trockene Unterkunft.« Genua gefiel mir gar nicht und so fuhr ich bald weiter. Diesmal schlug ich mein Zelt auf einem wilden Campingplatz auf, der direkt am Meer lag. Der Boden bestand aus Sand und Kies, meine Heringe (die Pflöcke für das Zelt) hielten in dem groben Sand nicht. Ich war todmüde. Ein Sturm kam auf, das Meer schwappte bedrohlich ans Ufer und die Wellen schlugen bereits an meine Behausung, als plötzlich eine Bö mein Zelt umriss. Italiener neben mir halfen mir mit großen Holzpflöcken aus. Wie ein Frosch lag ich die halbe Nacht ausgespreizt am Boden, Sand zwischen den Zähnen, der Wäsche, einfach überall. Gott sei Dank trocknete am Morgen strahlender Sonnenschein die nassen Planen. Die weitere Reise führte mich über Monaco, Nizza nach Cannes und Frejus. Zusätzlich zu den Kirchen besuchte, zeichnete und fotografierte ich die römischen Theater und Aquädukte. Eine Gegend voll mit Kultur, schöner Landschaft und alten Trümmern. Mich wunderte nicht, dass die Glücklichen mit den siebenstelligen Bankkonten diese Gegend liebten. Immer wieder lernte ich Burschen oder Mädchen kennen, mit denen ich ein paar Stunden gemeinsam verbringen konnte. Kochen, baden, spielen, reden, manche so reiselustig wie ich. Als ich in Marseille einen Soldaten der Fremdenlegion fotografieren wollte, brüllte mich ein Feldwebel auf Deutsch nieder. Die Welt ist voller sonderbarer Vögel. Die Landschaft zwischen Aix und Arles ist in Verbindung mit den zahllosen Kunstwerken aus der Römerzeit und Romanik ein Paradies für Touristen. Dafür machte sich in Avignon ein Fremdenführer, der Deutsch konnte aber nur Französisch erklärte, über die dummen Deutschen lustig, die ins Land kämen, ohne die Sprache zu können. Die Hand fürs Trinkgeld hielt er ihnen aber dennoch hin.
Über Lyon, Paray le Monial und Nevers ging es nach Norden. Zusätzlich zu den Kirchen gibt es hier noch die berühmten Schlösser, von denen allerdings viele leer stehen.
»Die Kathedrale von Chartres gibt einen ungeheuren Eindruck, wenn man vom lärmenden, schreienden Licht in das stille Dunkel tritt. Nur wenig sickert durch die färbigen Glasfenster, taucht eine groteske Figur in Rot, umspielt zärtlich den Kopf eines Heiligen. Ein steinernes Gebet scheint sie zu sein, das zur Ehre Gottes gesprochen wurde.«
Für Paris hatte ich eine ganze Woche Zeit. Ich erreichte die Stadt nach 3527 Kilometern Fahrt. Wieder waren es die Kirchen, die ich bewunderte, die gotische Notre Dame, ebenso die Sainte Chapelle in den wuchtigen Mauern des Palais de Justice, filigran von innen, durchflutet vom farbigen Licht der hohen Fenster. Wieder die Notre Dame, diesmal vom Seineufer aus, dann die Boulevards mit ihren Cafés, die Kirche La Madeleine und die Oper. Teure Geschäfte, deren Auslagen mir Dinge zeigen, die ich mir nie leisten werde. Ich zeichnete die Porte St. Denis, die Kirche Sacré Coeur, Szenen vom Montmartre mit dem ganzen Schund, der dort als Kunst verkauft wird. »Neben all den Kunstwerken von Paris gefiel mir eines ganz besonders – man kann fahren, wie man will. Ich fuhr in einer Einbahn in die falsche Richtung, worauf mich die Polizei nur höflich aufmerksam machte, Ampeln zählen wie in Italien nur für jene, die es nicht besonders eilig haben, die andern schauen nach links und rechts und fahren durch«, notierte ich. Meine Zündkerze war endgültig hinüber, wichtiger als alle Kunstwerke dieser Welt wurde plötzlich die nächste Werkstatt. Eine Woche am selben Zeltplatz war richtig gemütlich, die neuen Bekanntschaften hielten länger, gemeinsame Ziele wurden angesteuert, der Wein schmeckte in lustiger Gesellschaft doppelt so gut. Der Eiffelturm, über 300 Meter hoch, von 1887 bis 1889 errichtet, war bis zum Bau des Chrysler Buildings um 1930 in New York das höchste Bauwerk der Welt. Er ist ein weithin bekanntes Wahrzeichen für die Stadt und zusätzlich die wichtigste Sendeanlage des Großraums Paris. Rund sieben Millionen Besucher pro Jahr machen ihn zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt. Er gilt als nationales Symbol der Franzosen und avancierte zu einer weltweiten Ikone der Moderne. Ich liebte die Stadt, sie schien damals keine großen Probleme zu haben. Es gab zwar die verstopften Straßen, aber auch die Lebenslust der Bewohner und der Touristen, die diese gelungene Verbindung aus Geschichte, Architektur und Heiterkeit aufsogen und genossen. Der Louvre war in den Sechzigerjahren noch nicht so überlaufen wie heute. Er beherbergt wunderbare Skulpturen der griechischen und römischen Antike, die Nike von Samothrake, die Venus von Milo und andere mehr, die Gemälde von Botticelli, Rembrandt und Rubens, die berühmte Mona Lisa, Ingres und Velasquez. In anderen Museen, ja selbst in den Straßen konnte ich noch einen Hauch jenes Aufbruchs in die Moderne erspüren, den Künstler wie Picasso, Max Ernst und viele andere angeregt hatten.
Um das Nachtleben auszukosten fehlte mir das Geld. Die Auslagen mit frivolen Dessous zeigten »unten nichts und oben ohne«, dünne Seidengespinste, die mehr Fantasie als Verhüllung boten. Teuer waren sie trotzdem. Ein Chaos von Fischen und sonstigen Meerestieren, hupende Lieferanten, eilige Kunden, Gerüche und Abfälle, schuppige und sich noch schlängelnde Bestien erwarteten mich in den Hallen, dem Bauch von Paris. Es gäbe noch viel zu erzählen, aber jeder Reiselustige kennt die Stadt und ihre Faszination.
Die nächste Station war Reims. Zeltplatz, Spiegeleier, Reis, wieder Kirchen und römische Trümmer. Ich buchte eine Führung in einer der riesigen Champagnerkellereien mit uralten Kellern und angeblich 100 Millionen Flaschen, ein gewaltiger Reichtum, der im Dunkel lagert. In Nancy war ich wie üblich unterwegs, stellte das Moped ab und begann, zu Fuß die Stadt mit dem wunderschönen barocken Place Stanislas zu erkunden. Als ich wieder zum Zeltplatz wollte, fand ich mein Fahrzeug nicht mehr. Ich hatte die Straße völlig vergessen. Immer wieder fragte ich Passanten, bis sich einer an den roten Kübel erinnerte, der mir zum Wasserholen und Wäschewaschen diente. Die Wärme des Südens gefror zu einer blassen Erinnerung, es schien die Hälfte aller Tage zu regnen und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zu haben. Das Moped zeigte Mucken wie ein störrischer Esel.
In Straßburg hörte ich wieder Deutsch, besuchte die prachtvolle Kathedrale mit der astronomischen Uhr und den berühmten gotischen Figuren der Ecclesia und Synagoge, die den Hintergrund zu einer Flüchtlingsgeschichte in einem meiner Bücher bilden. Mit Colmar, dem berühmten Isenheimer Altar und den schönen Fachwerkhäusern verließ ich Frankreich. Ich bin den siebenundfünfzigsten Tag unterwegs und pleite. Für vier Tage habe ich gerade noch 24 Mark.
Ulm habe ich daher in besonderer Erinnerung. Ich setzte mich auf den Platz vor dem Münster und schrieb mit Kreide: „Österreichischer Student – bitte um Geld für Heimreise – brauche noch fünf Mark.“ Ein Foto im Reisetagebuch zeigt mich samt Schrift vor einer Säule des Münsters. Meine Aufzeichnung: »Ein Österreicher gab mir vierzig Schilling, bald folgten auch einige Mark. Ich strich nach den ersten zwei Mark und den Schillingen den Fünfer durch und schrieb vier, dann drei, dann zwei. Als ich nur noch eine Mark wollte, kam ein Polizeiauto herangebraust und ich wurde von zwei Beamten festgenommen und auf die Wache gebracht. Sie nahmen auf, was ich in den Taschen hatte, betrachteten dreimal meine Papiere und füllten mindestens ein Dutzend Zettel mit dem Tatbericht und dem Inventar meiner Hosentasche aus: Taschentuch, Mopedschlüssel, Brieftasche, Kamera und Stadtplan. Dann klärten sie mich auf, dass Bettelei, wie sie es nannten, laut Paragraph 361 verboten sei und schrieben weiter. Sie telefonierten mit dem Gericht, ich bekam meine Sachen zurück, was ich wieder unterschreiben musste, und wurde mit dem Polizeiwagen zum Gericht gefahren. Eine Richterin, die für mich nicht zuständig war und die nicht wusste, was sie mit mir anfangen sollte, sah ziemlich streng drein. Neue Formulare wurden ausgefüllt. Nach kurzer Beratung sprach sie mich frei, auch die beschlagnahmten vier Mark – mehr hatte ich ja laut Text auf dem Pflaster nicht erbettelt – bekam ich zurück. Der Strafantrag des Dekans, der mich angezeigt hatte, wurde wegen Nichtigkeit zurückgewiesen. Die Polizei fuhr mich dann wieder zum Münsterplatz zurück. Dieses nette Erlebnis gab mir einen guten Einblick in die Arbeitsweise der deutschen Polizei.«