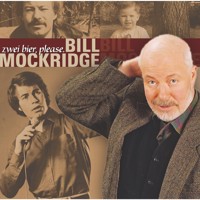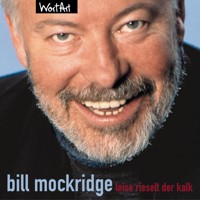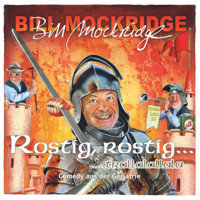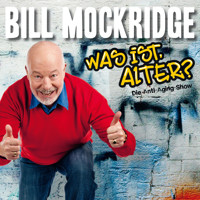8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lachen ist der beste Weg, dem Alter die Zähne zu zeigen – auch wenn es die Dritten sind! Der beliebte Theater-, Comedy- und Fernsehstar Bill Mockridge weiß, wovon er redet. Schließlich wird er selber ständig älter – und beschäftigt sich seit Jahren in seinen Bühnenprogrammen damit. In »Je oller, je doller« beantwortet er nun die elementarsten Fragen, die ihn und seine Altersgenossen der Generation 50+ beschäftigen. Bill Mockridge zeigt, wie ein »Altern in Würde« gelingt – nicht mit einem mickrigen Seniorenteller, sondern mit einer extra großen Portion Humor (den Rest kann man sich schließlich einpacken lassen). »Wir machen beide geniales Kabarett, nur er ist eine Pflegestufe weiter.« Harald Schmidt über Bill Mockridge
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bill Mockridge | Lars Lindigkeit | Markus Paßlick
Je oller, je doller
So vergreisen Sie richtig
Über dieses Buch
Dieses Buch macht Sie nicht jünger. Die Seiten, wenn auch von vorzüglicher Papierqualität, sind nicht etwa beschichtet mit einer revolutionären Anti-Aging-Creme, so dass Sie sich mit dem vorliegenden Werk einfach die Falten aus dem Gesicht wischen können. Auch den Bastelbogen für eine Zeitmaschine suchen Sie in »Je oller, je doller« vergebens. Was Sie stattdessen finden: Antworten. Antworten auf all die Fragen, die jeden von uns beim verunsicherten, leicht zittrigen Schlurfen über die Schwelle zum Altwerden quälen: Früher mochte ich Metallica – muss ich jetzt Silbereisen hören? Wie gefährlich ist eine Überdosis Granufink? Warum habe ich nicht mehr ein Gedächtnis wie ein Elefant – fange aber langsam an, so viel zu wiegen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bill Mockridge, Jahrgang 1947, ist Comedian, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Den gebürtigen Kanadier verschlug es 1968 nach Deutschland, wo er vor über vierzig Jahren das erste Mal auf deutschen Theaterbühnen stand. Der Gründer des Springmaus Improvisationstheaters erobert mit eigenen Soloprogrammen die deutschen Comedy- und Kabarettbühnen. Bill Mockridge – u.a. bekannt als Erich Schiller aus der »Lindenstraße« – lebt mit seiner Frau und ihren sechs Söhnen in Bonn.
Impressum
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Autor: Bill Mockridge (www.bill-mockridge.de)
Kontakt: www.hpr.de
Unter Mitarbeit von Markus Paßlick und Lars Lindigkeit
Illustrationen: Bernhard Prinz
Coverabbildung: Boris Breuer
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401414-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
VorwortOder: Wie ist das passiert?
Er lauert in dir seit deiner Geburt. Doch er ist ein Meister im Warten. Heimlich und still begleitet er deine ersten Schritte, hält sich versteckt während deiner Schulzeit. Mit Mitte zwanzig, auf deinem geistigen und körperlichen Höhepunkt, hat er es geschafft, dass du ihn für ein erfundenes Fabelwesen wie Bigfoot oder Nessie hältst. Doch du irrst. Tief in dir drinnen wartet er darauf zuzuschlagen – Tag für Tag, Jahr für Jahr, geduldig wie ein Zen-Meister. Er weiß: Seine Stunde wird kommen. Mit ungefähr vierzig beginnt er, seinen zukünftigen Herrschaftssitz in dir einzurichten. Viel kriegst du davon zunächst nicht mit: ein seltsames Knacken beim Aufstehen, ein kurzer, stechender Schmerz im Rücken, ein ab und zu verschwommener Blick. Du wunderst dich, hakst es aber schnell wieder ab, und es geht weiter wie bisher. Die bereits begonnene Verwandlung lässt sich davon jedoch nicht aufhalten. Ich rede selbstverständlich von der einschneidendsten Veränderung im Leben eines jeden Menschen seit der Pubertät, dem Moment, in dem du eines Morgens vor dem Badezimmerspiegel erschrocken feststellst: »Hilfe, ich werde ein alter Greis!«{FNT}Ich schreibe bewusst alter Greis, auch wenn das für manche klingen mag wie »weißer Schimmel«. Aber es gibt nun mal leider auch junge Greise, einige nicht mal dreißig Jahre alt!{EFN}
Erschreckend, aber wahr: Während Sie den vorangegangenen Absatz gelesen haben, sind Sie erneut um etwa dreißig Sekunden gealtert. Falls Sie vorher wieder einmal Ihre verlegte Lesebrille suchen mussten, sogar deutlich mehr. Sie sehen: Es gibt kein Entrinnen vor der unweigerlichen Kontrollübernahme des in uns allen schlummernden alten Greises. Oder natürlich – zu früh gefreut, liebe Damen! – der alten Greisin. Darum dieses Buch. »Je oller, je doller!« ist eine geriatrische, tiefenpsychologische, soziologische, philosophische und medizinische Untersuchung über die geistigen und körperlichen Verfallprozesse des Menschen in Mitteleuropa unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen und ökologischen Einflüsse des beginnenden Jahrhunderts. Einfacher ausgedrückt: Dieses Buch beschäftigt sich mit der Beantwortung der zwei elementaren Fragen. Erstens: Werde ich ein alter Greis? Beziehungsweise eine alte Greisin? Und zweitens, wenn ja: Kann ich was dagegen tun?
Um es gleich vorwegzunehmen, erstens: ja. Und zweitens: nein.
Aber halt! Das ist nur der Anfang. Denn jetzt drängt sich die Frage auf: »Kann man richtig oder falsch vergreisen?« Meine Antwort lautet: Ja, selbstverständlich. Das ist die höchste Kunst im Leben, gut zu altern! Dieses Buch wird Ihnen, wie ein guter Freund, auf der langen Reise ins Seniorenland zur Seite stehen. Als junger Mensch lebt man nach dem Motto: höher – schneller – weiter! »Je oller, je doller« verrät Ihnen, wie man auch mit alten Knochen und quietschenden Gelenken ans Ziel kommt: tiefer – langsamer – und trotzdem weiter. Der alte Greis hat nämlich einen großen Vorteil gegenüber dem ungestümen Jungspund: Er kennt die Schleichwege des Lebens.
Eine schlanke Flasche mit prickelndem Sekt sollte man frisch und jung genießen. Entweder eisgekühlt aus einem Sektkelch oder leicht gewärmt aus einem Bauchnabel. Ein schwerer Rotwein, gereift in einem dicken, runden Fass, entfaltet seine wahren Qualitäten erst nach vielen, vielen Jahren. Dieses Buch wird Ihnen helfen, diese Qualitäten in sich zu entdecken. Mit Erfahrung und etwas Glück wird man oller und oller, mit Gelassenheit und Humor aber auch jeden Tag doller und doller. Lachen Sie über sich selbst – die anderen tun es doch auch schon lange.
Aber Vorsicht, eines kann dieses Buch nämlich mit Sicherheit nicht: Es macht Sie nicht jünger. Die Seiten, wenn auch von vorzüglicher Papierqualität, sind nicht etwa beschichtet mit einer revolutionären Anti-Aging-Creme, so dass Sie sich mit dem vorliegenden Werk einfach die Falten aus dem Gesicht wischen können. Auch den Bastelbogen für eine Zeitmaschine suchen Sie in »Je oller, je doller!« vergebens. Was Sie stattdessen finden? Antworten! Antworten auf all die Fragen, die jeden von uns beim verunsicherten, leicht zittrigen Schlurfen über die Schwelle zum Altwerden quälen:
Früher mochte ich Metallica – muss ich jetzt Silbereisen hören?
Wieso begehren mich auf der Straße immer seltener Frauen – dafür immer öfter Bestatter?
Was ist »senile Bettflucht« – und wo stelle ich dafür den Asylantrag?
Wie gefährlich ist eine Überdosis Granufink?
Bedeutet »Darmspiegelung«, dass ich danach den Hintern vorne trage? Warum habe ich nicht mehr ein Gedächtnis wie ein Elefant – fange aber langsam an, so viel zu wiegen?
Wie bekomme ich die Rotweinflecken aus meinem Bauchnabel?
Dieses Buch soll Mut machen – allen sogenannten »Best-Agern« (ab fünfzig), den »Rest-Agern« (ab achtzig) oder gar »Rest-in-Peace-Agern« (der Ü-110). Nicht zu vergessen natürlich all den noch jugendlich frischen Zwanzig-, Dreißig- und Vierzigjährigen: Je früher aufgeklärt, wohin der Weg geht, desto weniger Angst vor dem späteren Coming-out als alter Greis.
So groß die Erinnerungslücken in meinem kahlen Kopf auch werden mögen: Immer werde ich mich an den Tag erinnern, als ich endlich allen Mut zusammengenommen hatte, um meine Freunde und Verwandten zu Hause im Wohnzimmer zu versammeln und ihnen zu gestehen: »Leute, ich muss euch was sagen … Ich bin alt!« Vertrauen Sie mir: Wenn sie dich danach anschauen, dir beistehend ihre Hand auf die Schulter legen und verständnisvoll lächeln: »Ach, Bill, das wissen wir doch schon seit zehn Jahren …« Dieses Gefühl der Befreiung ist unbeschreiblich!
Wie gesagt: Dieses Buch macht Sie nicht jünger. Aber hoffentlich ein wenig entspannter älter. Lernen Sie den Greis in sich – wann auch immer er zuschlägt – etwas besser kennen. Lernen Sie, über ihn zu lachen. Und vielleicht werden Sie dabei sogar feststellen: So übel ist der Kerl, beziehungsweise das Mädel, gar nicht.
Viel Spaß und immer eine Handbreit Kalk unterm Schädel wünscht Ihnen
Ihr Bill Mockridge
– nach Diktat vergreist –
1.Willkommen in der Senioren-Zielgruppe! Oder: Mein 60. Geburtstag
Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Wir Alten werden nicht sonderlich gemocht – und zwar von keiner Geringeren als der Natur höchstpersönlich. Die möchte nämlich gar nicht, dass wir alt werden. Von der Natur aus erreicht der Mensch mit achtzehn fast schon seinen körperlichen und geistigen Höhepunkt. Dann wird man volljährig, und wie der Begriff schon andeutet: Man hat sein volles Leben ausgeschöpft. Danach geht’s nur noch bergab. Das kann ich auch beweisen: In der Steinzeit, vor vielen, vielen Jahren, ganz kurz vor der Geburt von Jopi Heesters, war der Mensch mit fünfundzwanzig schon tot. Wirklich! Heutzutage sind viele mit fünfundzwanzig immer noch dabei, sich irgendwie erst mal zu »finden«. Nicht so damals: Da wurde man mit fünfundzwanzig von anderen gefunden. Nämlich, ich sagte es bereits: tot in der Landschaft liegend. Vergiftet durch irgendwelche Beeren, von einem Nebenbuhler erschlagen, von einem wild gewordenen Mammut zerstampft, einem tollwütigen Säbelzahntiger zerfleischt, was weiß ich. Der Steinzeitmensch hat auf jeden Fall sehr früh die Keule für immer und ewig beiseitegelegt, nach dem Motto: Du sollst einziehen in die ewigen Jagdgründe jung, stark und sexy – und nicht alt, schlapp und faltig. Damit hat es die Natur nicht so, und dass wir sie inzwischen mit der modernen Medizin ziemlich hinterfotzig überlistet haben, nimmt sie uns krumm. Sie sträubt sich dagegen mit allen Mitteln. Das beste Beispiel: die Gesichter der Rolling Stones – das ist Rache pur. Das Gesicht von Mick Jagger ist inzwischen identisch mit dem Stadtplan von Timbuktu in Blindenschrift. Ja, die Natur ist eine Meisterin des Gegenschlages!
Auch mit der Selbstwahrnehmung im Alter ist das so eine Sache. Alle wollen sich mit achtzig noch wie sechzig fühlen. Umgekehrt ist das weit seltener der Fall. Umso härter treffen dich deshalb natürlich auch die Schlüsselerlebnisse, wenn das Leben dir den Wink nicht mehr nur mit dem Zaunpfahl, sondern schon mit dem ganzen Lattenzaun gibt: »Hey Alter, aufwachen – auch du bist jetzt ein Greis!«
Ein Beispiel: Es begab sich letzten Sommer – ich sitze in Toronto, wo ich geboren und aufgewachsen bin, in der U-Bahn. Mir gegenüber ein älterer Herr. Ich beobachte ihn eine ganze Weile und denke: »Verdammt, den Kerl kenn ich von der Schule … Aber das kann nicht sein – der ist doch viel zu alt.«
Nach langem Grübeln spreche ich ihn dennoch an. »Entschuldigung … Sie waren nicht zufällig auf dem Upper Canada College?«
Der Mann hebt seinen Blick. »War ich«, nickt er überrascht.
»Das gibt’s ja nicht! Waren Sie Captain der Football-Mannschaft 1959?«
Seine Augen fangen an zu leuchten. Jetzt nickt er noch heftiger. »War ich, war ich!«
»Doug!«, breite ich zum Wiedersehen weit die Arme aus. »Doug Graham! Mensch, Douggie, altes Leder – wir kennen uns von der Schule!«
»Ja …«, entgegnet er zögerlich. Ich sehe in Dougs Augen, wie es in seinem Kopf rattert. »Jaaaaaa, das kann gut sein … Sorry, helfen Sie mir: Welches Fach haben Sie damals unterrichtet?«
Das Bremsen der U-Bahn an der nächsten Station übertönte mein schmerzvolles Seufzen nach diesem Stich ins Herz.
Es ist also umso wichtiger, gut darauf vorbereitet zu sein. Sich selbst rechtzeitig zu hinterfragen: Bin ich wirklich schon alt – oder laufe ich mit zugedrücktem, stargetrübtem Auge noch unter »semijung«? Fragen, die uns ab einer gewissen Lebenserfahrung auf dem schon leicht schrumpeligen Buckel automatisch beschäftigen. Gut, natürlich gibt es eindeutige Symptome. Zum Beispiel, wenn sie di esennä chsten schwac hsinnigens a tz nicht lesen können – dann sollten Sie schleunigst zum Augenarzt! Oder wenn die eigene Akustikkompetenz langsam nachlässt. Wie bitte? WENN SIE SCHLECHTERH-Ö-R-E-N! Oder wenn man plötzlich nachts häufiger raus muss als alle Schichtarbeiter zusammen. Wollen Sie jedoch frühzeitig merken, dass bei Ihnen was im Altersbusch ist, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung nur einen wichtigen Tipp geben: Achten Sie auf Ihre Briefpost.
Es begab sich ausgerechnet an meinem sechzigsten Geburtstag – ein schon per se äußerst sensibles Datum in meinem Leben. Bitte nicht falsch verstehen: Ich habe grundsätzlich nichts gegen die Zahl »60«. In irgendeinem Paralleluniversum, wo mein dortiger Bankberater mir strahlend Blumen überreicht mit dem Satz »Herzlichen Glückwunsch, Herr Mockridge – zu Ihrer sechzigsten Million!«, sind die »60« und ich wahrscheinlich sogar beste Freunde. Im weit weniger attraktiven Universum, in dem dieses Buch erschienen ist, wurden mir aber leider nur strahlend Blumen überreicht mit dem Satz: »Herzlichen Glückwunsch, Herr Mockridge – zu Ihrem 60. Geburtstag!« Und genau da liegt der Hund begraben: Es ist und bleibt ein schwieriges symbolisches Alter. Die »6« stellte optisch recht akkurat meinen in den Jahren zuvor deutlich gewachsenen Bauchumfang dar. Die »0« dahinter stand mengenmäßig für all die Dinge, die ich mir noch mühelos merken konnte. Kurz: Das Alter hatte sich körperlich wie geistig bereits mehr oder weniger höflich bei mir vorgestellt, doch ich war noch längst nicht bereit, gastfreundlich seine Hand zu schütteln. Stattdessen griff ich mir meine Geburtstagspost, suchte gezielt nach den Werbeglückwünschen. Ich hoffte, dass da was dabei wäre, was mich in meiner jugendlichen, kraftvollen Männlichkeit bestätigen würde: Post von 200-PS-Quad-Herstellern, Veranstaltern von Wildwasser-Kanufahrten, Mount-Everest-Besteigungen (natürlich ohne Sauerstoffmaske!) und Weltraumflügen, Anbietern von Büffelhodenfleisch – bei wem auch immer meine Daten als wirklich noch sehr, sehr rüstiger Sechzigjähriger zielgruppengenau im Computer gelandet waren.
Ich öffnete den ersten Brief und fing an zu lesen:
Sehr geehrter Herr Mockridge,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 60. Geburtstag! Lassen Sie sich heute richtig groß feiern – wer weiß, ob Gott Ihnen dazu noch einmal die Gelegenheit gibt. Wollen Sie die zukünftige unvermeidliche Bürde Ihrer Beerdigung tatsächlich Ihren trauernden Hinterbliebenen überlassen? Schon ein kleiner monatlicher Beitrag von 24,60 Euro schenkt Ihnen das gute Gefühl, Ihren Nachkommen einen finanziell sorglosen Neustart ermöglicht zu haben! Herr Mockridge, entscheiden Sie heute – morgen kann es schon zu spät sein!
Eine Unverschämtheit! Da fehlte nur noch ein Päckchen »Friedhofserde!« Etwas erblasst im Gesicht schaute ich auf den Brief – dachte mir aber: Gut, das ist Zufall. Da musste es noch irgendeinen anderen Bill Mockridge hier in der Nachbarschaft geben, der heute sechzig wurde und deutlich klapperiger war als ich. Einfach falsch zugestellt, der Brief. Ich entsorgte ihn sofort zum Altpapier und widmete mich lieber dem kleinen Geburtstagspäckchen mit der liebevollen roten Schleife, das mich schon die ganze Zeit anlächelte. Ich ahnte es schon. Wahrscheinlich hat mir meine Fernsehehefrau Marie-Luise wieder einen Eierwärmer gestrickt. Ich schaute auf den Absender: nicht Mutter Beimer, sondern eine gewisse Frau Hartmann. »Hartmann, Hartmann, Hartmann …«, überlegte ich – ist das vielleicht Sabine aus der Schulzeit, die neu geheiratet hat? Gespannt schüttelte ich den Karton, doch es war nicht viel zu hören. Was da wohl drin war? Ein Überlebensmesser? Ein schönes Fläschchen zum Sammeln meines überschüssigen Testosterons? Ich riss den Päckchendeckel auf und zog zwischen kleinen Styropor-Teilchen einen Zettel heraus:
Lieber Herr Mockridge,
die allerbesten Glückwünsche senden wir Ihnen heute zu Ihrem 60. Geburtstag! Wir erlauben uns heute, Ihnen unser Inko-Management vorzustellen …
Inko-Management? Ah, eine Investmentfirma hatte an mich gedacht! Richtig so! Schließlich sollte ich mir auch mit meinen erst sechzig Jahren, wo das Alter noch so unendlich fern scheint, schon mal über meine Zukunft Gedanken machen.
… Wir übersenden Ihnen anbei ein Probeexemplar unseres neuen, jetzt noch saugstärkeren Inko-Systems zur Ansicht …
Hä? Ich wühlte mit der Hand durch das Styropor und zog ein längliches, weiches Etwas heraus – wie ein Wesen von einem anderen Planeten starrte ich das Ding mit den Flügeln ungläubig an.
Es war eine Herrenbinde. Die meinten wohl, ich wäre nicht ganz dicht!
Und falls Sie glauben, dass ich damit in Sachen Geburtstagspost schon die größte Schmach überstanden hatte – nein, es ging scheinbar endlos weiter: Ein Optiker bot mir plötzlich sechzig Prozent auf alle Brillen an. Ganz schön viel, Mann. Irgendjemand wollte mir, für sage und schreibe 99 Euro, »blütenweiße Zähne aus Rumänien« andrehen. »Nur leicht gebraucht.« Ich erhielt einen Gutschein für eine kostenlose Prostatauntersuchung. Außerdem ein Angebot für eine schnelle Probefahrt mit einem Treppenlift. War von einer großen medizinischen Praxis in Bonn auserwählt worden für das »Goldene Senioren-Kombi-Ticket« – Magen- und Darmspiegelung am selben Tag.
Während ich meine Geburtstagspost tapfer abarbeitete, wurde selbst mir klar: Es hatte sich etwas verändert. Seit heute war ich nicht mehr der, der ich früher einmal war. Ich gehörte jetzt zu einer neuen Zielgruppe – ich war nun offiziell »Senior«. Und zwar nicht wie in der Wirtschaft ein cooler »Senior Executive Consulting Manager«, der anderen knallhart ans Bein pisst – nein, nur ein einfacher »Senior«, dem man ganz offensichtlich unterstellte, dass er sich ohne das neue saugstarke Inko-Management selbst ans Bein pisst.
War man früher mit Vollendung des neunundvierzigsten Lebensjahres zumindest endlich wieder frei aus den Fängen der Werbewirtschaft, lassen die einen heute nie mehr los. Man wird einfach nur weitergereicht zu den Kollegen für die neue Zielgruppe. Aber gut, wahrscheinlich will man uns Älteren einfach nicht den Schock zumuten, sich plötzlich wieder – Gott bewahre! – einen eigenen Geschmack bilden zu müssen. Den haben wir dank jahrzehntelangem Werbedauerfeuer schließlich komplett verlernt. Im Grunde stecken also ganz ehrenwerte Motive dahinter, das Konsumverhalten in unseren Kalkhirnen auch weiterhin professionell fremdzusteuern, damit wir selbst damit keine Arbeit haben. Danke, liebe Werbewirtschaft!
»Na, Schatz, wer schreibt denn alles zu deinem großen Ehrentag?«, kommt meine Frau ins Wohnzimmer. Sie sieht die Herrenbinde auf dem Tisch. »Was ist das denn?«
»Das?«, druckste ich herum. »Ach das … das ist … ’ne Schlafbrille! Von meiner alten Freundin Sabine.« Ich drückte mir die Binde gegen die Augen. »Guck mal, mit extra Flügeln, damit wirklich kein Licht durchkommt. Nur das Gummiband muss man noch selbst dranmachen.«
Bis heute trage ich die Inko-Herrenbinde jede Nacht im Bett neben meiner Frau über den Augen.
2.Drei Generationen und ganz viel Senf
Wir sind zwar nun schon mittendrin im Thema dieses Buches, aber damit Sie meine Ausführungen besser verstehen – oder zumindest ein bisschen nachvollziehen – können, will ich Ihnen zunächst einmal meine Familie vorstellen: Ich lebe nämlich mit drei Generationen unter einem Dach – eigentlich sogar vier, wenn man unsere Möpse Kenzo und Möppy mitzählt. Meine Frau Margie und ich haben sechs Söhne. Ich wiederhole: sechs Söhne! Ja, danke, wir kennen die Methoden, wie man das hätte verhindern können, wir haben sie aber ganz bewusst nicht angewandt. Nach dem sechsten Sohn dann schon, denn ich wollte nicht »der Bill mit den sieben Zwergen« werden. Dann schon lieber »Ali Billa und die vierzig Räuber«, aber dagegen legte Margie ihr Veto ein.
Unsere Söhne sind zwischen fünfzehn und siebenundzwanzig Jahre alt, also aus dem Gröbsten raus. Es gab aber Zeiten, als die Jungs so zwischen sieben und neunzehn waren, da hatten wir jeden Tag von sechs Uhr morgens bis Mitternacht das volle Programm: Von Laternenbasteln bis Kiffen war alles inbegriffen.
Der Älteste ist Nicky, er lebt inzwischen in Berlin und ist Regisseur und Künstler durch und durch. Er sieht aus wie Johnny Depp und redet oft so intellektuell und gestochen, dass ich kaum ein Wort verstehe.
Teo ist fünfundzwanzig Jahre alt, liebt Fitness und die Sonne. Er studiert International Business und redet pausenlos über Projekte, Deals und cross-mediale Marketingstrategien.
Luki ist zwei Jahre jünger und der eigentliche Komiker in unserer Familie. Das Riesentalent hat er wohl von Margie geerbt. Wie alle Männer, die auf der Bühne stehen, ist er ein bisschen eitel. Das war ich auch mal, damals, als es sich noch lohnte. Jetzt hat sich bei mir der Zeit-Nutzen-Aufwand zu stark in Richtung Zeit verschoben.
Vollkommen uneitel ist hingegen Lenny. Er ist mit einundzwanzig Jahren zwei Jahre jünger als Luki. Ja, Sie haben richtig gerechnet: Die ersten vier Jungs sind immer im Abstand von zwei Jahren gekommen. Bei den beiden Jüngsten haben wir jeweils ein Jahr länger gebraucht, um wieder neue Kraft zu sammeln. Lenny ist ein genialer Gitarrist und studiert Musik in Brighton.
Jeremy ist achtzehn und die coolste Sau unter der Sonne. Er ist sehr klug, jetzt schon ein erfolgreicher Schauspieler und gibt sich, je nach Stimmung, als eine Mischung aus James Dean und Klaus Kinski.
So, habe ich noch einen vergessen?
Ach, richtig: Liam ist mit fünfzehn Jahren unser Nesthäkchen und zurzeit mein wichtigster Mann, denn er kennt sich mit Computern, Apps und Smartphones aus. Ohne seine ständige Hilfe hätte ich dieses Buch auf eine Schiefertafel kratzen müssen. Liam spielt Schlagzeug und ist immer gut drauf. Er liebt seine Freunde und geile Klamotten.
Ich wiederhole noch mal für Sie: Nicky, Teo, Luki, Lenny, Jeremy und Liam. Mein ganzer Stolz! Alle sechs nennen mich »Dad«. Je nach Situation auch »DATT!«, »Dähäd?« oder »Daddy« – bei Letzterem folgen meistens Sätze wie »Das mit der Sechs in Latein hatte ich dir schon erzählt, oder?«, »Sag mal, seit wann hat dein Auto eigentlich diese fiese Beule am Kotflügel?« oder »Hatte Mama wirklich sechs Mal Sex – mit dir?«
Ja, Mama hatte! Mindestens!
Margie ist der wichtigste Mensch in meinen Leben: meine große Liebe. Seit dreißig Jahren. Als ich sie das erste Mal sah, war es allerdings nicht gerade die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Ehrlich gesagt dachte ich mir damals: »Mein Gott, was für eine Knalltüte!« Ich hielt ein Casting ab, für das allererste Springmaus Improvisations-Ensemble, das ich Anfang der achtziger Jahre in Bonn gegründet hatte. Mit falsch herum angezogenem Pullover, wirrer Frisur und ein paar Rollschuhen um den Hals kam sie mit einer halben Stunde Verspätung zum Termin und erfüllte auf der Stelle die große Bühne des kleinen Theaters mit ihrer Spontaneität und Witz. Sie ist eine geborene Komikerin und wie für das Improvisationstheater geschaffen. Diese Fähigkeit zeigt sie zum Glück auch im Alltag, eine Gabe, die man in einem Haushalt mit sechs heranwachsenden Söhnen, einem herauswachsenden Mann und einer ausgewachsenen Oma gut gebrauchen kann.
Oma ist bei uns das einzige Mitglied der dritten Generation. Meine Frau wurde in Rom geboren, ihre Mutter stammt aber aus Tschechien. Oma ist sechsundachtzig Jahre alt und verkörpert bis heute die typische böhmische Gräfin, die gerne ungefragt alle Familienmitglieder belehrt und berät. Sie spricht eine Mischung aus Deutsch, Tschechisch, Italienisch, Wienerisch und Englisch, gerne auch alle Sprachen innerhalb eines Satzes. Eine bewundernswerte Frau! Sie hat nur eine Schwäche: Sie kann nichts wegschmeißen. Vielleicht liegt es daran, dass sie der Kriegsgeneration angehört, aber diese einfache Erklärung macht das Zusammenleben nicht immer einfacher. Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmittel ist für sie nicht mal eine grobe Empfehlung. Neulich hatte sie eine Leberwurst in unserem Kühlschrank deponiert, die beim Öffnen der Kühlschranktür strammen Schrittes auf mich zulief. Die Leberwurst war so alt, die hatte ihre lange Zeit in unserem Kühlgerät genutzt, um sich evolutionär weiterzuentwickeln. Sie verfügte inzwischen über ein Fell, sechs Augen und acht Beine. Charles Darwin hätte seine Freude an dieser Leberwurstspinne gehabt. Ich erlegte das Ding mit der Handkante und sagte zu Oma:
»Was ist das denn? Das musst du wegschmeißen, bevor es uns in sein Netz einwickelt und unser Blut aussaugt!«
»Nein, Junge!«, antwortete die erschrockene Oma und versuchte die Leberwurst zu reanimieren. »Ich habe extra nachgeschaut, die ist haltbar bis 2012!«
»Nein, Oma!«, entgegnete ich genervt. »Da ist ein Punkt zwischen der 20 und der 12, das bedeutet 20.12.! Die Wurst ist im letzten Dezember abgelaufen!«
Der Begriff »abgelaufen« bekam für mich eine ganz neue Bedeutung, als ich im Mülleimer die letzten Zuckungen ihrer Beine sah (die Beine der Leberwurst, nicht der Oma!).
Oma hat aber noch eine andere große Leidenschaft: Sie liebt Senftütchen. Diese kleinen Plastiktütchen, die mit zehn Gramm Senf gefüllt sind. Nicht mehr, nicht weniger. Wir gehen mit der Familie jeden Sonntag essen, meist gut bürgerlich. Aus drei Gründen: Für die Jungs gibt es volle Teller, für mich eine günstige Rechnung und für Oma Senftütchen. Denn Senftütchen gibt es nicht beim Edel-Italiener oder Chi-Chi-Franzosen. Senftütchen gibt es nur in Lokalen, in denen auf dem Nachbartisch ein Wimpel mit der Aufschrift »Stammtisch« steht und das Fett der Friteusen in Stalaktiten von der Decke hängt. In unserem Lieblings-Familienlokal in Bonn-Endenich, der »Harmonie«, ist das allerdings nicht so. Es ist sauber, gemütlich und erfüllt trotzdem unsere drei Voraussetzungen. Manchmal glaube ich, dass die Betreiber der »Harmonie« die Senftütchen nur noch für die Oma auf den Tisch bringen. Und die Oma greift erbarmungslos zu: Tütchen für Tütchen verschwindet in ihren Manteltaschen. Manchmal läuft sie auf dem Weg nach Hause regelrecht mit Schlagseite, weil sie die Mengen in den Manteltaschen nicht genau austariert hat. Zu Hause verschwindet sie sofort in ihrem Zimmer, um die Ausbeute genau zu begutachten. Dann öffnet sie zufrieden die große Schublade ihrer Kommode und legt die Senftütchen zu den anderen Schätzen: Salz-, Pfeffer-, Ketchup- und Mayotütchen. In rauen Mengen, man könnte ein komplettes Oktoberfest damit ausstatten.
Vor vielen Jahren habe ich sie zufällig beim Katalogisieren ihrer Schatzkammer erwischt. Ich fragte sie, am Rande der Verzweiflung: »Was um Himmels willen willst du mit den ganzen Senftütchen?«
Da schaute sie mich mit großen Augen an, als ob sie ein großes Geheimnis in sich tragen würde: »Bill, eines Tages wird dir der Senf das Leben retten!«
»Ja, wenn die Chinesen Endenich überfallen oder unser Haus von einem Tsunami bedroht wird«, wollte ich spontan antworten, aber ich ahnte, dass jedes weitere Wort meinerseits sinnlos war.
Meine eigene Mutter hatte auch eine Sammelleidenschaft: Ihre Senftütchen hießen allerdings Bonbons. Jedes Jahr im Sommer, wenn wir mit der ganzen Familie meine Mutter in Toronto besuchten, legte sie für jedes Kind einen Dollar und ein Bonbon auf ihre Kommode. Nach einem feuchten Kuss (das mögen Jungs ganz besonders) durfte jedes Kind seine fette Beute abholen. Leider ist meine Mutter 2005 gestorben, im stolzen Alter von 101 Jahren. Die letzten zehn Jahre ihres Lebens verbrachte sie in einer Seniorenresidenz, wo »nur alte Leute lebten«. Außer ihr natürlich. Meine Mutter war bis ins hohe Alter sehr wach und fidel. Als sorgender Sohn habe ich sie zu Lebzeiten natürlich regelmäßig in Kanada angerufen. Ich werde ganz besonders ein Telefonat nicht vergessen, das ich im Vorfeld ihres hundertsten Geburtstages mit ihr führte:
»Sag mal ehrlich, Mum: Wie geht es dir?«
»Kein Problem, mein Junge! Ich bin oben licht und unten dicht, mehr brauch’ ich nicht!«
Ich hoffe, das kann ich mit hundert Jahren zu meinen Jungs auch noch sagen.
Die Oma und meine Mutter haben sich immer gut verstanden. Ich muss gestehen, dass ich diese gegenseitige Zuneigung vor vielen Jahren ein einziges Mal ausgenutzt habe. Als Oma mich fragte: »Bill, wie geht es deiner Mutter? Ich habe lange nicht mehr mit ihr telefoniert.«
»Ach, eigentlich gut, wie immer. Sie hat nur ein Problem: Ihr ist doch glatt auf die alten Tage der Senf ausgegangen.«
»Bill, du dummer Junge, sag mir das doch! Ich schicke ihr einige von meinen Senftütchen.«
Wir haben dann ein Päckchen für meine Mutter gepackt, mit hundert Senftütchen (ich konnte sie von dreißig auf hundert hochhandeln). Den Empfänger habe ich erst in der Postfiliale auf das Päckchen geschrieben:
»Die Harmonie«
Absender: Anonym
3.Ich möchte älteren Menschen vertrauen
Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich ein kleiner Junge war: Die Dinosaurier waren gerade ausgestorben (bis auf den allerletzten zähen T-Rex, der röchelte noch …), und unser Hausarzt hieß Dr. Teddy Morgan. Der hat Gott sei Dank noch nicht geröchelt. Ich habe ihn damals auf etwa einhundertzwanzig Jahre geschätzt. Er hieß nicht nur Teddy – er sah für mich auch ein bisschen so aus: wie ein fülliger, weißhaariger, trostspendender Knuddelbär. Wenn ich mal krank war, konnte ich mich darauf verlassen, dass Dr. Teddy Morgan wenig später beim Hausbesuch vor meinem Bett stehen würde. Tonlos den Radetzkymarsch pfeifend drückte er mir dann einen Holzstab auf die Zunge und ließ mich unendlich lang »AAAAAAAAH« sagen. Nachdem er mich mit seinem eiskalten Stethoskop abgehört und seinen faltigen Händen abgeklopft hatte, klappte er stets die Arzttasche zu und sagte mit ernster Miene und tiefer Stimme etwas wie: »Das sind die Masern. In vier Tagen sind die weg!«
Und wenn Dr. Teddy Morgan, der weise Onkel mit dem Stethoskop, etwas versprach, dann hielt die Natur sich da auch dran – in vier Tagen waren die weg!
Bis heute prägt mich das kindliche Urvertrauen, das Dr. Teddy Morgan mir vor vielen Jahren als kleinem Billy-Boy mitgab. Ob Ärzte, Priester oder Piloten: Ich möchte mich älteren Menschen anvertrauen. Heute bin ich fast fünfundsechzig Jahre alt. Und damit wahrscheinlich schon um einiges älter, als Dr. Teddy Morgan – Gott hab ihn selig – damals in Wirklichkeit war. Meine langjährige Patientenphilosophie, nur auf Mediziner mit mindestens dreißig Jahren mehr Lebensweisheit zu hören, stößt an ihre Grenzen – sofern ich nicht gerade meinen alten Hausarzt auf dem Bonner Zentralfriedhof besuche. Es führt kein Weg daran vorbei: Ich muss meine Ansprüche fürs bedingungslose Vertrauen in steinalte Menschen ein wenig herunterschrauben – zehn Jahre Altersunterschied zu Experten, denen ich nicht weniger als mein Leben anvertraue, müssen aber immer noch sein. Mindestens!
Kennt noch jemand Quincy? So einen Arzt wünsche ich mir! Natürlich so alt, wie er heute ist, damit es alterstechnisch wieder hinkommt. Wobei … Der hat ja Tote behandelt. Vielleicht also doch lieber nicht. Dann schon besser mein Kollege Dr. Dressler aus der »Lindenstraße«. Der ist ein super Arzt. Fünfundsiebzig Jahre alt und seit 1386 Folgen Mediziner. Dr. Dressler, der mich wie damals Teddy Morgan als kleinen Jungen vor meinem Bett mit dem eiskalten Stethoskop abhört, mit seinen faltigen Händen abklopft – und am Ende die Arzttasche zuklappt und mit ernster Miene und tiefer Stimme etwas sagt wie: »Bill, das ist die Säuferleber. In vier Tagen ist die weg!«
Übrigens: Als junger Billy-Boy hatte ich auch einen alten, stets achtsamen Busfahrer, der uns kleine Hosenscheißer jeden Morgen sicher in die Schule und wieder zurück brachte. So etwas prägt fürs Leben. Sie ahnen daher, dass es mir emotional bei Piloten nicht viel anders geht als bei Ärzten. Ja, ich möchte auch ältere Menschen als Piloten haben! Wenn ich mit meiner Familie in einer dieser Blechbüchsen mit Kranich am Heck nach Kanada fliege, 10000 Meter hoch und 6393 Kilometer lang über den Atlantischen Ozean – dann hat der Pilot vorne im Cockpit gefälligst mindestens wie Clint Eastwood auszusehen.
Doch was krieg ich stattdessen? Jedes Mal diese smarten, blutjungen Pilotenküken mit keck hinter sich hergezogenem Flightcase, kaum älter als Justin Bieber, Bartwuchs selbst mit dem Hubble-Teleskop noch nicht sichtbar! Keiner kann mir verübeln, dass ich aus Reihe 14 dann immer rufe: »Kommt, Kinder, lasst den Vorhang da vorne schön auf! Ich will genau sehen, was der Pilot da macht … Beide Hände ans Steuer! Bist du angeschnallt? Hast du den Rückspiegel richtig eingestellt? Und immer geradeaus gucken, sonst komm ich da vorne vorbei!«
Zugegeben: Es kann andererseits auch problematisch werden. Neulich hatte ich einen Piloten ganz nach meinem Geschmack: ein Methusalem mit schneeweißem Haar, bestimmt vierzig Jahre Flugerfahrung sprühten ihm aus jeder steinalten, ausgeleierten Pore. Perfekt. Dachte ich. Bis ich beim Abheben der Maschine seine brüchige Stimme durch die Bordlautsprecher hörte:
»KZZZZRRRRRRR … Ja, schönen guten Tag … Herzlich willkommen an Bord unserer Boeing 7 äh … unserer Boeing 7 … äh, Boeing 4711! Nach, äh … nach … äh, ja … nachher sag ich Ihnen dann, wo’s hingeht … Ich bin Ihr Kapitän, und ich heiße … Himmel, Arsch und Zwirn, mein Name muss doch hier vorne irgendwo … Wusste ich doch, hier auf meiner Brust: Kapitän, äh … Lufthansa! Und ich wünsche Ihnen einen schönen Dingsbums … ja, richtig: Flug!«
In solchen Situationen kann dir eigentlich nur noch einer Beistand leisten: dein Priester. Doch auch auf die Gefahr hin, dass ich endgültig wie ein Jugend-Faschist anmute: Auch den wünsche ich mir an und für sich lieber jenseits der fünfzig als diesseits der dreißig! Unser neuer junger Dekan in Bonn-Endenich zum Beispiel – ein super Typ, gar keine Frage –, aber ich schwöre: Der Kerl steckt noch im tiefsten Dickicht der Pubertät! Ich bezweifele in keinster Weise seine klerikale Kompetenz. Doch ganz unter uns: Was soll der mir vom Jenseits erzählen? Da bin ich doch schon näher dran als der!
Das bestätigen mir jedenfalls täglich meine alten Knochen, und zwar laut und deutlich. Heute Morgen nach meinem Fitnesstraining habe ich schon wieder gedacht, ich muss sterben. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich den Arzt meines Vertrauens wieder aufsuche. Wann ist endlich mein nächster Drehtag in der »Lindenstraße«?
4.Ich finde für Frauen nicht mehr statt
Seit Anbeginn unserer Existenz träumt die Menschheit von einer ganz besonderen Fähigkeit: sich unsichtbar machen zu können. Nehmen Sie Siegfried, den alten Drachenkiller, der macht im »Nibelungenlied« mit seiner Tarnkappe mal eben ganz souverän Kriemhild klar. Oder denken Sie an Hobbit Frodo mit seinem ihn verschwinden lassenden Ring. Aber jetzt halten Sie sich gut fest: Auch ich besitze eine Tarnkappe.
Im Gegensatz zu Siegfried habe ich diese nicht etwa einem Zwergenkönig abgeluchst. Und wie Frodo einfach vom Finger abstreifen kann ich mein Unsichtbar-Utensil erst recht nicht. Ich trage es nämlich nicht freiwillig. Meine Ganzkörper-Tarnkappe ist fest angewachsen, nicht ablegbar. Es ist nämlich so: Mein Alter ist meine Tarnkappe. Ja, Sie haben richtig gelesen: Das Alter macht mich unsichtbar. Nicht für alle wohlgemerkt – ganz im Gegenteil: Apotheker, Ärzte und Bestatter behalten mich mit jedem verstreichenden Lebensjahr sogar immer genauer im Auge. Nein, ich spreche von den Menschen, bei denen ich seit einigen Jahren nicht mehr den Paarungsinstinkt wecke, sondern maximal den Pflegeinstinkt: den Frauen.
Ich finde für Frauen nicht mehr statt.
Es ist gar nicht so lange her (bitte korrigieren Sie mich jetzt nicht!), da war ich ein durch Gottes gütige Hand libidogesegneter Jüngling mit vollem Haupthaar und von stattlicher Statur. Zog ich damals durch die Straßen, um mich herum schöne, junge Frauen, zogen sich unsere Blicke geradezu magisch an. Ich war der »Flirtinator« von Bonn-Endenich – ein kurzer Augenkontakt sagte mehr als tausend Worte.
Das war einmal.
Heute bin ich ein durch Gottes grausame Hand libidolimitierter alter Sack mit verschwundenem Haupthaar und von stattlicher Plauze. Wenn ich heute zu einer Frau auf der Straße herüberschaue – schaut sie nicht zurück. Sie – schaut – nicht – zurück! Ihre weiblichen Hormone steuern, dass ich für sie unsichtbar werde, ihr Gehirn mich als potentiellen Mann einfach ausblendet, um den Blick fürs Wesentliche zu schärfen: die Suche nach einem jungen, potenten Partner, der sie im Notfall mit seinen starken Fäusten verteidigen kann – und nicht wie ich, indem er seine speichelgetränkten »Dritten« rausnimmt und sie dem Angreifer ins Skrotum kneift.
Zunächst war ich angesichts dieser nicht besonders begrüßenswerten Entwicklung meiner Wirkung auf Frauen verunsichert, ja, mehr noch: Ich war erschrocken und bestürzt, fühlte mich in meiner männlichen Ehre verletzt. Schon bald jedoch erarbeitete ich Strategien und Tricks, um die Frauen doch noch auf mich aufmerksam zu machen. So stellte ich mich, als die Wirkung des reinen Blickkontaktes verblasste, neben eine junge Dame und begann, mich zu räuspern – als kurzer, aber eindeutiger akustischer Hinweis: »Hallo, schöne Frau, hier bin ich!« Ein Räusperer voll sinnlicher Erotik, mit einem Hauch Barry White aus den Untiefen meiner Kehle. Gut, zugegeben, das Räuspern geriet vielleicht etwas lang, unter Umständen auch einen Tick zu laut und röchelnd – bei älteren Menschen ist dies nun mal nicht immer ein Ohrenschmaus. Doch es tat seinen Zweck, und allein das zählte: Die Frau drehte ihren Kopf zu mir, schaute mich an. Mehr noch: Sie strich sich das blonde Haar hinters Ohr, fing an zu lächeln. Ich lächelte zurück, in der wunderbaren Gewissheit: Ich war wieder im Geschäft! Bill is back!
Die Frau öffnete ihre vollen, zartrosa Lippen, befeuchtete sie noch einmal kurz. Dann sprach sie mich an.
»Brauchen Sie einen Arzt?«
Ihre Worte trafen mich so hart, dass ich fast tatsächlich einen Arzt gebraucht hätte. Doch habe ich durch dieses Erlebnis auch gelernt, meine Alterstarnkappe zu akzeptieren. Mehr noch: Ich weiß die mir auferlegte Aura des asexuellen Wesens inzwischen sogar zu genießen. Ja! Sie eröffnet mir ungeahnte Freiheiten, um die mich jeder Jüngling beneiden würde. Ein Beispiel: Seit nunmehr zwanzig Jahren bewohne ich unter dem Namen Erich Schiller einen erfüllenden TV-Zweitwohnsitz in der »Lindenstraße«. Mitunter betrete ich nichtsahnend unsere Garderobe – völlig zugekalkt in der Birne, dass heute ja wieder mal ein Hochzeitsbild für die Serie ansteht. Die Folge: Das halbe weibliche »Lindenstraßen«-Ensemble steht nackig vor mir, wie Gott es schuf. (Und zwar ohne Zweifel an einem Tag, an dem er verdammt gut drauf war.) Sobald die spärlich bekleideten Damen mich erblicken, reagieren sie jedes Mal kollektiv gleich:
Phase 1: Ein hochfrequentes, sich panisch bedeckendes »AAAAAAAAIIIIIIIIIIHHHHHH!!!!«
Phase 2: Ein aufatmendes, die Hüllen wieder fallenlassendes »Ach so, ist nur der Bill. Komm rein, wir dachten, du wärst einer von den Männern!«
Sicher verstehen Sie jetzt, was ich mit »ungeahnten Freiheiten« meine. Als Senior genießt du bei Frauen ähnliche Privilegien wie ein schwuler bester Freund. Sie wissen: Von dir geht keine Gefahr aus. Du bist harmlos wie ein kastrierter alter Kater zwischen all den heißen Kätzchen. Vom Don Juan zum Knuddel-Bill – meine ganz persönliche Evolution in den Augen der Frauen. Ich akzeptiere mein Schicksal und mache das Beste daraus.
Ach so, liebe »Lindenstraßen«-Kolleginnen: Ich hab auch gar nicht hingesehen. Großes Knuddel-Bill-Ehrenwort!
5.Bestatter begehren mich
Fühlen Sie sich manchmal verfolgt? Auf offener Straße, von wildfremden Menschen? Dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie ganz gehörig einen an der paranoiden Waffel haben und demnächst mit Ihrem topmodischen Anti-Gedankenles-Alufolienhut von den Männern mit den weißen Kitteln abgeholt werden. Es sei denn … ja, es sei denn: Sie werden alt.
Dann ist es keine Einbildung. Im Gegenteil, Sie beweisen guten Instinkt – schließlich sind Bestatter auf der Pirsch, immer und überall. Und das ist kein Wunder. Die Beerdigungsindustrie steckt in der Krise, und zwar tiefer als die Gräber ihrer Kunden! Schließlich lebt die Kundschaft immer länger und bleibt bis ins hohe Alter fit wie ein Turnschuh. Der einst so exklusive »Club der Dreistelligen« (die Ü-100) hat sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Da ist kein Ende in Sicht. Meine eigene Mutter wurde wie gesagt 101, die Queen Mum schaffte 102. Laut »Stern« hat unsere Generation die Aussicht, 120 zu werden! Klar, dass eine solche Entwicklung für Bestatter tödlich ist.
Oder eben nicht – genau darin liegt ja deren Problem. In der Titelgeschichte der letzten »Schöner Sterben« (das offizielle Bestatter-Fachorgan) konnte man die ungeschminkte Wahrheit schwarz auf weiß nachlesen: »Die Sterbefreudigkeit in Deutschland hat in den letzten Jahren dramatisch nachgelassen.« So schaut es aus. Der Verbandspräsident der Bundesbestatter wiederholt unermüdlich bei jeder Gelegenheit: »Unsere Devise ist Akquise!«
Darum Augen auf, Freunde: Bestatter sind die Groupies der Senioren – sie verfolgen dich überall. Kaum sehen sie dich die Straße entlangschlurfen, kommen sie auch schon gierig geifernd, mit ausgestreckten Armen auf dich zugerannt. Natürlich wollen sie genau wie Groupies von Rockstars nur das eine von dir: deinen Körper. Sie wollen dich mit Haut und Haaren. Und sie wollen dich kalt.
Bestatter wittern den süßlichen Geruch der Verwesung bereits Jahrzehnte vor allen anderen Menschen. Wie ein Hai, der einen einzigen kleinen Tropfen Blut im weiten Ozean riecht, wird ihr Jagdtrieb in genau dem Moment geweckt, in dem ich alter Zausel um die Ecke komme. Wenn ich dann auch noch, ein klein wenig blass um die Nase, niese, ist alles zu spät: Innerhalb weniger Sekunden bin ich umzingelt von einer Traube von Bestattern, die mit vollem Körpereinsatz um mich buhlen, als sei ich der Robbie Williams unter den potentiellen Totenstars. Einerseits fühle ich mich davon gebauchpinselt, kann mich einem gewissen Geschmeicheltsein nicht verwehren – sie wollen schließlich nicht irgendeinen 08/15-Leichnam in ihrem Sarg liegen haben, nein: Sie wollen mich! Andererseits nervt es manchmal auch ganz schön. In meiner Nachbarschaft in Bonn-Endenich gibt es ein ganz besonders hartnäckiges Exemplar dieser Spezies: »Herr Sannemann«, seines Zeichens überengagierter Bestatter in der dritten Generation. Bringt seit vierzig Jahren alles, was nicht bei drei noch Herzschlag hat, erfolgreich unter die Erde. Wir treffen uns oft in der Metzgerei Lüpke, wo Herr Sannemann stets genau hinter mir steht. Sein Atem formt Eiskristalle in meinem Nacken, wenn er mir mit hoher Fistelstimme ins Ohr flötet:
»Naaaaaaa, Herr Mockridge, geht’s Ihnen gut?«
Ich stelle sofort klar, dass er wie immer zu früh dran ist.
»Blendend! Gut, sehr gut! Na ja, letzte Woche war mir so ein bisschen schwindelig …«
Die Augen von Herrn Sannemann fangen freudig an zu leuchten.
»Ach jaaaaaa?«
»Nein, nein – nicht, was Sie jetzt denken! Machen Sie sich keine Hoffnung. Mir geht’s wieder tot … tut … gut! Mir geht’s total gut!!«
Der Schweiß rinnt bereits hektoliterweise von meiner Stirn. Herr Sannemann lässt derweil nicht locker.
»Ja, und die Kinderchen?«
»Auch. Quicklebendig, kein Bedarf!«
Als ich dann endlich an der Fleischtheke dran bin und nur noch so schnell wie möglich aus dieser Metzgerei und den Fängen von Herrn Sannemann entfliehen will, fistelt dieser mir weiter ins Ohr.
»Haben Sie das von Willy Thieves gehört?«
»Nee, was ist mit dem?«
»Heute Morgen gestorben.«
»Wie – tot?«
»Ich glaube, ja. Jedenfalls liegt der bei mir im Keller und ist nicht sehr redselig.«
»Oh Gott. Das ist ja schrecklich!«
Frau Lüpke verpackt mein Gehacktes. Ich will nur noch raus hier. Kann mir die Frage aber nicht verkneifen.
»Wie kam das denn?«
»Der ist heute mit den Enkeln in den Streichelzoo gefahren. Plötzlich kippte er um, knallte auf eine Bergziege … War sofort tot.«
»Wie, die Bergziege?«
Herr Sannemann kann ein irres Kichern nicht unterdrücken. Draußen hört man keinen einzigen Vogel mehr zwitschern.
»Ja, die auch. Verrückt, oder? Wie das Leben so spielt. Morgens im Zoo, abends bei mir im Keller.«
Die ganze Zeit, während Bestatter Sannemann mit mir redet, denke ich: Er ist die ganze Zeit heimlich am Kalkulieren. Guckt an mir herunter, von oben nach unten – fehlt nur noch, dass er direkt das Maßband herausholt. Sannemann sieht schon längst nicht mehr mich, Bill Mockridge, vor sich stehen. Er sieht: Eiche rustikal, Messinggriffe, teure Innenausstattung.
»Sie schauen müde aus, Herr Mockridge …«
Ich schnappe mir mein Fleisch, gebe Frau Lüpke fast vier Euro Trinkgeld, nur um nicht noch auf mein Wechselgeld warten zu müssen.
»Es wird langsam Zeit für mich abzutreten, äh, heimzugehen, ich wurde heimgerufen, äh, ich meine: Ich muss heimgehen, ich muss gehen!«
»Ja, ja. Wir müssen alle gehen, machen Sie sich da mal keine Sorgen.«
»Ja, Wiedersehen, Herr Sensemann … äh, Sannemann!«
Ich stolpere an den anderen Kunden vorbei zur Tür. Als ich mich noch einmal kurz umdrehe, sehe ich Herrn Sannemann mir lächelnd mit seinen dürren, knochigen Fingern hinterherwinken.
»Wir seeeeehen uns!«
So anstrengend meine unfreiwilligen Rendezvous mit Bestatter Sannemann auch sind – sie lassen mich trotzdem über die Frage nachdenken: Wie genau möchte ich eigentlich irgendwann einmal »endgelagert« werden? Normales Einbuddeln scheint ja inzwischen fast schon was für Spießer. Für Menschen, deren Angehörige beim Sandschaufeln auf der Beerdigung nur mitleidig denken: »Er war ja schon immer sehr phantasielos.« Nein, etwas Außergewöhnliches, Spektakuläres muss heutzutage her – etwas, für das man sterben könnte beziehungsweise genau dies getan hat.
Vielleicht Seebestattung? Lieber nicht – ich werde so schnell seekrank.