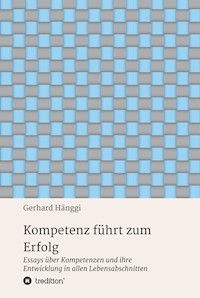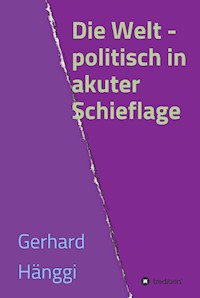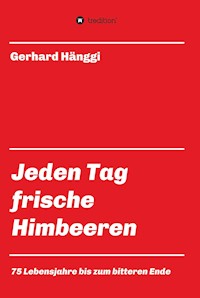
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeden Tag frische Himbeeren ist die Lebensgeschichte eines Mannes, der stets für andere Menschen da war und sich dabei selbst vergessen hat.
Das E-Book Jeden Tag - frische Himbeeren wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Partnerschaft, Trennung, Ausgrenzung, Suche nach Glück, Ehekrise, Untreue, Eheglück, Flucht in den Beruf, Verlust von allem
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Gerhard Hänggi
Jeden Tagfrische Himbeeren
© 2019 Gerhard Hänggi
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-1451-9
e-Book:
978-3-7482-1453-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Kapitel 1 Die Jugendjahre – prägend fürs Leben
Kapitel 2 Wissensvermittlung im Fokus
Kapitel 3 Erste Ehe und steile Berufskarriere
Kapitel 4 Erfolgreiche Kampf um eine neue Beziehung
Kapitel 5 Die Kinder als Instrument gegen die Beziehung
Kapitel 6 Beruf als Kompensation der Entbehrungen
Kapitel 7 Wieder ein Sanierungsfall in der Textilbranche
Kapitel 8 Der Schritt zum Mitinhaber einer IT Firma
Kapitel 9 Wieder lockte das Ausland.
Kapitel 10 Der grösste Auftrag und das abrupte Ende
Kapitel 11 Rückkehr und Neuorientierung
Kapitel 12 Doch noch einen Grossauftrag anderer Art
Kapitel 13 Mit 60 Jahren noch einmal durchstarten
Kapitel 14 Finanzielle Sicherung im Pensionsalter
Kapitel 15 Tagebuch nach der Rückkehr aus der Klinik
Kapitel 16 Systematische Demontage – Auszüge aus den Aufzeichnungen
Nachwort
Ein besonderer Dank für die professionelle Unterstützung bei der Herstellung dieses Buches gebührt dem Redaktionsteam des Verlags tredition GmbH, Hamburg, insbesondere Frau Theresa Reichelt.
Einleitung
Diese Lebemsgeschichte schildert die Ereignisse über einen Zeitraum von 75 Jahren, die teils von diesem Mann, nennen wir ihn Gerd, selbst ausgelöst worden sind – teils aber auch von seiner Umgebung verursacht worden sind.
Die Lebensgeschichte zeigt aber auch auf, dass die Gestaltung des Lebens für den Menschen sehr komplex und vielfach kompliziert ist. Ebenso wird dokumentiert, dass die Bildung allein kein Garant für ein geruhsames Leben ist - vor allem, weil die Themen zur Lebensgestaltung und Lebensführung in den Schulen viel zu wenig oder gar nicht behandelt werden.
Natürlich gab und gibt es in jeder Generation gesellschaftliche Veränderungen, die stets eine Gruppe von Menschen im Guten wie im Bösen treffen. Die vergangenen Jahrzehnte haben unsere Welt, unsere Gesellschaft im Zehnjahres Rhythmus drastisch verändert: Tabus sind gefallen, rasender Fortschritt der Technik, ungestüme Veränderungen in der Politik, Öffnung der Welt für eine, noch heute nicht verstandene, Globalisierung. Es ist offenbar der Zeiten Lauf, der unser relativ kurzes Gastspiel auf dieser Erde prägt, uns auftreten lässt – und früher oder später auch wieder gehen lässt.
Eines scheint jedem Menschen in die Wiege gelegt zu sein: das Verlangen nach Geborgenheit, Sicherheit, Wärme, Fürsorge, Zärtlichkeit, Liebe – alles zu seiner Zeit. Vielleicht sind das die wichtigsten Attribute, die ein Leben lebenswert machen. Die Lebensgeschichte von Gerd scheint dies auf jeden Fall glaubhaft erscheinen zu lassen. Sie schildert die Stärken und Schwächen eines nach Lebensglück suchenden Menschen, der sein Leben über alle Jahre weitestgehend selbst gestalten musste.
Die Personen, die in seinem Leben eine tragende Rolle gespielt haben, sind eher auf der Seite der Nehmenden, denn auf der Seite der Gebenden gestanden. Für einen Menschen, der selbst viel gibt, ist es aber auch unerlässlich, dass er auch nehmen darf oder ihm gegeben wird. Dankbarkeit, Wertschätzung, Zuneigung sind vielleicht die Attribute des Gebens. Keine Selbstverständlichkeit, wie diese Lebensgeschichte zeigen wird.
Eine zusätzliche Erfahrung, die jeder Mensch einmal oder mehrmals im Laufe des Lebens macht, ist das Phänomen der Liebe und ihrer vielartigen Facetten.
Konträr ist die Meinung derer, die überzeugt sind, dass letztlich jeder seines Glückes eigener Schmied sei. In Tat und Wahrheit trifft dies nur auf einen sehr kleinen Prozentsatz Menschen zu. Die überwiegende Mehrheit ist in ihrer Lebensgestaltung von anderen Menschen abhängig, von zufälligen Begegnungen, von Glücksmomenten, von Fügungen, für die es keine rationalen Erklärungen gibt.
Die Gesellschaft trägt eigentlich auch eine Mitverantwortung an der Entwicklung einer positiven Lebensgestaltung der Menschen, die Teil dieser Gesellschaft sind – wo immer sie leben auf dieser Welt.
Kapitel 1Die Jugendjahre – prägend fürs Leben
Wir versetzen uns zurück ins Jahr 1940. Keine heile Welt rund um die Schweiz. Der 2. Weltkrieg voll im Gang. Ängste überall weit verbreitet. In dieser Zeit und Situation ein Kind in diese Welt zu bringen, braucht schon etwas Mut. Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Der Junge war kräftig und hat sich durch lautes Schreien sofort bemerkbar gemacht. Die Mutter war glücklich. Es war ihr erstes Kind – und erst noch ein Junge! Nach 7 Tagen Wochenbett konnten Mutter und Kind das Spital verlassen.
Der Vater hatte in der Zwischenzeit in der kleinen Genossenschaftswohnung in der guten Stube ein Kinderbett aufgestellt, bei dem nur noch der Stoffbaldachin fehlte. Diesen auszusuchen und aufs Mass zu nähen überliess er gerne seiner Frau. Die Grosseltern wohnten unweit ihres Wohnortes – ebenfalls an der Peripherie der Stadt. Die Wohnung war eine Genossenschaftswohnung im Erdgeschoss einer vierstöckigen Häuserzeile mit grosser Gartenfläche nach hinten. Sie bestand aus einer grossen Wohnküche mit Ausgang zu einer geräumigen Terrasse und Blick in den Garten. Gekocht wurde mit Gas. Selbstverständlich wurde auch in dieser Küche, in deren Mitte ein grosser Esstisch stand, gegessen.
Wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt befand sich ein Lebensmittelgeschäft des Konsumvereins, eine Bäckerei und ein Coiffeur Salon.
Der Junge war ein aufgewecktes Baby und schrie einfach, wenn er die Aufmerksamkeit auf sich richten wollte. Ihn zu beruhigen geschah meistens durch Trinken lassen. Eine weitverbreitete Meinung war damals, dass ein Kind, das schrie, einfach Hunger hatte, also gestillt werden musste oder später die Flasche bekam mit einem ziemlich dickflüssigen Brei aus Milch und Hafer. Gerd war dann still und zufrieden, wenn er satt war.
3 Jahre später kam der Bruder zur Welt. Er erbte das Kinderbett, und Gerd bekam ein etwas Grösseres vom gleichen Hersteller. Die Konzentration auf den Bruder war Gerd gar nicht so aufgefallen. Vielleicht gab es sie auch nicht in einer auffälligen Form.
Das Wohnquartier, das aus reihenweisen Genossenschaftshäusern bestand, war ein Quartier mit vielen jungen Familien, die das Glück hatten, eine relativ günstige Wohnung mieten zu können. Komfort wurde allerdings sehr klein geschrieben, denn die Wohnungen mussten vor allem günstig sein. Eine Standardwohnung bestand aus einer Essküche, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer sowie einer getrennten Toilette mit Lavabo. Eine Dusche oder gar ein Bad waren nicht vorhanden. Wer sich waschen wollte, tat dies entweder in der Küche oder im kleinen Toilettenraum. In jedem Haus, in dem 4 Wohnungen enthalten waren, gab es eine Waschküche im Keller. Dort gab es auch eine Dusche, die jedem Bewohner einmal in der Woche zur Verfügung stand.
Gegen den Hof gab es eine grosse Terrasse, 2 Meter tief und 8 Meter lang. Diese Terrasse war vor allem im Sommer für Gerd und Hampe, nennen wir den jüngeren Bruder einfach so, ein wunderbarer Spielort. Es war aber auch der Ort, wo Mutter Anna den Zuber mit Wasser und Seifenflocken für ein Bad vorbereitete. Bei grosser Hitze – und es gab in der Tat solche Sommer – spritzte Anna ihre Buben mit dem Gartenschlauch ab.
Das Alltagsleben war in diesem Wohnquartier der Stadt mehr als bescheiden. Die Eltern lebten nach dem klassischen Muster: die Frau in der Rolle Hausfrau und Mutter versorgte den Haushalt und kümmerte sich um Küche und Kinder. Der Mann, in der Rolle als
Berufsmann und Vater ging einer Arbeit in einer Fabrik oder in einem Gewerbebetrieb nach. Die Mutter von Gerd und Hampe war der Haushaltsvorstand. Sie bestimmte, was in dieser Familie zu geschehen hat. Sie organisierte alles rund um die Familie. Der Vater, ursprünglich mit Wurzeln in der französisch sprechenden Schweiz, las täglich die Zeitung Le Matin, sprach meistens französisch wie seine Mutter, die kein Wort Deutsch konnte.
Die Buben gingen in den nahegelegenen Kindergarten, meistens zusammen mit den anderen Kindern aus den Genossenschaftswohnungen. Nach dem <Kindergarten> spielten sie auf einer kleinen Wiese bei schönem Wetter Fussball. Zuhause spielten sie mit einer Tisch-Eisenbahn, die ein aufziehbares Federwerk besass und auf den Aluminiumschienen in einem Oval drei Runden fahren konnte. Manchmal spielte der Vater noch mit den Buben das Brettspiel <Eile mit Weile>.Es war der erste Anlass, bei dem die Buben die Zahlen auf dem Würfel kennenlernten. Auf den 6 Würfelseiten waren die Punkte 1 bis 6 – und wer die 6 würfelte, durfte ein weiteres Mal würfeln.
Kaum das Alter für den Eintritt in die Primarschule erreicht, wurde der Schulweg doch etwas weiter als vorher. Gerd erhielt zum Schulanfang und gleichzeitig zum Geburtstag einen Schulsack mit echtem Kuhfell überzogen, zusammen mit einem hölzernen Federkasten mit einem Aufdruck von Kühen. Auch eine Schiefertafel mit Kreidestiften gehörte zur Erstausrüstung. Das Schulhaus, nach Jeremias Gotthelf benannt, war ein stattlicher Bau mit Sandsteinfassade.
Der erste Schultag war spannend. Im Vorhof der Schule mussten die Kinder warten bis sie in die entsprechende Klasse aufgerufen wurden. Gerd kam in die Klasse 1D, in der insgesamt 30 Schüler waren. Lauter Buben aus der näheren Umgebung. Lehrer Ziegler war bereits kurz vor seiner Pensionierung – ein Lehrer also, der keine Bäume mehr ausreissen wollte. Er legte Wert darauf, dass die Hausaufgaben ordentlich gemacht wurden, die er stets zu Beginn der Schule kontrollierte. Des Weiteren untersagte er jedes Gespräch mit dem Schulbanknachbarn. Wer sich nicht daran hielt, bekam eine schlechtere Betragensnote. Die Schulbewertung war in Noten von 1 für sehr gut bis 5 schlecht gegliedert. Halbe Notenschritte, also z. B. 1-2 hat es auch gegeben.
Gerd war sehr begabt, lernte schnell und hatte ein gutes Erinnerungsvermögen. Während der gesamten Primarschulzeit hatte er bis zum letzten Zeugnis ausschliesslich Benotungen mit 1. Im letzten Zeugnis wollte Herr Ziegler ihm eine 1 .2 als Betragensnote geben. Gerd wurde sehr wütend und hat schliesslich erreicht, dass die Note bei 1 blieb. Die Primarschule war für Gerd langweilig, denn er hat mit seiner guten Auffassungsgabe den gesamten Lehrstoff sehr schnell intus und langweilte sich dann in den Wartezeiten, bis die Mitschüler soweit waren.
In der Zeit der Primarschule hat Gerd zu Hause neben Deutsch auch Französisch gelernt. Die Wörter hat er in einem Wörterbüchlein aufgeschrieben. Französisch gesprochen hat er mit seinen Eltern und der Grossmutter väterlicherseits.
An Sonntagen hat er zu Hause nach dem Kirchgang noch einmal mit seinem Bruder eine <Messe> zelebriert und eine Predigt gehalten.
Anfang der 50iger Jahre waren auch die ersten Bequemlichkeiten für den Haushalt erfunden worden. Etwa der Kühlschrank, der ein vertikales Einschubfach mit Wasserablaufhahn für Stangeneis hatte. Das Stangeneis wurde von den Bierbrauern geliefert, die mit ihren Pferdewagen das Eis in die Haushalte geliefert hatten. Die erste Waschmaschine mit Wasserantrieb war ebenfalls im Waschhaus installiert worden. Mit dem Metallbaukasten konnten Fahrzeuge, Kräne und Maschinen zusammengeschraubt werden. Auf den Strassen sind zusehends mehr Autos zu sehen.
Ein besonderes Ereignis relativierte Gerd’s Verhältnis zur Religion. Gerd war sehr religiös erzogen worden und war Mitglied der Pfadfinder in seiner Kirchgemeinde. Da er gut singen konnte, wirkte er auch bei den Sängerknaben mit und hat es dort, seiner exzellenten Stimme wegen, zum Solosänger geschafft. Der sonntägliche Kirchgang war Pflicht. Bei den Pfadfindern wurde Gerd bald Gruppenleiter und machte erste Bekanntschaft mit einer Führungsaufgabe.
Stark getrübt wurde sein Verhältnis bei einem Besuch im Kloster Mariastein, unweit von Basel. Die Pfadfinder durften hinter die Kulissen des Klosters schauen und sehen, wie die Mönche dort lebten. Die kleine Gruppe wurde aufgeteilt. Gerd konnte mit einem älteren Mönch den Wohntrakt besuchen. Die spartanische Einrichtung der Mönchszellen beeindruckte ihn sehr. Doch plötzlich griff der Mönch an Gerd’s kurze Manchesterhose und sagte, sie hätten Zeit. Gerd blieb wie erstarrt stehen, drückte wenig später den Arm des Mönchs weg und wollte sofort aus dem Wohntrakt gehen. Der Schock sass tief, und Gerd’s Verhältnis zur Religion und deren Vertreter wurde stark relativiert. Darüber sprechen konnte er in jener Zeit mit niemandem. Geglaubt hätte dies ohnehin niemand.
Mindestens einmal im Monat mussten die Pfadfinder zur Beichte. Der Beichtstuhl war verdunkelt, der Priester hinter einem Gitter. Man musste alle Sünden, die man seit der letzten Beichte getan hat, berichten. Abgefragt wurden die 10 Gebote. Gerd war fest entschlossen, das Erlebnis im Kloster zu berichten. Der Priester schien ein besonderes Interesse an diesem unglaublichen Ereignis gehabt zu haben. Er wollte Details hören und hat gefragt, ob Gerd’s Glied denn steif geworden wäre. Er meinte dann, dass dies keine Sünde wäre, sondern eine natürliche Begegnung zweier Menschen, in diesem Fall Männer, die sich nichts Böses tun, sondern ein gutes Gefühl austauschen wollen. Gerd hat das Gespräch jäh abgebrochen, denn er sah, wie der Priester unter seiner Sutane sich zu schaffen machte. Ein weiterer Schock für Gerd, der die Absolution nicht mehr abwarten wollte, sondern den Beichtstuhl fluchtartig verliess.
Mit einem Mal wurde Gerd bewusst, dass ein Kloster unter anderem ein Zufluchtsort für Homosexuelle ist und offenbar die Priester in der Kirche ebenfalls sexuell gestört wären. Seine Meinung über das in dieser Religion verhängte Zölibat änderte sich drastisch. Fortan sah Gerd in jedem Priester einen Homosexuellen. Er trat aus dem Chor der Sängerknaben aus und verliess wenig später auch die Pfadfinder. Für Gerd waren diese Ereignisse in der Pubertät besonders schwierig zu verstehen.