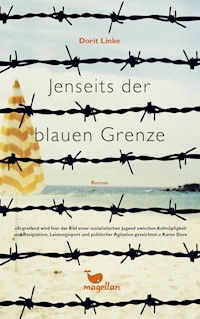
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die DDR im August 1989: Hanna und Andreas sind ins Visier der Staatsmacht geraten und müssen ihre Zukunftspläne von Studium und Wunschberuf aufgeben. Stattdessen sehen sie sich Willkür, Misstrauen und Repressalien ausgesetzt. Ihre einzige Chance auf ein selbstbestimmtes Leben liegt in der Flucht über die Ostsee. Fünfzig Kilometer Wasser trennen sie von der Freiheit – und nur ein dünnes Seil, das ihre Handgelenke verbindet, rettet sie vor der absoluten Einsamkeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dorit Linke, geboren 1971 in Rostock, wuchs in der DDR auf. Sie machte Abitur, war Leistungssportlerin und Rettungsschwimmerin. Den politischen Wandel Ende der Achtziger erlebte sie bewusst mit, nahm an den Montagsdemonstrationen teil und war achtzehn Jahre alt, als die Mauer fiel.
Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Jenseits der blauen Grenze ist ihr erster Roman und wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Lehrerinnen und Lehrer finden hier
eine kostenfreie Lehrerhandreichung zum Download:
www.magellanverlag.de/lehrerhandreichungen
Dorit Linke
Jenseits der blauen Grenze
Inhalt
Jenseits der blauen Grenze
Danksagung
Glossar
Textnachweise
Wenn wir Sachsen-Jensi am Kurfürstendamm wiedersehen, wird er noch immer seine blöde Popperfrisur haben. Und sein BMW wird alt und verschrammt sein, aber das wird ihm nichts ausmachen. Uns auch nicht. Wir werden uns alle riesig freuen und unendlich stolz aufeinander sein.
Unsere Taschen liegen vergraben unter einem Hagebuttenstrauch. Findet sie jemand, ist alles vorbei. Die Feldflasche habe ich mit Muttis Gürtel am Körper befestigt. Er hat eine goldene Schnalle und ist so hässlich, dass sie ihn nicht vermissen wird.
Nachher müssen wir im richtigen Moment loslaufen und kriechen, so wie wir es beim Pioniermanöver gelernt haben.
Bloß nicht ins Licht der Scheinwerfer geraten, das kilometerweit über den Strand wandert. Die Stelle, die wir uns ausgesucht haben, ist gut, weit weg vom Grenzturm.
Es ist viel NVA um uns herum. Direkt hinter uns steht ein Schild.
Sperrzone. Betreten und Befahren verboten.
Opa hat mir gesagt, dass ich auf die Posten aufpassen soll. Die werden an uns vorbeilaufen, außerdem werden Autos mit gleißenden Scheinwerfern herumfahren. Er hat mir auch gesagt, dass die Suchscheinwerfer nach einer Stunde zum Kühlen ausgeschaltet werden müssen. So einen Moment werden wir nutzen, um runter an die Ostsee zu laufen.
Am Wasser liegt ein Findling, hinter dem wir uns verstecken können. Wir werden rasch unten sein. Der Sandstrand ist hier nicht so breit wie in Warnemünde. Später in der Ostsee tauchen wir einfach unter, wenn das Scheinwerferlicht auf uns zukommt.
Mutti habe ich einen Zettel unter die Bettdecke gelegt. Sie soll sich keine Sorgen machen. Wird sie wohl trotzdem. Sie wird mich nicht in Kühlungsborn vermuten, sondern an der Neptunschwimmhalle auf mich warten. Gestern habe ich mich beinah verraten, weil ich ihr beim Wetterbericht über den Mund gefahren bin. Normalerweise interessiere ich mich dafür nicht.
Fünfzig Kilometer bis nach Fehmarn. Das ist echt weit.
Wenn die Strömung mitspielt, schaffen wir die Strecke in fünfundzwanzig Stunden. Momentan herrscht ablandiger Wind. Hoffentlich bleibt es dabei. Wenn es dunkel ist, werden wir losschwimmen, dann sind wir schon ein Stück vom Land entfernt, wenn die Boote in der Morgendämmerung nach Flüchtlingen suchen. Kommt eine Patrouille, tauchen wir unter und atmen durch unsere Schnorchel, die ich gestern im Keller mit Plastikschläuchen verlängert habe. Als Nachbarin Lewandowski mich damit hantieren sah, wollte sie wissen, wozu das gut sei. Ich habe ihr von den Karpfen im Dobbertiner See erzählt, die ich beobachten wollte.
Neunzehn Grad Wassertemperatur, das ist gut. Weiter draußen wird es kälter sein. Das wird hart. So viel trainieren kann man gar nicht. Doch wir werden es schaffen. Endlich ist es so weit! Ich bin aufgewühlt und gleichzeitig ruhig, auf unser Vorhaben konzentriert.
Andreas sieht blass aus. Zum Glück ist er dabei, ohne ihn könnte ich es nicht. Gerade hat er mir zugelächelt.
Er hat Angst. Ich auch, aber darüber darf man nicht nachdenken.
Andreas hält Die schwarze Feluke in der Hand. Für Sachsen-Jensi, in Folie eingeschweißt. Das einzige Mosaik-Heft, das ihm in seiner Sammlung noch fehlt, erschienen im November 1982. Im Westen bekommt er das nicht, wir müssen es ihm mitbringen. Das haben wir ihm versprochen.
Piraten auf dem Cover, Fischerboote, hochschlagende Wellen, Leuchtfeuer und Männer mit Turbanen. Andreas betrachtet das Bild, das so blau ist wie die Dämmerung, die uns umhüllt. Bestimmt möchte er durch das Heft blättern, doch das geht wegen der Folie nicht.
Ins Heft habe ich einen Zettel gelegt, da steht die Telefonnummer meiner Eltern drauf. Falls etwas passiert und jemand das Heft findet, weiß er, wo er anrufen muss.
Was würde Sachsen-Jensi sagen, wenn er uns sehen könnte, hier in den Dünen, wartend, mit Blick auf die Ostsee? Hitze in meinem Magen, vor Aufregung! Ein angenehmes Gefühl. Ich bin glücklich, dass wir aufbrechen werden, fühle mich das erste Mal seit Monaten wieder leicht, fast unbeschwert. Ich schließe die Augen und atme tief ein. Es riecht nach Salzwasser und nach Algen. Ich öffne die Augen wieder. Hagebuttenfrüchte baumeln zwischen mir und dem spiegelglatten Wasser, einige Meter entfernt wächst Strandhafer.
Sachsen-Jensi würde uns davon abhalten, weil er ein Angsthase ist. Ich lächle. Vor vielen Jahren hab ich ihm im Matheunterricht mal Hagebuttensamen in den Kragen geschmissen und darauf herumgerieben. Er hat sich so affig gekratzt, dass Frau Bauermeister ihn aus der Klasse warf.
Andreas öffnet den Reißverschluss seines Neoprenanzugs und schiebt das Mosaik-Heft zu seinen Dokumenten: Personalausweis, Geburtsurkunde, Abschlusszeugnis der zehnten Klasse. Das Päckchen mit meinen Dokumenten habe ich zwischen Neoprenanzug und Badeanzug geschoben. Im Westen müssen wir schließlich beweisen können, wer wir sind.
Andreas hat wohl meinen Blick bemerkt. Er öffnet den Reißverschluss wieder und holt Die schwarze Feluke heraus.
»Nimm du es«, sagt er leise. »Kannst besser schwimmen.«
Das stimmt. Sofort habe ich wieder Angst. Ich will nicht darüber nachdenken, kann die Hand nicht ausstrecken.
»Nun mach«, sagt er drängend.
Unsere Finger berühren sich, als ich das Heft an mich nehme. Ich schlucke schwer, kann ihn nicht ansehen, schaue hinüber zur Ostsee.
»Wir werden es schaffen«, sage ich.
Wir müssen uns das immer wieder sagen, das ist ganz wichtig. Es wird hart werden. Wir müssen daran glauben, sonst halten wir nicht durch.
Um einundzwanzig Uhr werden wir losschwimmen, sobald der Mond untergegangen ist. Er ist kaum zu sehen, es ist fast noch Neumond, zwischen den Baumwipfeln ist die schmale Sichel zu erkennen. Sie spendet wenig Licht, trotzdem ist es besser, wenn sie nicht mehr da ist. Hat Opa gesagt.
Leichter Wind von Südost, genau richtig.
Der Tag ist schön gewesen, heiß und schwer. Wir sind schon früh angereist. Um keinen Verdacht zu erregen, wollten wir nicht erst mit der Dämmerung ankommen. Nachdem wir baden waren, haben wir ein Softeis auf der Promenade gegessen, umgeben von FDGB-Urlaubern. Ich kam mir wie eine Lügnerin vor. Für alle anderen war es ein normaler Tag an der Ostsee, aber nicht für uns. Wir schauten auf das blaue Wasser hinaus und wussten, was in der Nacht geschehen würde. Einmal jedoch vergaß ich es völlig, aß mein Eis und schaute einem Kind zu, das mit seinem Wasserball spielte, fühlte die Sonne, roch den Sommer. Einen Moment lang war ich glücklich. Dann fiel es mir wieder ein und ich hatte ein Kribbeln im Bauch wie beim Karussellfahren.
Am Nachmittag haben wir versucht, am Strand vorzuschlafen, weil wir in der Nacht nicht dazu kommen würden. Es hat aber nicht geklappt, wir waren viel zu aufgeregt. Ich bin nur einmal kurz weggedöst. Andreas zappelte in den Dünen neben mir herum und konnte nicht zur Ruhe kommen.
Später haben wir in einer Speisegaststätte Nudeln mit Tomatensoße gegessen, als Grundlage. Sportler essen immer Nudeln. Und viel getrunken haben wir auch, weil wir kaum Wasser mitnehmen können.
Andreas berührt meinen Arm.
Zwei Lichter, unten am Strand. Sie kommen!
Ich kauere mich tiefer ins Gebüsch, Andreas ist dicht neben mir. Ich merke, wie er den Atem anhält, auch ich erstarre völlig, ziehe den Kopf ein und wage kaum, in die Richtung zu schauen, aus der die Männerstimmen näher kommen. Es sind die Grenzposten, die regelmäßig den Strand kontrollieren und nach verdächtigen Dingen suchen. Wenn sie einen Hund dabeihaben, werden sie uns finden, dann ist alles bereits hier zu Ende.
Die Männer sprechen leise, verstehen kann ich sie nicht. Ein unruhiges, flackerndes Licht huscht durch die Zweige, kommt auf uns zu. Sie durchsuchen mit Taschenlampen das Gebüsch am Strand. Andreas drückt sich an mich. Das Licht tanzt vor unseren Augen, streift uns beinahe.
Dann erlischt es wieder. Die Männer bleiben stehen. Kein Hund, ein Glück.
Ich höre ein Räuspern. Wieso gehen sie nicht weiter? Mein Herz rast so stark, dass ich fürchte, sie könnten es hören. Wie in der Geschichte von Edgar Allan Poe.
Ein Licht glimmt auf, der Ausschnitt eines Gesichts im schwachen Lichtschein, dann ein zweites Licht. Zigaretten. Geruch nach Rauch, ganz leicht nur. Die beiden Posten gehen langsam weiter den Strand hinunter.
»Oh Mann«, flüstert Andreas neben mir. »Schwein gehabt.«
Der Wind ist kühl, ich friere. Wie soll es erst im Wasser sein? Vorhin haben wir uns mit Vaseline eingerieben und über zehn Tuben verbraucht. Ulrich hat mir den Tipp gegeben, so viel wie möglich aufzutragen. Im Wasser verliert der Körper viermal so schnell Wärme wie an der Luft. Wir müssen schnell schwimmen, um warm zu bleiben. Wir müssen das Gleichgewicht halten zwischen Wärmeerzeugung und Wärmeverlust, würde unser Physiklehrer Herr Kowalski sagen.
Die Vaselinetuben habe ich in der Drogerie gekauft, immer nur zwei auf einmal, damit es nicht auffiel. Doch beim letzten Mal hat die Verkäuferin so komisch geguckt, dass ich Schiss bekommen habe. Noch mal bin ich nicht hin. Durch die Vaseline wird die Wärme in unserem Körper bleiben. Unter dem Neoprenanzug kann man nicht viel anziehen, er ist so eng. Ich habe meinen Badeanzug, ein kurzes Shirt und eine Damenstrumpfhose an. Sie hat schon Laufmaschen, daher wird Mutti nicht sauer sein, dass ich sie einfach aus ihrem Schrank genommen habe.
Was Ulrich wohl sagen würde, wenn er mich jetzt sehen könnte? Hoffentlich hat er uns nicht verraten.
Die leeren Vaselinetuben sind nun mit unseren Taschen und unseren Klamotten vergraben. Irgendwann wird sie jemand finden und Alarm auslösen, aber nicht heute Nacht. Und morgen um diese Zeit sind wir vielleicht schon auf Fehmarn.
Die Suchscheinwerfer streifen uns immer wieder und tauchen den Strand in helles Licht. Zwischendurch ist es dunkel, auch der Mond ist nicht mehr zu sehen.
Andreas raschelt neben mir. Ein letztes Mal kontrolliert er, ob alles gut verpackt ist. Er hat eine Tasche dabei, die er an seinem Körper befestigt. Vier Tafeln Blockschokolade, Sachsen-Jensi wäre sicher neidisch. Mit dem Röhrchen Schmerztabletten könnte er weniger anfangen, auch das wasserfeste Klebeband würde ihn nicht interessieren. Und er würde niemals darauf kommen, wofür wir die Nylonschnur brauchen.
»Wickle die Tüte fester um die Schokolade und das Klebeband«, sage ich leise. Das Salzwasser darf nicht eindringen, sonst geht alles kaputt.
»Ja, klar«, murmelt Andreas und zieht den Reißverschluss der Tasche zu. Er tastet über die Halsmanschette und über die schwarze Kapuze seines Neoprenanzugs, unter der seine blonden Locken verschwunden sind. Er bindet sich den Bleigürtel um. Die Taucherbrille hängt um seinen Hals, Schnorchel und Flossen hat er in der Hand. Er wirkt unheimlich, düster und entschlossen, wie aus einem James-Bond-Film.
Abgesehen von meiner dunkelblauen Badekappe, die ich mir nun überstreife, sehe ich kaum anders aus. An meinem Neoprenanzug gibt es keine Kapuze, deswegen brauche ich eine Kappe. Sie reduziert den Wasserwiderstand und schützt vor Kälte. Den Anzug habe ich mir von Frank geborgt. Er hat mir auch seinen Kompass geliehen, den ich mir an mein linkes Handgelenk gebunden habe.
»Pass auf, dass deine Ohren richtig bedeckt sind«, sage ich leise.
Andreas weiß das, aber es schadet nicht, es noch mal zu sagen. Wasser in den Ohren kann schlimme Folgen haben. »Und deine Stirn muss bis zur Brille bedeckt sein, sie ist sehr kälteempfindlich.«
Ich streife mir die schwarzen Handschuhe über. Meine Hände müssen beim Schwimmen dunkel und unauffällig sein. Dann greife ich nach Schnorchel und Flossen. Wir werden sie erst im Wasser anziehen, über unsere Socken. Die Socken sollen laut Ulrich gegen das Scheuern helfen. Und die schwarzen Handschuhe sollen verhindern, dass meine Hände im Wasser gesehen werden.
Das grelle Scheinwerferlicht wandert über den Strand, wir warten darauf, dass es endlich ausgeschaltet wird.
»Hoffentlich hat dein Opa recht«, flüstert Andreas. Unter meiner Badekappe höre ich kaum, was er sagt.
Opa hat mir geholfen, die richtige Stelle zu finden. Er hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, als ich ihn fragte, von wo aus er über die Ostsee flüchten würde, wenn er es noch könnte. Für ihn sind solche Themen völlig normal, er freute sich richtig über die Frage und erzählte vom Sandstrand, der nicht zu breit und nicht zu schmal sein darf, vom dichten Gestrüpp an der Küste und von Findlingen am Wasser. Wir sind mit dem Bus nach Kühlungsborn gefahren und an den Strand gegangen, Opa lief zwischen den Urlaubern umher, fuchtelte mit dem Stock und rief: »Genau richtig hier! Und bloß nicht weiter nach Westen gehen, an der Bukspitze ist überall NVA!«
Was würde Opa sagen, wenn er jetzt hier wäre? Würde er mich bestärken? Hätte er noch mehr Tipps für mich?
Ich schaue dem wandernden Licht nach und sehe Opa unten am Strand mit seinem Stock herumlaufen. Das war vor weniger als sechs Wochen.
Schlagartig ist schwarze Nacht um uns, das Scheinwerferlicht verschwunden. Jetzt ist es so weit. Unsere Chance.
»Opa hatte recht«, sage ich leise.
Andreas räuspert sich. »Woher wusste er das?«
Von Genosse Johnson, Offizier der Grenzbrigade Küste. Mit ihm kegelt Opa einmal im Monat, füllt ihn mit Goldbrand ab und horcht ihn über die seeseitige Grenzsicherung aus. Wir haben die Informationen sozusagen aus erster Hand, falls Opa nichts hinzugesponnen hat. Was allerdings wahrscheinlich ist, er spinnt leider oft.
»Hanna.« Andreas berührt mich am Unterarm. Er will starten.
Ich hocke mich sprungbereit in den Sand, Andreas ist direkt neben mir.
»Denk dran, nicht mit den Armen kraulen«, sage ich. »Leichter Kraulbeinschlag und Brustschwimmzug.«
Wir dürfen nicht auffallen, das bedeutet auch, dass wir beim Schwimmen im Grenzbereich so wenige Geräusche wie möglich machen.
Hoffentlich kommt Andreas mit dem stärkeren Auftrieb klar. Es ist das erste Mal, dass er mit einem Neoprenanzug schwimmt, seine Westverwandten konnten ihn und den Bleigürtel erst vor zwei Wochen über die Grenze schmuggeln.
Meinen Bleigürtel habe ich von Ulrich bekommen.
Eine Amsel singt oben in den Bäumen. Hell dringt ihr Ruf durch die Dunkelheit und begleitet das Blätterrauschen, manchmal überschlägt sich ihre Stimme, wird laut und wieder leiser. Auch morgen wird sie hier singen.
Ich schaue zum Wasser, sehe die samtige Schwärze sich kräuselnder Wellen, höre die leise Brandung.
»Jetzt«, flüstert Andreas.
Ich laufe auf Socken durch den Sand. Oben an den Dünen sinke ich knöcheltief ein und falle fast hin, Andreas ist dicht hinter mir, berührt mich aus Versehen. Er bleibt auch irgendwo hängen, muss sich mit den Händen abstoßen. Während ich renne, fliegt mir Sand in die Augen.
Endlich sind wir hinter dem Findling. Wir bewegen uns nicht, lauschen in die Nacht und atmen schwer. Ich spüre den Rand einer Muschel unter dem Knie, rieche Seetang. Hier unten weht der Wind stärker, auch die Geräusche haben sich verändert, ein Rauschen umgibt uns, obwohl kaum Wellengang ist.
Ich bilde mir ein, noch immer die Amsel singen zu hören.
Mein Herz schlägt wild, obwohl ich bisher keinen Meter geschwommen bin.
Noch könnten wir zurück, noch hat uns niemand bemerkt.
»Los. Weiter.«
Wir waten durchs Wasser. Es ist wärmer als die Luft, die nach Sonnenuntergang stark abgekühlt ist. Wir gehen leicht gebückt. Trotz der Aufregung muss ich lachen. Wenn ein Licht auf uns gerichtet wird, sieht man uns, ob wir nun gebückt laufen oder nicht. Zum Glück bleibt es dunkel um uns.
Als mir das Wasser an die Hüfte reicht, höre ich auf zu waten. Auch Andreas bleibt stehen. Ich ziehe mir die Handschuhe aus, halte sie mit den Zähnen fest und streife mir die Flossen über die Füße. Es ist nicht leicht, ich bekomme das Ende der Flossen nicht über meine Hacken. Vermutlich wäre es besser gewesen, das bereits an Land zu tun. Aber dann wäre das Waten anstrengend gewesen. Ich lasse mich nach hinten ins Wasser fallen, um besser an den Flossen ziehen zu können. Sofort dringt kaltes Wasser in meinen Neoprenanzug, füllt die Zwischenräume meiner Kleidung und der Gummihaut. Es ist unangenehm. Doch das Wasser wird sich rasch auf Körpertemperatur erwärmen und isolierend wirken.
Dann habe ich es geschafft, die Flossen sind dran. Ich stelle mich wieder auf den Meeresboden. Er ist von der Strömung stark gewellt, das spüre ich sogar durch die Flossen.
Ich setze mir die Taucherbrille auf und schiebe das Schnorchelende durch den Riemen der Brille, damit der Schnorchel stabil bleibt.
Andreas holt die Nylonschnur heraus, reicht sie mir. Ich binde die Schnur um sein linkes Handgelenk und ziehe den Knoten fest. Das andere Ende kommt an mein rechtes Handgelenk. Nun können wir uns im Wasser nicht verlieren und uns über die Schnur Zeichen geben.
Noch immer habe ich die Handschuhe zwischen den Zähnen. Die Wolle juckt an meiner Lippe. Ich ziehe sie über meine Hände. Sie zittern vor Aufregung.
Gleich geht es los.
Ich stecke mir das Schnorchelmundstück zwischen die Zähne, es drückt am Zahnfleisch, doch das ist normal und wird nach einer Weile vergehen, zumindest war es beim Training immer so. Allerdings bin ich nie länger als acht Stunden mit Schnorchel geschwommen.
»Ich bin so weit«, flüstert Andreas.
Ich justiere die Feldflasche. Muttis Gürtel hält sie fest an meinem Bauch, hoffentlich ist sie beim Schwimmen nicht zu sehr im Weg. Trainieren konnte ich damit nicht, weder im Schwimmbad noch in der Ostsee. Hätte mich jemand gesehen, wäre ich sofort verhaftet worden.
Ich schaue zurück zum Land.
Das letzte Mal für eine lange Zeit habe ich Boden unter den Füßen.
Ich stoße mich vom Meeresboden ab und schwimme los. Nach einigen Metern dringt kaltes Salzwasser in meine Taucherbrille. Ich fluche leise. Nie halten die Dinger dicht. Ich muss die Brille richten, suche unter mir den Meeresboden, kann ihn gerade noch mit den Flossenspitzen berühren, finde dadurch ein wenig Halt.
»Meine Tasche ist nicht richtig fest«, flüstert Andreas. Er muss sich nach den wenigen Schwimmstößen auch noch einmal sortieren.
Ich löse die Brille und lasse das Wasser herauslaufen. Mit dem Finger drücke ich auf das Sichtfenster und presse Luft heraus, erzeuge einen Unterdruck. Dadurch tun mir ein wenig die Augen weh, aber immerhin kann nun kein Salzwasser mehr eindringen. Das würde mehr Schaden anrichten.
Langsam bewege ich meine Beine, fühle den Druck der Flossen, vergrößere die Beinschlagamplitude, aber nicht zu sehr, damit ich nicht durch die Wasseroberfläche stoße. Die Feldflasche bremst meine Bewegung ein wenig, doch das fällt nicht zu sehr ins Gewicht.
Ich höre den leichten Wellenschlag, der von meinen Atemgeräuschen überlagert wird. Weil ich durch den Schnorchel atme, erscheinen sie mir lauter als sonst.
Ich mache einen Brustschwimmzug mit den Armen, was nicht so einfach ist, wenn man mit den Beinen krault. Allmählich finde ich meinen Rhythmus, fühle den Widerstand des Wassers an meinen Händen. Wegen des höheren Salzgehaltes ist es fester als im Schwimmbad.
Immer wieder ist die Wasserlinie direkt vor meinen Augen. Die Grenze zwischen Luft und Wasser. Ich tauche mit der Vorwärtsbewegung unter, atme aus, lasse mich vom Wasser tragen, komme wieder an die Oberfläche.
Andreas’ Flossen klatschen aufs Wasser. Er merkt es, korrigiert seine Bewegungen. Wir dürfen hier draußen keine lauten Geräusche machen.
Ich atme durch den Schnorchel, damit der Kopf unter Wasser bleiben kann, ich ihn nicht drehen muss. Jede Bewegung kostet Energie.
Nach wenigen Metern merke ich, was ich schon lange weiß. Es ist alles ganz anders als im Schwimmbad. Ulrich ist nicht hier, keiner gibt Anweisungen. Wir sind auf uns allein gestellt.
Ich höre nur das Glucksen der Wellen, die sich an meinem Körper brechen. Aus der dunklen Tiefe steigen Blasen auf.
Leise schwimmen wir hinaus auf die Ostsee, nach Norden.
»Welche Rekorde willst du eigentlich brechen?«
Ulrich zwinkerte mir vom Beckenrand aus zu. Er trug seinen orangefarbenen Trainingsanzug und rote Badelatschen.
Ich zog mir die Schwimmbrille vom Kopf. »Für heute reicht es.«
»Glaub ich. Drei Stunden. Hast du die Bahnen gezählt?«
»179.«
Ulrich kniff die Augen zusammen. »179 mal 50 Meter macht 8 950 Meter. Mein lieber Scholli. Ab jetzt. Duschen.«
Ich zog mich aus dem kalten Wasser. Der Nacken und die rechte Schulter taten weh. Wenn ich sie bewegte, knackte es komisch.
»Frank und ich spielen nachher in der Konsum-Klause eine Runde Rommé. Willst du mitmachen?«
Ich nickte und nahm mein Handtuch. Auf dem Gang zu den Duschen zog es wie immer heftig. Einige Minuten lang ließ ich heißes Wasser über mich laufen, trocknete mich hastig ab und zog mich an. Dann lief ich nach draußen.
Vor der Schwimmhalle standen einige Sportler und unterhielten sich.
»Tschüss«, rief ich, bog nach rechts ab und ging die wenigen Meter zur Klause.
Ulrich und Frank saßen bereits an einem der Tische und hatten Karten vor sich liegen.
Ulrich drehte sich zur Bar. »Cola für die Kinnings und für mich ein Pils«, rief er dem Wirt zu. Dann teilte er die Karten aus, noch bevor ich überhaupt saß.
Die Luft war stickig vom Zigarettenrauch. In einer Ecke saßen drei Männer und spielten vermutlich Skat, an der Bar trank eine Frau, die so alt war wie Mutti, ein großes Glas Bier. Sie war stark geschminkt und hatte hochtoupierte Haare. Sie starrte Ulrich an, doch der merkte das nicht.
Im Hintergrund lief leise The Power of Love von Jennifer Rush.
»Du hast dich nicht geföhnt«, sagte Ulrich vorwurfsvoll.
»Ist doch warm hier drin.«
Er schüttelte den Kopf. »Ihr holt euch alle noch was weg. Du auch, Frank!«
Der war auch nicht geföhnt und machte sich sofort einen Kopf kleiner, versteckte sich hinter den Karten.
Mein Blatt sah gut aus. Kreuzkönig, Kreuzbube, Kreuzzehn.
»Wieso trainierst du überhaupt so viel?« Frank schaute hinter den Karten hervor. Er hatte einen leichten Silberblick und sah knapp an mir vorbei.
»Keine Ahnung.«
»Ist es nicht langweilig, immer nur hin- und herzuschwimmen, ohne irgendein Programm?«
Um auslegen zu können, fehlte mir die Kreuzdame. Ich warf eine Herzsieben weg.
»Ich denke einfach an was anderes.«
Der Wirt brachte die Getränke. Er trug eine ASV-Sportjacke und sagte keinen Ton.
Ulrich blinzelte mir über seine Karten zu. »Woran denn?«
Frank warf eine Karte weg. Kreuzdame. Ich drosch auf den Tisch, doch Ulrich war schneller und grinste gehässig, als er die Karte aufnahm.
»An ein Gedicht«, sagte ich abwesend. »Oder an ein Buch.«
»Aha.« Nachdenklich kratzte Frank sich am Kopf. Seine aschblonden Haare wirbelten herum.
Ulrich ordnete die Karten. »Wahrscheinlich besser, als an deine Dosenöffner zu denken, was?«
Frank schaute verlegen auf den Tisch. Das Thema war ihm unangenehm, denn er durfte sein Abitur machen, im Gegensatz zu mir.
Ich lehnte mich zurück und senkte feierlich die Stimme, wie der Ansager bei der Ersten-Mai-Demonstration. »Jeden Tag erfülle ich die Norm. Wenn ich weiter so fleißig bin, kann ich eine Lehre zum Industriedesigner anfangen. Vielleicht in zwei Jahren.«
Frank legte alle seine Karten auf einmal ab. »Rommé!«
Wir starrten auf sein Blatt.
Frank trank seine Cola in einem Zug leer, stand auf und ging aufs Klo.
»Du hast geschummelt«, rief Ulrich ihm nach. Die Dame an der Bar bekam vom Wirt ein neues Bier hingestellt. Der Schaum lief über den Glasrand.
Ulrich mischte die Karten erneut, schaute nicht hoch. »Also Hanna, wenn du so weiterschwimmst, schaffst du es tatsächlich bis nach Gedser.«
Ich nahm jede Karte, die er mir zuwarf, einzeln auf. »Einen Versuch wäre es wert.«
Ulrich hob sein Bierglas und trank einen Schluck. Sein Auge zuckte komisch. »Du hättest auch nur einen Versuch«, sagte er leise.
Frank kam vom Klo und setzte sich wieder. »Mir ist gerade was eingefallen. Wenn du mal längere Zeit in der Warnow trainieren willst, anstatt immer nur Bahnen zu ziehen, kannst du meinen Neoprenanzug haben. Ich borge ihn dir.«
Ulrich hielt beim Sortieren inne und sah mich an.
»Ja.« Ich sah von einem zum anderen. »Ich würde gern mal die Warnow rauf- und runterschwimmen.«
»Die Warnow rauf und runter«, wiederholte Ulrich.
»Ich bring ihn am Freitag einfach mit«, beschloss Frank und nahm seine Karten auf.
Auch dieses Spiel gewann er. Danach hatten wir alle keine Lust mehr und verließen die Klause.
Draußen goss es in Strömen. Frank rannte dem Bus entgegen, der gerade um die Ecke kam. Auch ich wollte loslaufen, doch Ulrich hielt mich am Arm fest.
»Warte, ich fahre dich nach Hause.«
»Quatsch, das ist doch ein Umweg für dich!«
Doch er zog mich zu seinem uralten Skoda, der fast auseinanderfiel. Beim Einsteigen stieß ich mir den Kopf, weil ich so erschöpft vom Training war. Drinnen roch es nach Benzin. Langsam fuhren wir durch den Regen. Die Rücklichter der Autos schimmerten rot durch die nasse Windschutzscheibe, über die der Scheibenwischer ratschte.
Die Friedrich-Engels-Straße war menschenleer und dunkel, weil mal wieder einige Laternen nicht funktionierten. Ulrich hielt vor unserem Haus und stellte den Motor ab. Die Stille war fast unheimlich.
»Wie geht es deinem Vater?«
Erstaunt sah ich ihn an. Normalerweise fragte das niemand. »Gut. Er liest neuerdings wieder alleine seine Bücher.«
Ich legte die Hand auf den Türgriff. Ulrich drehte sich zu mir. »Creme dich mit Vaseline ein, so fett es geht. Wegen der Kälte. Und zieh Strümpfe an, bevor du in die Flossen steigst, sonst scheuerst du dich auf.«
Er beugte sich vor und fummelte am Rückspiegel herum. »Und nimm Schokolade mit, als Energiereserve.«
»O. k.« Ich schob die Tür auf und stieg aus.
»Warte!« Ulrich lehnte sich über den Beifahrersitz. Kalter Regen fiel mir auf den Rücken, als ich mich zu ihm hinunterbeugte.
»Zieh schwarze Handschuhe an.«
Ich wusste, was er meinte, und nickte.
Er schaute mich lange und nachdenklich an, mir wurde dabei etwas unwohl.
»Warum, Hanna?«
Ich wusste nichts zu sagen. Wie sollte ich das erklären? Ich konnte Andreas einfach nicht allein schwimmen lassen.
»Ist es wirklich so schlimm?«
Ich atmete tief ein, schaute ihm in die Augen und nickte. Das war das Beste.
Ulrich packte den Griff und knallte die Tür zu. Erst beim dritten Versuch startete der Motor. Der Skoda knatterte so laut, dass Nachbarin Lewandowski die Gardine zur Seite schob und einen Kontrollblick aus dem Fenster warf.
Nun hatte ich also einen Neoprenanzug.
Das musste ich unbedingt Andreas berichten. Und die Hinweise waren auch sehr wichtig für uns. Ich ging auf die Haustür zu, blieb erneut stehen und schaute Ulrich hinterher.
Plötzlich hatte ich Schiss, dass er mich verraten würde. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil er sich Sorgen machte.
Es stimmt nicht, was ich eben gedacht habe. Wir haben doch noch einmal festen Boden unter uns. Als meine Knie ihn gerade beim Schwimmen berührten, habe ich mich richtig erschrocken, dachte an ein Tier, den weißen Hai, natürlich Quatsch. Wenn man in der Nacht durch schwarzes Wasser schwimmt und überhaupt nichts sieht, kommt man auf blöde Ideen.
»Sind wir etwa wieder am Strand?«, fragt Andreas in die Dunkelheit.
»Nein, das ist nur eine Sandbank.«
Ich drehe mich auf den Rücken, setze mich und schaue hoch in den Himmel. Angenehm, sich kurz fallen zu lassen, den Boden zu spüren, obwohl wir noch nicht lange im Wasser sind und uns nicht ausruhen müssen. Ich versuche, den Horizont zu erkennen, doch es ist noch zu dunkel. Das Meer schimmert im Sternenlicht.
Andreas kommt zu mir, legt sich an meine Seite, flüstert: »Auf halber Strecke würde eine Sandbank viel mehr Sinn machen.«
Ich schaue hoch in den Himmel, höre das Plätschern der Wellen. Seltsame Situation. Wir bewegen uns in die Ungewissheit, so wie es früher die Seefahrer taten. Ohne Karte, mit ungewissem Ziel und nur mithilfe der Sterne. Immerhin haben wir einen Kompass und ein Ziel, den Westen. Momentan habe ich nicht einmal Angst, alles ist so klar.
»Wie immer leicht zu erkennen«, sagt Andreas altklug. »Der Große Wagen. Siehst du die beiden hinteren Sterne, die den Wagen bilden? Verlängere die Verbindungslinie um das Fünffache.«
Ist ja wie im Geografieunterricht. Ich gelange zu einem anderen, ebenfalls sehr hellen Stern.
»Der Polarstern«, sagt Andreas zufrieden. »In diese Richtung müssen wir.«
Ich nicke in die Dunkelheit. »Also weiter.«
Ein letztes Mal berühre ich mit den Flossen den Meeresboden.
Nun ist es endgültig.
Wir schwimmen los und verheddern uns nach wenigen Metern in der Schnur. Wir müssen einen gemeinsamen Rhythmus finden. Wir starten erneut, dieses Mal langsamer und bedächtiger.
Einen Schwimmzug, noch einen. Ich passe auf, dass ich neben Andreas bleibe, tauche ab in Dunkelheit, schwimme durch das unheimliche schwarze Wasser. Es fällt mir schwer, die Balance zu halten, ich habe keine Fixpunkte, muss mich konzentrieren, mit dem rechten und mit dem linken Arm gleichmäßig zu ziehen. Manchmal kollidieren wir, hauen uns den Ellenbogen in die Seite. Ohne die Schnur würden wir uns im Meer verlieren. Wenn sie sich zwischen uns zu lange spannt, driften wir auseinander, ruckt es dagegen mehrmals, dann weiß ich, dass Andreas daran zieht, weil er Hilfe braucht.
Immer wieder kommt Wasser in meinen Schnorchel. Das nervt. Ich atme ein, verschlucke mich daran, das Salzwasser kratzt in meinem Hals. Ich entferne es mit Luftstößen, die Kraft kosten. Im Schwimmbecken ist das Schwimmen mit Schnorchel einfacher, weil das Wasser ruhiger ist.
Plötzlich ist es heller.
Andreas zieht an der Schnur. Ich schaue mich um.
Vom Grenzturm in Kühlungsborn strahlt wieder das Scheinwerferlicht über die Ostsee. Sie suchen nach Flüchtlingen. Nach uns.
Das Licht kommt auf uns zu. Wir müssen den richtigen Moment erwischen, dürfen nicht in den Lichtkegel geraten.
Jetzt.
Wir tauchen unter, bleiben einige Sekunden unter Wasser.
Als wir wieder auftauchen, ist der Strahl weit entfernt.
Doch er wird zurückkommen.
Ich drehe mich auf den Rücken, schwimme weiter und behalte den Strahl im Auge. Eigentlich ist es kinderleicht, ich kann ihn sehen und ihm ausweichen. Auf die Art können sie uns nicht erwischen.
Der Strahl kommt zurück, ich ziehe dreimal kurz an der Schnur.
Wir tauchen erneut.
Danach höre ich Andreas husten, vermutlich hat er Wasser in den Schnorchel bekommen. Die Taucherei ist für ihn ungewohnt, die hat er nicht trainiert. Er hat noch Probleme mit der Schwimmtechnik, sein Beinschlag ist unregelmäßig, das höre ich am Klatschen seiner Flossen. Er muss sich erst an den Neoprenanzug gewöhnen und seine Bewegungen dem stärkeren Auftrieb anpassen, damit er sich im Wasser nicht andauernd um die eigene Achse dreht. Die Theorie habe ich ihm in den Dünen erklärt, nun muss er das Wissen umsetzen.
Gelegenheit zum Üben hat er jetzt.
Ich bewege gleichmäßig die Flossen und gleite auf dem Rücken durchs Wasser. Die Flossen drücken, irgendwann wird es richtig wehtun.
Der Strahl ist nun noch weiter weg als vorher. Ich drehe mich wieder auf den Bauch. Das Wasser unter mir ist schwarz, ein dunkles, unendliches Universum. Manchmal leuchten vor mir grüne Pünktchen auf, phosphoreszierende Mikroorganismen, und ich höre Blasen, die aus der Tiefe aufsteigen und an der Wasseroberfläche zerplatzen.
Wir können jetzt schwimmen, wohin wir wollen, sind völlig frei.
Wir müssen nicht mehr zurück, keinen Bahnen folgen, die den Weg markieren, müssen keine Wende an einer Betonwand machen und auch keiner schwarzen Linie am Grund des Beckens mehr folgen. Die Luft ist ganz frisch und riecht nicht nach Chlor.
Die Schnur spannt sich, Andreas kommt nicht hinterher. Ich warte, schaue zu dem dunklen Streifen hinter uns. Noch vor vier Wochen bin ich parallel zur Küste geschwommen, doch heute geht es auf die Ostsee hinaus.
So weit im Norden bin ich noch nie gewesen.
Plötzlich Licht, mitten in meinem Gesicht. Ich habe es nicht kommen sehen, tauche hastig, ziehe an der Schnur. Ich pflüge das Wasser auf, komme nicht tief genug, der Neoprenanzug zieht mich immer wieder nach oben.
Ich verschlucke mich, huste, reiße mir das Mundstück des Schnorchels aus dem Mund. Muss auftauchen, kriege keine Luft mehr.
Das Licht blendet mich so sehr, als würde man mir eine Taschenlampe ins Gesicht halten.
Gerade habe ich doch noch zur Küste geschaut, da war nichts.
Ich drehe mich mit dem Rücken zum Strahl, huste das Wasser aus meinen Lungen, erkenne Andreas’ schwarze Umrisse inmitten der gleißenden Helligkeit.
»Was ist das?«, rufe ich. Ich schlucke Wasser beim Reden, huste wieder.
»Das kommt nicht vom Land«, ruft Andreas neben mir. »Das kommt vom Wasser.«
Die Wellen werfen seinen Körper gegen mich, er versucht zurückzuweichen, driftet davon. Die Schnur zerrt an meinem Handgelenk.
Wahrscheinlich ist es Licht von einem Küstenschutzboot. Der Strahl wandert nicht weiter, hält direkt auf uns zu.
»Scheiße«, ruft Andreas. »Die sehen uns!«
»Abtauchen«, brülle ich, »zurück nach Süden!«
Das Schnorchelmundstück hängt in der Höhe meines Kehlkopfs, ich schaffe nicht, es in den Mund zu nehmen. Zum Glück ist der Schnorchel am Riemen der Taucherbrille befestigt.
Ich tauche. Welche Richtung? Ich sehe nichts. Wo ist Süden, wo oben, wo unten? Die Flossen schlagen ins Leere, noch klebe ich an der Wasseroberfläche, komme nicht tief genug.
Andreas taucht auf, die Schnur spannt sich, ich muss mit, stoße durch die Wasseroberfläche.
Ich lande mitten im Strahl. Brennendes Licht in meinen Augen.
»Weiter«, brüllt Andreas und fuhrwerkt mit seinen Armen durchs Wasser. Er will sofort wieder abtauchen.
Ich packe ihn an der Schulter. »Warte! Wir tauchen langsam ab, schwimmen eine Minute unter Wasser und versuchen, die Richtung zu halten. Dann tauchen wir auf. Ist der Strahl noch da, machen wir dasselbe wieder. Bis er weg ist!«
Ich kann seine Reaktion nicht erkennen, unendlich viele Lichter tanzen vor meinen Augen.
»Die können uns nicht ewig auf dem offenen Meer sehen, unsere Chancen sind besser als ihre.«
Andreas senkt den Kopf. Ein Nicken?
»Also los.«
Wir tauchen ab, bewegen uns ruhig und konzentriert durchs Wasser, dieses Mal tief genug.
Als wir erneut auftauchen, pendelt der Strahl einige Meter von uns entfernt über das Meer.
Doch er kommt erneut bedrohlich nahe.
»Los, noch ein Stück!«
Wir zerren uns gegenseitig in die Richtung, von der wir meinen, dass sie die richtige ist.
Als wir auftauchen, ist der Strahl weit von uns entfernt.
»Schwein gehabt«, sagt Andreas. Er zerrt den Rand seiner Taucherbrille hoch, Wasser fließt heraus.
Ich atme erleichtert aus. »Hör zu. Du schwimmst normal weiter, ich lege mich auf den Rücken und beobachte den Strahl. Nach zehn Minuten wechseln wir uns ab. Halte deinen Kopf unter Wasser und atme über den Schnorchel. Wir bieten denen so wenig Angriffsfläche wie möglich.«
»Ist klar.« Er rührt sich nicht, treibt auf der Wasseroberfläche und schaut zurück zur Küste. »Aber die haben uns doch gesehen, oder?«
»Ich glaube.«
»Und was machen die jetzt?«
Ich huste, überspiele meine Angst. »Nichts. Wir sind die Nadel im Heuhaufen. Los, weiter.«
Wir schwimmen los. Der Strahl pendelt in weiter Entfernung über die Ostsee, sucht uns noch immer, ist aber keine Gefahr mehr.
Um uns ist es dunkel.
Nach einer Weile sehe ich den Strahl nicht mehr und drehe mich wieder auf den Bauch, um schneller schwimmen zu können.
Dank der phosphoreszierenden Mikroorganismen kann ich den Kompass lesen und uns einnorden.
Andreas hat seinen Rhythmus gefunden, schwimmt zügig und gleichmäßig. Eins, zwei, eins, zwei. Bestimmt zählt er die Schwimmzüge.
Wenn wir das Tempo durchhalten und uns niemand in die Quere kommt, werden wir irgendwann die internationalen Gewässer erreichen. Doch das wird noch dauern.
Jetzt sind wir hier.
Sie werden uns suchen, denn sie haben uns gesehen. Der Strahl wäre sonst nie so lange bei uns geblieben. Das war kein Zufall.
So ein Mist. Bestimmt wird in diesem Moment an der Küste Alarm ausgelöst, vielleicht sogar von Genosse Johnson von der Grenzbrigade Küste. Opas Saufkumpan. Sie werden mit Hunden den Strandabschnitt absuchen und unsere Klamotten finden.
Und dann kennen sie zwei wichtige Koordinaten: unseren Startpunkt und unsere Position in der Ostsee. Die Richtung, in die wir schwimmen, dürfte ihnen klar sein. Sie müssen einfach die Linie verlängern, um uns aufzuspüren, vielleicht sogar unter Berücksichtigung der Strömung, die sie besser kennen als wir.
Ich hab echt Schiss. Ob Andreas das auch klar ist? Ich sage ihm lieber nichts, er soll sich einfach aufs Schwimmen konzentrieren.
Wir können wenig tun.
Abtauchen, mehr nicht. Solange Nacht ist, haben wir eine Chance, dann sehen sie nichts. Wenn sie schlau sind, suchen sie uns erst in der Morgendämmerung.
Leider sind sie schlau.
Meine Flossen scheuern. Nicht dran denken, konzentriere dich auf etwas anderes. Aber worauf? Hier ist nichts.
Nur Wasser und Nacht.
Zum Glück kriegt Sachsen-Jensi von dem Theater nichts mit. Der könnte keinen Meter schwimmen, würde vor Schiss sofort losflennen, so wie an seinem ersten Schultag in unserer Klasse. Er kam als Neuer dazu, was echt blöd für ihn war. Neue haben es nie leicht, schon gar nicht, wenn sie aus Sachsen sind.
Mit seiner Heulerei ging er uns echt auf den Wecker. Wir alle dachten, er wäre ein Waschlappen. Ist er aber nicht. Er hat ganz einfach komische Reflexe. Manche Leute kratzen sich am Kopf, wenn sie aufgeregt sind, Sachsen-Jensi heult eben.
»Es gibt doch nun wirklich keinen Grund zu weinen!«
Die dicke Frau Thiel legte ihm die Hand auf die Schulter. Er beugte sich unter der Last vor.
»Wir haben einen neuen Schüler an unserer Friedrich-Engels-Oberschule. Jens Blum. Ich habe euch ja schon von ihm erzählt.«
»Was ist denn das für eine Memme?«, rief Andreas. »Und was hat der überhaupt für doofe Sommersprossen?«
Frau Thiel schüttelte ihre blonde Dauerwelle. »Sag uns bitte noch einmal deinen vollen Namen und woher du kommst.«
»Jens Pluum aus Dräsdn«, flüsterte er.
»Wat war dat?«, rief Christian aus der Ecke.
»Jens Pluum, Dräsdn«, schrie er.
»Ein Sachse. Oh nein!«
Alle in der Klasse stöhnten.
»Ihr seid ruhig«, schimpfte Frau Thiel.
Sie zeigte auf mich. »Du setzt dich neben Hanna. Sie wird dir bei den Hausaufgaben helfen.«
Ich hatte überhaupt keinen Bock auf den.
»He, Sachse, sag mal einen Satz mit Angola!«
Seine riesige Boxer-Jeans rutschte ihm über den dünnen Hintern. Er musste den Hosenbund mit der Hand festhalten, als er auf mich zuschlurfte.
»Angola gann isch misch doodsaufn«, schrie Andreas, und alle lachten.
Jens schlüpfte auf den Stuhl neben mir und zog das Russischbuch aus seinem braunen Ranzen, auf dem ein riesiger Donald-Duck-Aufkleber prangte.
»Isch pin öberhaupt nisch guud in da Schole«, flüsterte er. »Schon goar nisch in Roassisch. Da mussd doa mir ohnbedingd hälfn!«
Sein Sächsisch war wirklich schrecklich. Und sein rotes Nicki war ihm viel zu groß.
Blöderweise hatten wir auch noch denselben Nachhauseweg. Jens trug eine Jacke mit braunen Fransen und sah aus wie ein zerrupfter Bär.
»Hier im Eckladen holen Andreas und ich uns immer Drops, da drüben ist Bäcker Nowak, Hautklinik, Fleischer Timm, Bäcker Gerloff.«
Dort kauften wir uns einen Pfannkuchen. Jens biss hinein. Marmelade lief über sein Kinn, er sah aus wie ein Vampir. Mit vollem Mund sagte er: »Du gannst misch och Jensi nennen!«
Die Verkäuferin starrte ihn an.
Es war mir total peinlich, mit einem Sachsen herumzulaufen. Ich nahm ihn trotzdem mit zu Opa.
»So ein Zufall«, rief Jensi fröhlich, als wir die morschen Stufen hinaufstiegen. »Ich wohne auch in dieser Straße!«
»Es sieht bestimmt möhlig bei ihm aus.«
Ich klopfte an die Tür. Drei kurz, drei lang, drei kurz. Unser Code.
»Save our souls!«
Stolz sah Jensi zu mir hoch. Er war doch nicht so blöd, obwohl er fast einen Kopf kleiner war als ich. Ich klopfte noch mal, da Opa mal wieder nicht hörte.
»Drei kurz, drei lang, drei kurz«, sprach Jensi mein Klopfen mit. »SOS!«
Er ging mir auf den Geist.
Es knarrte hinter der Tür. Opa lugte durch den Spalt. Er war ganz grau im Gesicht.
»Mach auf, ich bin es.«
»Wer?«
»Ich. Nicht die Gestapo.«
»Und wer ist das Urviech neben dir?«
»Jensi aus Dresden, mein neuer Banknachbar.«
Opa öffnete die Tür. Er trug seine braune Wolljacke mit den Lederflicken an den Ellenbogen, die Mutti jedes Jahr austauschte. Seine weißen Haare hatte er nicht gekämmt.
Er betrachtete Jensi, der seinen Kunstbärenpelz auszog.
»Ist das der letzte Schrei aus dem Bekleidungskombinat?«
»Logo«, sagte Jensi kleinlaut.
Opa ging ins Wohnzimmer. Überall lagen zerrissene Zeitungen. In der Wohnung war es sehr kalt und wie immer roch es nach frischem Leim.
»Ostsee-Zeitung, Neues Deutschland, Norddeutsche Neueste Nachrichten«, las Jensi laut.
»Opa Franz schneidet Artikel aus und sammelt sie, um sie miteinander zu vergleichen. Warum hast du wieder nicht geheizt?«
Er drehte sich um: »Wenn jeder Kohle verballert, ist die DDR schon in drei Jahren bankrott und nicht erst in zehn.«
Jensi quiekte.
Opa sah ihn streng an. »Was ist mit dir?«
»Sie reden wie Vati.«
»Ein Sachse ooch noch«, schrie Opa los.
Ich rollte die Augen nach oben. »Hab ich doch gesagt, aus Dresden!«
Opa klatschte in die Hände. »Sag mal einen Satz mit Angola!«
Jensi schüttelte den Kopf. »Ne!«
»Mach den Fernseher an. Den Witz hatten wir schon in der Schule.«
Opa drückte wild ein paar Knöpfe. Wir lümmelten uns auf das Sofa und wickelten uns in die Wolldecke. An manchen Stellen des Sofas kamen Sprungfedern durch, aber trotzdem war es sehr gemütlich. Ich war gern bei Opa, weil er meistens lustige Sachen sagte oder irgendwann einschlief. Dann konnte ich in Ruhe fernsehen, ohne dass mich jemand störte.
»Da liegt Musike drin«, rief Opa begeistert. Das war eine seiner Lieblingssendungen.
Wir schlugen unsere Mathehefte auf.
»Ich hasse Mathe«, meinte Jensi.
»Ihr lernt für das Leben, nicht für die Schule«, rief Opa und glotzte in den Fernseher.
»Jaja«, flüsterte Jensi. »Schöner Spruch.«
Ich stieß ihm den Ellenbogen in die Seite und las die Matheaufgabe laut vor: »Am Ersten Mai soll in Reihen zu 12 angetreten werden. Wie viele Reihen bilden die Werktätigen eines Betriebes, in dem 1 176 Beschäftigte sind, wenn 48 Werktätige nicht teilnehmen können?«
»Mich kannst du gleich abziehen«, sagte Opa, »ich geh da nicht hin. Also 49.«
»94 Reihen Werktätige«, sagte ich. »Auch wenn Opa nicht hingeht.«
Jensi kicherte.
»Musst du nicht zum Schwimmen?«, fragte Opa. Er war kurz vorm Einschlafen.
»Nö, mittwochs nie.«
»Mittwochs ist meistens Pioniernachmittag«, meinte Jensi angeberisch. »Wie oft trainierst du denn?«
»Viermal die Woche. Vielleicht komme ich auf die Kinder- und Jugendsportschule.«
Er riss die Augen auf. »Wahnsinn! Dann wirst du bestimmt Olympiasieger!«
Opa schnarchte im Sessel. Seine Kuckucksuhr ging los, doch auch davon wurde er nicht wach.
»Lass uns abhauen«, sagte ich.
Draußen schneite es.
In der Paulstraße trafen wir Andreas. Seine blonden Haare waren voller Schneeflocken. »Mensch, ich hab euch überall gesucht!« Er nahm mich beiseite. »Wollen wir dem Sachsen mal das Stasihochhaus zeigen?«
Jensi blieb stehen. »Warum?«
Andreas zeigte auf das weiße Hochhaus mit den dreiundzwanzig Stockwerken, das man von überall sehen konnte.
»Da wohnt die Staatssicherheit von ganz Rostock!«
»Glaub ich nicht«, sagte Jensi altklug. »Das wäre dann ja wohl kaum geheim.«
Andreas boxte ihm in den Rücken. »Wir fahren da jetzt hoch und spucken runter!«
Wir rannten durch die Augustenstraße und bogen vor Bäcker Nowak rechts in den schmalen Weg ein, der zum Hochhaus führte.
Doch die Tür war abgeschlossen.
»Die lassen eben nicht jeden rein«, sagte Andreas. »Schon gar keine Sachsen.«
Er klingelte bei unserer Klassenstreberin Sabine Müller. »Ja, bitte?«
»Hier ist Andreas«, brüllte er in die Sprechanlage. »Kannst du mir bei Mathe helfen? Ich weiß nicht, wie viele Werktätige zum Ersten Mai gehen.«














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














