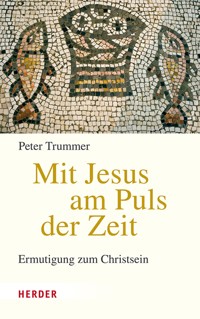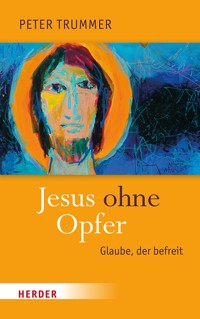
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im dritten Teil seiner Trilogie - nach Den Herzschlag Jesu erspüren. Seinen Glauben leben (4. Aufl. 2024) und Mit Jesus am Puls der Zeit Ermutigung zum Christsein (2. Aufl. 2025) - legt der Neutestamentler Peter Trummer den Weisheitslehrer Jesus von seine Gestalt und Botschaft verdunkelnden Übermalungen frei. Zu Tage tritt das folgende Bild: Jesus wollte aller Welt bezeugen, wozu der Glaube an einen bedingungslos gütigen Gott fähig ist. Dazu braucht es keine Opfer oder Vergottung seiner Person. Derlei Konstrukte vergiften nur das Gottesbild, machen den Menschen und Juden Jesus unkenntlich und lassen die Gläubigen mit schlechtem Gewissen zurück. Die Wahrheit, die Jesus verkündet hat und die befreit, entdecken wir vielmehr, wenn wir beginnen, die Projektionen unseres Über-Ichs (und Kirchengottes) abzuarbeiten. Erst so wird auch in uns jene letzte Instanz vernehmbar, die nicht nur anklagt, sondern ermutigt, uns und den anderen zu vergeben. Damit sind wir der Abba-Idee Jesu auf der Spur. Sein Brotbrechen wiederum feiert die grenzenlose Güte und Gastfreundlichkeit Gottes und macht so die (geistige) Gestalt Jesu über seinen Tod hinaus erkennbar. Es steht aktiv und passiv allen offen und verändert die Gesellschaft nachhaltig. Nach Jesus liegen das Göttliche und wahrhaft Menschliche gar nicht so weit auseinander, wie es das Dogma definierte. Trummers erfrischend zeitgemäßes Jesus-Buch zeigt, dass die Menschheit vom Weisheitslehrer Jesus noch eine Menge lernen könnte, anstatt sich über seine Person und Gottesnatur zu streiten. Eine Inspiration für befreienden Glauben heute!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Peter Trummer
Jesus ohne Opfer
Glaube, der befreit
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2026
Hermann-Herder-Straße 4, D-79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Adi Holzer, „Schapener Christus“ (Detailentwurf für die Farbfenster der Kirche in Schapen/Braunschweig), 2020 – © VG Bild-Kunst, Bonn 2026
E-Book Konvertierung: Newgen publishing
ISBN Print 978-3-451-02450-4
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-84450-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-84449-2
Gottes
Gastfreundschaft
für alle
war ihm
sein Leben wert
Von Opfer keine Spur
Inhalt
Vorwort
1. Sehen und Verstehen. Vom Wunder der Erkenntnis
2. Ein Gott! Und Jesus?
3. Mit Jesus beten
4. Jesus der Prophet
5. Jesus der Heiler
6. Jesus der Mann
7. Jesus der Gottessohn. Und wir?
8. Weisheitslehrer I
9. Weisheitslehrer II
10. Weisheitslehrer III
11. Aufstehen oder auferstehen? Jetzt oder nie!
12. Wohin gehen wir?
13. Religion in den Spuren Jesu
14. Brotbrechen „in den Häusern“ (Apg 2,46)
15. Speisensegnung – das „achte Sakrament“?
16. Mit Jesus feiern
Nachweis der Erstveröffentlichung
Bibelstellenregister
Über das Buch
Über den Autor
Zu den Übersetzungen von Bibeltexten
Die neutestamentlichen Texte gebe ich in eigener, möglichst wortgetreuer Übersetzung wieder, verweise aber auch auf die Einheitsübersetzung in der Revision von 2016 und ihre ursprüngliche Fassung von 1980 bzw. die aktuelle Lutherbibel von 2017 (wie im Vorwort).
Vorwort
Dieses Buch versteht sich, um es mit Johann Sebastian Bach1 zu sagen, als „dritter Teil der Jesus-Übung“2 und als Einführung in eine neue originale Klangwelt des Glaubens: Der Gute Hirte Jesus „setzt sein Leben ein“ (Joh 10,11); er „gibt es“ nicht „hin“ oder „lässt es“, wie die Übersetzungen glauben machen.
Die Idee, Jesus habe uns nur durch seinen gottmenschlichen Opfertod „von unseren Sünden erlösen“ können (obwohl davon wenig zu spüren ist), war schon in der Spätantike nur mit Hilfe des Kaisers durchzusetzen. Doch sie vergiftet das Gottesbild, macht den Weisheitslehrer Jesus unkenntlich, manipuliert die Gläubigen mit schlechtem Gewissen usw. Jesu Abba braucht keine Opfer, legitimiert keine heilige Herrschaft, grenzt niemanden aus. Das haben seine anrüchigen Gastmähler mit Outsidern klargestellt.
Sein offenes „Brotbrechen“ (und noch lange kein rituelles Abendmahl) schrieb die Erfolgsgeschichte des frühen Christentums. Das Wissen darum bildet immer noch das spirituelle Grundwasser unserer christlich geprägten Kulturen. Und darauf müssen wir wieder zurückgreifen: Jesus wollte nicht, dass wir ihn unbedingt als Gott verehren und nur für uns vereinnahmen (oder gar essen), er wollte einen Glauben aufzeigen, der Menschen befreit.
Die folgenden Beiträge wurden im Zeitungsformat konzipiert und vereinzelt auch so veröffentlicht. Sie eignen sich weiterhin für eine Kreuz-und-quer-Lektüre, obwohl auch ihre redaktionelle Einbindung einiges verdeutlichen sollte. Etliche Themen klingen mehrfach an, sind jedoch im Sinne Bachs nie bloße Wiederholungen, sondern kreative Variationen des Leitmotivs: Wer war Jesus bzw. was hat er mir und den Menschen, auch den Anders- oder Nichtgläubigen heute zu sagen?
In der Hoffnung, dass viele Leser:innen sich in meinen (vor allem textgeleiteten) Überlegungen „wiedererkennen“ (ana-ginṓskein, wie griechisch das Lesen heißt) und zu eigenem Handeln inspirieren lassen.
Graz, im Jänner 2026
Peter Trummer
1 Dritter Teil Clavier Übung 1739, bekannt auch als „deutsche Orgelmesse“.
2 Nach den beiden Vorgängern: P. T., Den Herzschlag Jesu erspüren. Seinen Glauben leben, Herder 42023 und: P. T., Mit Jesus am Puls der Zeit. Ermutigung zum Christsein, Herder 22025.
1. Sehen und Verstehen Vom Wunder der Erkenntnis
Mit seltsamen Gefühlen betrete ich alte Römerstraßen, wie sie gelegentlich auch in unseren Gegenden noch anzutreffen sind. Sie fügen sich gut in die Landschaft ein, sind bisweilen bis zu sechs Meter tief fundamentiert, anscheinend für die Ewigkeit geschaffen. Dass sie neben der Pioniertätigkeit der Legionäre hauptsächlich Ergebnis von Frondiensten sind, trübt die Bewunderung, und der Verkehr auf ihnen war alles andere als fortschrittlich. Wohl erreichte die kaiserliche Post fernste Ziele in kurzer Zeit, aber der Schwerverkehr war mehr als mühsam. Die starren Ochsenkarren mussten bei jeder Kurve oder Gegenverkehr aus der Spur gehoben werden. Niemand kam auf die Idee, das naheliegende Vorbild eines Renn- oder Kampfwagens auf ein solches Fahrzeug umzulegen. Die bewegliche Deichsel war noch nicht erfunden, desgleichen die Bremsen. Bei Gefälle wurde ein Rad einfach mit einem Stock blockiert, auch nicht gerade die schonendste Lösung. Pferde kamen als Zugtiere ohnehin nicht in Frage, sie hatten kein entsprechendes Zaumzeug und hätten sich nur erwürgt.
Auch gewöhnliche Reisende waren nicht zu beneiden. Sie mussten, falls ohne Lasttier unterwegs, ihr Gepäck selbst tragen, auch das für die kalten Nächte unerlässliche kompakte Obergewand (nach Luther den „Mantel“: Ex 22,25f) immer bei sich haben. Für die Legionäre konnte das Marschgepäck schon an die 20 kg betragen, doch auch ihnen fiel nichts Besseres ein, als dieses zu einem Bündel geschnürt an einer Stange zu schultern. Das diesbezügliche technisch-kulturelle Erwachen reicht noch in meine eigene Lebenszeit hinein: Die unförmigen Rucksäcke an zwei Lederriemen aus der Jugend- und Wanderbewegung waren schon ein echter Komfort, aber ergonomische Traggestelle ließen noch länger auf sich warten, ebenso leichte Materialien für Zelt, Luftmatratzen oder Kochgeschirr.
Der Vergleich mit unsinniger Plagerei drängt sich auch hinsichtlich der christlichen Tradition auf. Sie hat erstaunlich viel vom römischen Geist, aber auch etliches von seiner Betriebsblindheit geerbt (da war z. B. eine von Legionären geschlossene Ehe gesetzlich ungültig und ging so zu Lasten ihrer faktischen Frauen und Familien,1 ein Zynismus, an dem auch der Pflichtzölibat der römisch-katholischen Priester bis heute laboriert). Jedenfalls war meist nur mehr wenig vom Jesuswort zu spüren: „Mein Joch ist brauchbar/bequem/sanft und meine Bürde leichtfüßig“ (Mt 11,30; vgl. Kap. 4). Dazu gab es zu viele Regeln, Verbote, moralische Bedenken.
Womit uns die zweite, dunkle Seite des Erkennens begegnet: Wir alle sind, sowohl als einzelne als auch kollektiv, überhaupt nicht davor gefeit, neben erstaunlichem Wissen und Können im Detail für die eigentlichen Sinnzusammenhänge völlig blind oder kurzsichtig zu bleiben. Das gilt insbesondere für die verbreitete Glaubenserzählung, wonach Christus „für unsere Sünden starb“, die auch allen Kreuzen im öffentlichen Raum anhaftet und nicht gerade eine Empfehlung für unsere altehrwürdige Religion darstellt. (Eigentlich verständlich, dass sie vermehrt auf Irritation und Ablehnung stoßen.)
Der interpretationsbedürftige Satz steht wörtlich im Neuen Testament (1 Kor 15,3), ist aber seiner Herkunft nach älter (Jes 52/53) und kann sich ursprünglich gar nicht auf Jesus beziehen, bleibt schon in sich dunkel und höchst widersprüchlich. Seine Tragik entfaltet sich erst im Christentum, wo das lateinische Abendland auf der Suche nach kausalen Welterklärungen zusammen mit germanischen Rechtsvorstellungen durch Bischof Anselm von Canterbury (1033–1109) die Idee entwickelte, Jesus hätte mit seinem Kreuzestod die Strafen für die unendliche Beleidigung des Allerhöchsten durch unsere Sünden „stellvertretend“ auf sich genommen, weil wir selbst nie entsprechende Genugtuung (Satisfaktión) dafür leisten könnten. Auch die Reformation fand keinen Ausgang aus diesem Labyrinth.
Monokausale Erklärungen treffen jedoch in geistigen Bereichen selten zu, blenden zu vieles aus. Jesus konnte nur „für sich“ sterben, alles andere wäre völlig sinnlos. Er hat gut dreißig Jahre gelebt, und nur wenige Stunden gelitten. Letztere können nicht der Sinn seines Lebens gewesen sein. Nur wenn das Ganze für ihn stimmig war, können vielleicht auch wir irgendeinen Sinn „für uns“ daraus entnehmen, aber wir dürfen die Relationen nicht willkürlich verschieben und uns (narzisstisch) zur eigentlichen Ursache des Geschehens erklären. So wichtig sind wir nun auch wieder nicht. Jesus hat den Menschen in Wort und Tat seinen Glauben an den ohne Opfer gnädigen Gott nahegebracht und diesen bewusst und gezielt mit dem religiös höchst belasteten Kreuzestod (Dtn 21,23/Gal 3,13) vor aller Welt „durch sein eigenes Blut“ (Apg 20,28) bezeugt. Ohne diesen mutigen letzten Schritt wären seine Person und Botschaft wahrscheinlich spurlos an uns vorübergegangen. Doch als Guter Hirte „setzt er sein Leben ein“ (títhēsin: Joh 10,11; 15,13); „er gibt es“ nicht „hin“, wie immer noch zu hören ist. Zwar erscheint der sprachliche Unterschied aufs erste vielleicht gering, doch liegen Welten dazwischen, ergeben sich daraus völlig widersprüchliche Lebenskonzepte. Was wir für uns daraus entnehmen können, ist einzig (und doch unendlich viel): Auch wir dürfen unser Leben mit jesuanischem Gottvertrauen gestalten, ohne von ständiger Angst und Schuldgefühlen getrieben oder blockiert zu werden.
Weiterführende Erklärungen sind ebenso überflüssig wie absurd. Sie geben vor, den Plan Gottes zu kennen, und bescheiden sich doch nur mit unsinnigsten Milchmädchenrechnungen zu Schuld und Gnade. Sie bleiben aber jede Antwort schuldig, wieso Gott gerade zu diesem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte (von deren Tiefendimension Antike und Mittelalter noch wenig Ahnung hatten), auf eine so merkwürdige Weise und auch nur für einen Teil der Menschen tätig geworden sein sollte. Die Mär vom gottgewollten Opfertod Jesu widerspricht nicht nur jeder geschichtlichen Evidenz und Logik, sie verkennt auch seinen konsequenten Einsatz für seine Überzeugung und macht ihn stattdessen zum stumm leidenden Opfer einer grotesken göttlichen Gerechtigkeit mittels Todesstrafe und „bedankt“ sich schlussendlich für die so paradoxe „Erlösung“ durch den Juden Jesus mit ewigem Hass gegen das Judentum. Da passt einfach zu viel überhaupt nicht mehr zusammen.
Von der „Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Retter-Gottes“ (Tit 3,4), die Jesus aller Welt bezeugen wollte, war und ist in solchen Auskünften nichts mehr zu spüren. Schon dem Mittelalter konnte seine dürftige Erklärung des Kreuzes Jesu nicht wirklich genügen. Es bedurfte noch der unzähligen priesterlichen Messopfer, um die angeblichen Früchte daraus zu aktivieren (und Kirchenbesitz zu lukrieren). Aber auch sie waren eigentlich andauernde Misstrauenserklärungen an Gott, durften nicht zu viel von seiner Gnade zum Fließen bringen, um ihre kirchliche Vermittlung in Gang zu halten. Wie konnte das passieren?
Wir nähern uns dem heißen Kern des Problems. Jedes Forschen und Erkennen unterliegt dem „hermeneutischen Zirkel“, und das heißt: möchte in erster Linie bewusst oder unbewusst die eigenen Ahnungen und „Vor-Urteile“ bestätigt finden. Das gilt auch für die Glaubenserzählungen (auch die meine, aber ich weiß wenigstens darum, kann sie einigermaßen relativieren). Sie wurden im Mittelalter ausschließlich von Klerikern gestaltet, welche sich nur eine Zwei- oder Drei-Stände-Kirche vorstellen konnten, in welcher sie das große „Los“ (klḗros) gezogen und allein das Sagen hatten, und sich für ihre heilsnotwendige Funktion von den Gläubigen (möglichst dem Adel gleich) erhalten lassen durften. Und das alles galt als „göttliches Recht“ (ius divínum), wonach nur Männer Jesus und Gott repräsentieren und in seiner Vertretung handeln können.
Die Gläubigen wurden nie gefragt, waren auch in die liturgischen Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht eingebunden. Über den eigentlich wunden Punkt der mittelalterlichen Glaubenslehre, die sogenannte „Transsubstantiation“, die Wesensverwandlung des Brotes durch den Priester in den „Leib Christi“ (was immer dieser nach Tod und Auferstehung Jesu auch bedeuten soll), durften nicht einmal die Bischöfe am Konzil diskutieren. Der Papst stellte sie per Enzyklika (Mystérium Fídei vom 3. September 1965) außer Streit. Doch der Glaubenssinn des einfachen Volkes (sénsus fidélium) folgte ihm nicht mehr, denn Sprache und Inszenierung der Gottesdienste gingen trotz Volksaltar und Volkssprache bzw. gelegentlicher Kommunion „unter beiderlei Gestalten“ immer noch über die Köpfe und Herzen der Menschen hinweg.
Seither aber melden sich auch andere Stimmen zu Wort: Die Zahl der theologisch kompetenten Laien und insbesondere der Frauen wächst, während die traditionellen Priesterberufungen in unseren Breiten sichtlich zurückgehen. Die zur Forschung verpflichteten theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten können nicht länger nur das kirchliche Lehramt nachbeten, ohne unglaubwürdig und im Wissenschaftsverbund verzichtbar zu werden. Selbst ranghohe Priester gestehen offen, dass ihnen ihre amtlich aufgetragene Funktion große Mühen bereitet, und vermehrt bringen auch ordinierte Fachkollegen ihre Erfahrungen und Expertise freimütig an die Öffentlichkeit (um nur die neutestamentlichen Kollegen Martin Ebner/ehemals Münster und Bonn und Ansgar Wucherpfennig SJ/Frankfurt, St. Georgen zu nennen).
Der biblische Befund ist eindeutig. Schon die Liturgie des Versöhnungstages (Lev 16) ist kein Blutopfer an einen erzürnten Gott, sondern bestätigt symbolisch-zeichenhaft die gnädige Anwesenheit des Schöpfers allen Lebens auch nach dem jährlichen Sündenbekenntnis und „deckt“ die Schuld „zu“ (so der evangelische Alttestamentler Bernd Janowski/Heidelberg und Tübingen mit Sühne als Heilsgeschehen 1982). Außerhalb des Judentums ist dieser Ritus, auf den sich auch die Deutung des Abendmahlbechers bei Matthäus bezieht (Mt 26,28), weder bekannt noch verständlich, weshalb Paulus im hellenistisch-römischen Raum nur von der kat-allagḗ (2 Kor 5,18ff) spricht. Gemeint ist die „totale Veränderung“ einer zerrütteten ehelichen Beziehung (1 Kor 7,11), welche die Übersetzungen jedoch meist wieder auf die missverständliche „(Gottes-) Versöhnung“ zurückführen möchten (vgl. Kap. 16).
Opfervorstellungen sind jedoch an dieser Stelle ebenso unnötig wie irreführend. Es kann beim Kreuz nicht um einen jesuanischen Leistungssport in Sachen Schmerzen gehen, die im Himmel dann als Gnaden für uns gutgeschrieben würden, sondern es ist einzig der (persönliche) „Glaube Jesu Christi“ (Gal 2,16), der uns ermutigt und trotz Versagen aufrecht vor Gott stehen und bestehen lässt. Daraus ergibt sich für Paulus die befreiende Einsicht, dass Gott „ihnen Danebengefallenes nicht (an)rechnet“ (2 Kor 5,19). Und das ist tatsächlich der archimedische Punkt schlechthin: Nur ein gewaltfreies, bedingungslos gütiges Gottesbild kann unsere tiefsitzenden, meist völlig unbewussten Ängste und Aggressionen gegenüber dem eigenen Über-Ich- (und Kirchen-) Gott auflösen. Wir müssen nicht einen erzürnten Gott mit Hilfe der Leiden Jesu ‚versöhnen‘, sondern dürfen uns mit der von ihm mit seinem Tod bezeugten Güte und Feindesliebe Gottes ‚aussöhnen‘, ohne ärgerlich und neidisch auf die zu werden, die sich unserer Meinung nach nicht so bemühen wie wir.
Dem Mittelalter war eine solche Weitherzigkeit Gottes anscheinend noch völlig unbegreiflich, denn es praktiziert Drohgebärden, nicht nur in den Höllenbildern vom Jüngsten Gericht, sondern auch in den sogenannten „Lebenden Kreuzen“, die schon den Tod des Judentums ankündigen. Auch seine Fronleichnamsfrömmigkeit tritt sehr offensiv auf den Plan. Die trotz spektakulärer Hostienwunder unvermeidlichen christlichen Selbstzweifel an einer göttlichen „Realpräsenz“ in der geweihten Hostie werden nicht selten auf „die Juden“ ausgelagert und geben mit Gerüchten über „Hostienfrevel“ Anlass für Pogrome. Der tief eingewurzelte Antijudaismus kann sich jedoch auch feinerer Klingen bedienen: Die Erbauung der „Corpus-Christi-Kapelle“ und anschließend der Kirche „Zum Heiligen Blut“ mit dem Dominikanerkloster (heute Stadtpfarrkirche bzw. Pfarrhof) mitten im Grazer Getto um die Mitte des 15. Jahrhunderts bedeutete das Ende des lokalen Judentums innerhalb einer Generation. (Allein schon die stumme Gegenwart der dem Predigerorden anvertrauten Inquisition war ein unmissverständlicher Wink in Richtung jüdischer „Remigration“.) Ein gutes Jahrhundert später verpflichtete die von den Jesuiten betriebene Gegenreformation in der schon überwiegend protestantischen Stadt zur Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, um nicht des Landes verwiesen oder in entlegene Bergregionen ausgesiedelt zu werden.
Womit sich ein erschreckender Zusammenhang zwischen der (behaupteten) Gottespräsenz und einer sich mit ihr rechtfertigenden Gewaltbereitschaft andeutet: Wenn bereits in der Person Jesu Gott selbst irgendwie anwesend ist, dann verbietet allein schon dieser Umstand jeden Zweifel oder gar Widerspruch gegen das, was die Kirche sagt. Um wie viel mehr verlangt dann aber ihr „Allerheiligstes“ in der geweihten Hostie vollkommene Unterwerfung bzw. muss ihre Verweigerung mit allen Mitteln sanktioniert werden. So hat Jesus eine Einheit der Glaubenden sich allerdings kaum vorgestellt (Joh 17,11).
Doch schon das erste allgemeine Konzil von Nizäa (325) war nicht nur eine interne fromme Kirchenversammlung, sondern vor allem Staatsräson, welche die nach der Verfolgung erstmals frei diskutierenden christlichen Theologen früh genug zur Räson rufen wollte, nachdem ihr Glaube als neue Staatsreligion vorgesehen war. Doch schon die Lehre von den zwei Naturen in der einen Person Jesu nahm ihr Augenmaß ganz an der Macht des Kaisers (vgl. Kap. 2 und 13) und setzte sie auch damit durch. Doch offenbar ist Gott nicht so allmächtig wie der Kaiser (es gerne sein möchte), obwohl ihn die Liturgie andauernd mit „Allmächtiger ewiger Gott“ tituliert. Und wir gewöhnliche Menschen stehen voll daneben, weil wir nicht wissen, woran wir sind. Macht und Beziehung gehen nicht wirklich zusammen; Marionetten sind keine Partner:innen, schon gar nicht einer Gottesbeziehung. Erst die „Ohnmacht“ Gottes, mit der wir so oft hadern, weil er nicht die beste aller Welten geschaffen hat, Kriege und Hungersnöte nicht sogleich beendet usw., ermöglicht uns paradoxerweise so etwas wie Freiheit und Menschenwürde, schafft Raum für Beziehung und Nähe auch eines transzendenten Gegenübers, lässt Ahnungen von Mitleid und Mitleiden seitens des Schöpfers mit seiner Schöpfung zu, wofür Antike und Mittelalter noch wenig Sensibilität aufbringen konnten.
Das traditionelle Modell einer durch das Kreuz bewirkten Erlösung kann nicht wirklich überzeugen. Wir können auch als Gläubige nicht länger die Augen davor verschließen, dass es uns wenig Erbauliches bringt, wenn wir seine Früchte näher sortieren: schlechtes Gewissen, andauerndes Opferbringen, Depressionen, Gehorsam um jeden Preis usw. Begreiflich, dass eine solch unnötige „Kreuzeslast“ der überwiegenden Mehrheit der Menschen den Zugang zum Weisheitslehrer Jesus erschwert bzw. ganz verstellt.
Die Menschheit hat sich weiterentwickelt, auch im Spirituellen, während die Dogmen Stillstand verordneten, weil sie sich für ewig hielten und sich dabei das Schicksal der römischen Straßen einhandelten, nur funktionslos und unbrauchbar werden konnten. Wir alle und besonders die Kirchenleitung sollten offen und ehrlich vor aller Welt eingestehen, dass auch wir nicht wirklich wissen können, ob und wie Gott ist, wir aber fest davon überzeugt sind, dass wenn es über allem so etwas wie eine unverfügbare letzte Instanz gibt, sie allen Geschöpfen gleich zugetan und nicht von unseren Kirchenstrukturen abhängig ist. Das würde das Verhältnis zu den anderen Religionen und auch den Agnostikern und Atheist:innen entspannen und hoffentlich auch die Verfolgungen, unter denen gerade Christgläubige weltweit immer noch zu leiden haben, bleibend beenden.
Insgesamt aber dürfen wir für die gegenwärtige Kirchenkrise dennoch dankbar sein, denn sie wird wohl oder übel unsere Rede von Gott ehrfürchtiger, bescheidener und glaubwürdiger machen und mehr zur ursprünglichen Jesus-Idee zurückführen. Religionen sind nicht an sich besser oder schlechter, sie können ihre Qualität einzig damit ausweisen, ob und wie weit sie Menschen helfen, ihre endliche Existenz mit Sinn zu füllen, Mitgefühl füreinander zu empfinden und Solidarität mit allen zu leben. Das ist unser einziger Gottesbeweis und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass diesbezüglich von Jesus noch einiges zu lernen ist, auch von uns (vgl. Kap. 8 bis 10).
1 Fergus Millar, Die Armee und die Grenzen, in: Das Römische Reich und seine Nachbarn. Die Mittelmeerwelt im Altertum IV, Fischer Weltgeschichte Band 8, hg. v. Fergus Millar, Fischer Taschenbuch Verlag 1966, 106–128, 122.
2. Ein Gott! Und Jesus?
Das Große Glaubensbekenntnis beginnt mit: „Ich glaube an den einen Gott …“ und knüpft damit hörbar an das monotheistische „Höre, Israel!“ (schemá ísrael: Dtn 6,4ff) an, und spricht auch im Folgenden vom einen Herrn Jesus Christus, Gottes „eingeborenem (unigénitum) Sohn“, was daran erinnert, dass nicht von mehreren Göttern die Rede sein kann. Das meist verwendete Apostolische Glaubensbekenntnis hat einen solchen Vorspann nicht und zählt die göttlichen Personen einfach der Reihe nach auf: „Ich glaube an Gott … und an Jesus Christus, seinen einzigen (únicum) Sohn, unseren Herrn“, was verständlicherweise Bedenken des Judentums auslöst bzw. auf offenen Widerspruch im Islam stößt.
Auch wir müssen uns fragen, was wir heute mit solchen Sätzen wie „gezeugt, nicht geschaffen“, der schon Sure 112 so heftig irritierte, anfangen. Anlass dafür ist nicht nur das eben gefeierte Jubiläum des Konzils von Nizäa (325), als noch dringender erweist sich der Umstand, dass der interkulturelle Diskurs sich zunehmend in den außerchristlichen Bereich verlagert, wo wir ebenfalls Rede und Antwort stehen müssen. Und wenn wir diese Herausforderung annehmen, werden wir ziemlich bald einsehen, dass auch unsere Dogmen nicht das letzte Wort sein können. Sie sind und bleiben Kinder ihrer Zeit, und darüber hinaus ist bei allen theologischen Aussagen die Differenz zwischen dem, was gesagt und dem, was nicht gesagt werden kann, ohnehin immer größer. Und nicht länger absehen können wir dabei auch von der Tatsache, dass es gerade in Glaubensfragen nicht nur um die Wahrheit geht, sondern ebenso und vielleicht noch mehr um die Macht: Wer hat das Sagen?
Das erste allgemeine Konzil wurde von Kaiser Konstantin bald nach der Wende (313) einberufen. Er stellte den anreisenden Bischöfen (aus dem Osten über 200, aus dem Westen vielleicht eine Handvoll) mit Begleitern seine Post zur Verfügung, übernahm die Reisekosten und lud seine Gäste, von denen einige noch die Spuren der Verfolgungen am Leib trugen, nobel in seinen Sommerpalast im heutigen Iznik/Türkei ein. Den nicht enden wollenden Diskussionen der Bischöfe setzte er einen Punkt mit seiner Meinung (griechisch: dógma), wonach Christus mit dem Vater nicht nur „wesensähnlich“, sondern „wesensgleich“ sei. Ersteres war die Ansicht des Presbyters Aríus aus Alexandrien, der Jesus dem Vater „unterordnete“, jedoch ist im Griechischen der Unterschied zwischen beiden Formeln viel geringer als im Deutschen und besteht einzig im sprichwörtlichen Jota, dem kleinsten Buchstaben des Alphabets: Wesensgleich heißt homo-oúsios, wesensähnlich homoi-oúsios (beide Begriffe sind uns über Homophilie bzw. Homöopathie geläufig) und wir könnten leicht den Eindruck gewinnen, dass es nur ein Streit um des Kaisers Bart war bzw. dass er selbst die Sache auch nicht so genau durchschaute. Er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal getauft, weil er damit vorsichtshalber bis zum Tod (der 337 erfolgte) warten wollte. Dann war ihm die vollkommene Sündenvergebung garantiert, während eine nachträgliche Kirchenbuße (Beichte) damals noch sehr fraglich war. Dass er sich letztlich arianisch, also nach der verurteilten Version taufen ließ, gibt zusätzlich Rätsel auf. Die Konzilsbeschlüsse hatten durch ihn jedenfalls Gesetzeskraft.
Soviel scheint aus heutiger Sicht klar: Konstantin sah die Einheit des Reiches durch theologische Streitigkeiten gefährdet. Auch war er selbst der unmittelbare Gewinner der Definition, denn sie sicherte ihm einen Rang zu, den ihm kein antiker Kaiserkult hätte bieten können (vgl. Kap. 13). Denn wenn er Jesus möglichst Gott gleichstellte, war er der nächste in der Rangordnung, während er bei einer „subordinatianischen“ Christologie auf einem entsprechend niedrigeren Podest hätte Platz nehmen müssen.
Das Konzil war jedoch nicht so bahnbrechend und weichenstellend, wie es nachträglich vielleicht gefeiert werden wollte. Die theologischen Diskussionen kamen erst mit dem Konzil von Chalzédon (451) einigermaßen zur Ruhe. Zudem war der Abstand zwischen Gott/Göttern und Mensch/en in der Antike weitaus geringer, als wir es heute einschätzen würden. Kulturgeschichtlich lag eine Vergottung von Menschen, insbesondere von Herrschern, in der Spätantike geradezu in der Luft (wie bei den römischen Cäsaren). Umgekehrt spazierten auch Olympbewohner gelegentlich über die Erde und vergnügten sich mit Menschentöchtern. Aber das waren eher amüsante Geschichten als Realität, während den christlichen Theologen das Unmögliche gelingen müsste, dass Gott selbst wahrhaft und wirklich Mensch und sogar Fleisch werden könnte (man sprach von Inkarnation), ohne den Kosmos aus der Hand zu geben. Die Lösung lieferte schließlich der Personbegriff, den es so vorher noch nicht gab und der ein wichtiger Meilen- bzw. Baustein in der Entwicklung der Allgemeinen Menschenrechte werden sollte. Als die „zweite Person“ Gottes könnte demnach Jesus Mensch werden, ohne dass die Welt aus dem Ruder lief, nein er musste wahrer Gott und wahrer Mensch sein, sonst könnte er uns nicht erlösen.
Das war die Position, für die sich besonders Bischof Athanásius von Alexandrien (300–373) stark machte. Er hatte bereits als Diakon seinen Bischof zum Konzil begleitet und wurde als dessen Nachfolger zum glühenden Verfechter des Dogmas, wofür er viel Leid in Kauf nehmen musste und fünfmal von seinem Bischofsstuhl verjagt wurde. Als griechischer Theologe war er hinsichtlich der Erlösung allerdings viel weniger als der kausal denkende lateinische Westen auf Sünde und Schuld fixiert, sondern hoffte auf eine neue Schöpfung und Vergöttlichung des Menschen und der Menschheit.
Die Idee war faszinierend, doch die Quadratur des Kreises konnte nicht recht gelingen. Dazu war die Begleitkonstruktion der zwei Naturen in der einen Person Jesu, die sogenannte „hypostatische Union“ zu sperrig. Schon beim Begriff der Gottesnatur kam Sand ins Getriebe. Wie sollte sie das Gemeinsame aus mehreren (angenommenen) Göttern extrahieren, um daraus eine allgemein gültige Gottesnatur zu definieren? Und bestand nicht auch die gesuchte Menschennatur nur in der Verneinung dessen, was man zuerst über Gott erdacht hatte, bzw. konnte überhaupt von einer solchen die Rede sein in einer Zeit und Kultur, welche bezüglich der Menschenwürde von Frauen, Kindern und Sklav:innen noch völlig blind war?
Die Konstruktion stieß eigentlich mehr Fragen an, als sie lösen konnte. Denn eine göttliche Allwissenheit des Jesuskindes hätte jede menschliche Entwicklung und Erziehung zur Farce gemacht, eine göttliche Allmacht, die ihn gelegentlich aus dem Nichts heraus Brot für Tausende „vermehren“ oder über den See Gennésaret hinwegschweben ließe, würde ihn jedes Mal schuldig sprechen, wenn ein Kind verhungert bzw. ertrinkt und er nicht von seinen besonderen Fähigkeiten Gebrauch machte. Und völlig passen muss die unsterbliche Gottesnatur beim Tod Jesu, denn spätestens dort müsste sie durch besonderen göttlichen Eingriff vorher wieder gelöst werden, aber im Grunde genommen funktioniert sie schon bei Zeugung und Geburt nicht.