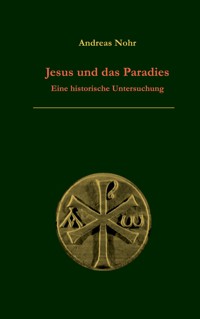
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Andreas Nohr unternimmt eine neue Sichtung der Quellen auf dem Hintergrund ihrer innovativen Untersuchung und Betrachtung. Die historisch-kritischen, sorgfältigen Ermittlungen legen einen Jesus frei, der mit einem gewaltigen Anspruch als "Heilsgestalt" auftritt, welcher über Vermittlung göttlichen Wollens weit hinausgeht und göttliche Autorität für sich selbst reklamiert. So zugewandt Jesus dabei den Menschen ist, so unerbittlich ist er aber auch in seiner Forderung, der Gegenwart des Reiches Gottes im Tun und Handeln seiner eigenen Person zu entsprechen. "Gottes endgültiges Reich: jetzt!", so der Zuspruch, der zugleich Anspruch ist. So hoch dieser Anspruch, so tief aber auch der Fall und das Scheitern Jesu. Wie aus solchem Desaster die Begründung einer spätantiken "Mysterien-Religion" und dann einer Weltreligion wird, entfaltet der Neuansatz der Jesus-Jünger unter dem christlichen Grundsymbol der "Auferstehung".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
I. Einklang
II. Vom Paradies
II. 1. Lebenswille
II. 2. Lebensformen
II. 3. Paradies
III. Jesus
III. 1. Stimmen
III. 2. Gott-Mensch
III. 3. Beginn
III. 4. Johannes
IV. Der Gott Jesu
IV. 1. Das Werden Gottes
IV. 2. Apokalyptik
IV. 3. König und Vater
V. Königsherrschaft Gottes
V. 1. Die Gegenwart der Königsherrschaft
V. 2. Der Ort der Königsherrschaft
V. 3. Die Zeit der Königsherrschaft
V. 4. Die Sichtbarkeit der Königsherrschaft
VI. Von Gott
VI. 1. Potentia absoluta
VI. 2. Pantheismus?
VII. Die Wirklichkeit der Königsherrschaft
VII. 1. Vergebung
VII. 2. Wunder
VII. 3. Mahl und Gemeinschaft
VII. 4. Gesetz
VII. 5. Gleichnisse
VII. 6. Ergebnisse
VIII. Jerusalem
VIII. 1. Der Einzug
VIII. 2. Der Tempel
VIII. 3. Die Aktion
VIII. 4. Der Zweck
IX. Menschensohn
IX. 1. Weder – Noch I.
IX. 2. Weder – Noch II.
IX. 3. Jesu Nähe zum Menschensohn
IX. 4. Die „apokalyptische Modalität“
IX. 5. Konsequenzen
IX. 6. Der göttliche Menschensohn
X. Passion
X. 1. Abendmahl
X. 2. Festnahme
X. 3. Kreuzigung
XI. Auferstehung
XI. 1. Konsequenzgeschichten
XI. 2. Sehens-Geschichten
XI. 3. Intuitionsgeschichten
XI. 4. Ergebnisse
XII. Jesus von Nazareth
XII. 1. Jesu Gott
XII. 2. Jesu Weg
XIII. In Paradisum
XIV. Anhang
XIV. 1. Quellen
XIV. 2. Quellenkritik
XIV. 3. „Quests“
XIV. 4. Hindernisse
XIV. 5. Erschwernisse
XIV. 6. Fazit
Literatur
Namen
Biblische Namen
Vorbemerkung
Niemand kann die Geschichte des Jesus aus Nazareth nacherzählen, ohne dabei über Gott zu reden. Ja, womöglich würde Jesus selbst zustimmen, dass gar nicht er, sondern eben dieser Gott darin die eigentliche „Hauptperson“ ist. In der Regel wird nun aber in den bereits vorliegenden Jesus-Arbeiten dieser Gott fast wie eine Selbstverständlichkeit auf bestimmte Weise einfach vorausgesetzt. Gedacht scheint Gott dabei jeweils als eine monotheistische, personal verfasste Entität, etwa in der Art, wie auch heutige Philosophen meinen, dass der Gottbegriff zu füllen sei, so etwa Holm Tetens: „Gott als ein immaterielles, rein geistiges, allwissendes, allmächtiges, allgegenwärtiges und vollkommen gerechtes und barmherziges Wesen ist der Schöpfer des Universums“,1 oder, plakativer, Norbert Hoerster, der von dem theistischen Gottes-Begriff ausgeht, dass Gott zu denken ist „1. als einzig, 2. als ewig existent, 3. als körperlose Person, 4. als uneingeschränkt vollkommen, 5. als Ursprung der Welt, 6. als Erhalter und Lenker der Welt.“2
Solchen theistischen Gottesbegriff in die Geschichte Jesu einzutragen oder ihn darin vorauszusetzen, wie bisher weitgehend geschehen, ist aber problematisch.
Der Theologe Paul Tillich stellt immerhin fest: „Der übliche Theismus hat Gott zu einer himmlischen, ganz vollkommenen Person gemacht, die über Welt und Menschheit thront. Der Protest des Atheismus gegen eine solche höchste Person ist berechtigt. Es gibt keine Anzeichen für ihr Dasein, noch kann sie jemanden unbedingt angehen.“3
Und: „Letztlich ist es eine Beleidigung der göttlichen Heiligkeit, von Gott so zu reden, wie wir es von Objekten tun, deren Existenz oder Nichtexistenz zur Diskussion steht. Es ist eine Beleidigung der göttlichen Heiligkeit, Gott als Partner gemeinsamen Handelns anzusehen oder als höhere Macht, die man durch Riten und Gebete beeinflusst. Die Heiligkeit Gottes macht es unmöglich, ihn in den Ich-Welt-Zusammenhang und die Subjekt-Objekt-Korrelation heranzuziehen. Er ist selbst Grund und Sinn dieser Korrelation, nicht ein Element innerhalb derselben.“4
„Sinn“ und das „Unbedingte“ sind Elemente, wie sie Paul Tillich begriffsfüllend mit Gott in Zusammenhang bringt, und er präzisiert: „Aber das Unbedingte ist kein gegenständliches Objekt. Es kann durch Objekte nur symbolisiert, nicht erfasst werden. Das Glaubensobjekt hat notwendig symbolischen Charakter, es meint mehr, als es ausdrückt.“5
Schließlich aber: „Der Satz, dass Gott das Sein-Selbst ist, ist ein nicht-symbolischer Satz. Er weist nicht über sich selbst hinaus. Was er sagt, meint er direkt und eigentlich.“6
Gott als das Sein selbst – nicht leicht verständlich, nicht unbedingt eingängig; aber so viel ist diesen wenigen Sätzen doch zu entnehmen: Gott ist hier nicht von theistischer Art. Es gibt also neben der theistischen Füllung des Wortes „Gott“ auch andere, etwa eben jene „seinshafte“ Füllung des Begriffs bei Paul Tillich.
Es kann also nicht wie selbstverständlich der monotheistische Gott in die Geschichte Jesu eingetragen werden. Sondern es ist zunächst der Gehalt des Wortes „Gott“ bei den Juden zur Zeit Jesu zu ermitteln, ob dieser wirklich theistisch ist oder sogar monotheistisch, wie man üblicherweise meint. Sodann ist der Gehalt des Wortes „Gott“ bei Jesus selbst zu erfragen, und ob Jesus hier mit seiner Gottesvorstellung womöglich eigene Akzente setzt. Dabei wird auch die Kongruenz seiner Gotteserwartung mit diesem Gott selbst zu untersuchen sein, ob nämlich Jesus sich nicht möglicherweise in dem getäuscht hat, auf den er baute und hoffte. Und schließlich ist noch zu fragen, ob die Geschichte Jesu sich auch mit einer anderen, nicht theistischen Füllung des Wortes „Gott“ verträgt und darin angemessen zu erzählen ist.
Die Frage nach Jesus ist also von vornherein, immer schon und grundsätzlich auch die Frage nach Gott, nach seinem Gott, nach unserem Gott und nach dem „wahren Gott“. Das alles soll innerhalb der folgenden Kapitel jeweils an seinem Ort bedacht werden.
Vier kurze Hinweises sollen diese Einleitung abschließen:
1. Um meiner Geschichte des Jesus aus Nazareth zu folgen, muss man nicht selbst an Gott glauben; ob man Christ ist oder nicht, ist dabei unerheblich. Jeder kann dieser Geschichte hören und mitvollziehen, gleich mit welchen inneren Überzeugungen er das tut. Einzige Voraussetzung ist ein gewisses Interesse daran, die Geschichte des Jesus aus Nazareth auch wirklich hören und sie verstehen zu wollen.
2. Ich erzähle diese Geschichte aus historischer Perspektive. Ich erzähle in Entfaltung der Quellen, die über Jesus Auskunft geben. Das geschieht kritisch; die Quellen wurden gesichtet und bewertet, wie es in historischer Wissenschaft guter Gebrauch ist. Dass einige philosophische, anthropologische und theologische Elemente sich hier und da hinzugesellen, sollte nicht stören.7
3. Zudem möchte ich unterstreichen, dass es bei allen hier darzulegenden Erzählzusammenhängen ausnahmslos auf „natürliche Weise“ zugeht. Es gibt „übernatürliche“ Zusammenhänge so wenig, wie es Eingriffe aus einer transzendenten Obenwelt in die hiesige Untenwelt gibt. Es gibt nur eine Welt, und alles, was darin und daran geschieht, ereignet sich auf „natürliche Weise“. Fraglos ist der Begriff „natürlich“ im Grunde selbst wieder etlicher Erklärungen bedürftig. Ich belasse es aber dabei und hoffe, das Gemeinte ist auch so einigermaßen deutlich. Wenn Jesus Krankheiten heilt, ist das kein „Wunder“, sondern eine staunenswerte Fähigkeit, die freilich auch ein anderer oder gar jeder haben oder erwerben könnte. Wenn Jesus über das Wasser geht, wird niemand das wörtlich glauben, wahrscheinlich nicht einmal jene, die es tradierten, sondern wird verstehen müssen, worauf eine solche Erzählung in Wahrheit zielt. Auch die „Auferstehung“ ist nichts „Übernatürliches“, und selbst ein „leeres Grab“ wird sich in die Belange dieser Welt fügen müssen. Ob und wie das gehen kann, wird zu zeigen sein.
4. Abschließend nehme ich mir vor, mit Anmerkungen sparsam zu sein. Kurze Hinweise (Bibelstellen, Autoren) stehen geklammert im Text, Zitate und ausführlichere Argumente unten auf der Seite. An Literatur nenne ich nur das Nötige. Jahreszahlen, sofern „vor der Zeitrechnung“, sind mit einem Minus-, sonst mit einem Pluszeichen versehen. Die Abkürzungen biblischer Bücher folgen dem üblichen Gebrauch.
1 Tetens in Gutschmidt 2016, S. 174.
2 Hoerster 2005, S. 13, der sich das freilich nicht zu eigen macht, sondern es nur seiner Kritik zu Grunde legt.
3 Tillich 1983, S. 283.
4 Tillich 1983, S. 312.
5 Tillich 1962, S. 67.
6 Tillich 1983, S. 277.
7 Zu den Quellen habe ich am Ende eine kurze Beschreibung ihrer Art und des kritischen Umgangs mit ihnen beigegeben (=> XIV. Anhang).
I. Einklang
Jesus von Nazareth hat das Wort „Paradies“ nach den uns vorliegenden Quellen nicht verwendet – mit einer Ausnahme: Einer der beiden mit Jesus gekreuzigten Verbrecher, der ihn gegen den Spott des anderen in Schutz genommen hatte, sagte zu Jesus:
„Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagte zu ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. (Lk. 23,42 f.)
Das ist ein kurzer, aber bemerkenswerter Wortwechsel. Historisch wird er nicht sein; die biblischen Parallelstellen wissen zwar von Mitgekreuzigten, aber von keinem Dialog. Ein solches „Gespräch“ ist von derartigen Folterwerkzeugen herab auch wohl von vornherein unwahrscheinlich. Eine Tradition ist nicht erkennbar, man wird daher dieses Ereignis wohl dem Verfasser und Redaktor des Evangeliums zuschreiben müssen, den wir unter dem Namen „Lukas“ kennen. Obwohl also „fingiert“, zeigen die gewechselten Worte doch Besonderheiten, die auf Bedeutsames hinweisen:
Die Anrede „Jesus“ ist ungewöhnlich. „Meister“, „Lehrer“ oder „Herr“ sind sonst üblich. Die Anrede „Jesus“ dagegen klingt wie unter Vertrauten in einem Gespräch auf Augenhöhe. So spricht ein Bruder mit dem anderen. Und damit enthält sie einen Kern des Auftretens Jesu: Denn dieser sah sich und die anderen Menschen allesamt als Schwestern und Brüder. Davon ist selbst ein verurteilter Verbrecher im Vollzug der Todesstrafe nicht ausgenommen. Das allein ist schon bemerkenswert genug.
In den folgenden Worten klingt nun aber das Wort „Reich“ an, das man sonst in den Evangelien nur in der Verbindung mit Gott findet: „Reich Gottes“, das hier aber nicht Gott, sondern Jesus zugeschrieben wird. Dieser zweite Punkt ist noch bemerkenswerter als der erste. Denn damit „stattet der Text des Evangeliums den Messias (sc. Jesus, A.N.) mit Gaben und Vollmachten aus, die Gott vorbehalten sind“, so der Kommentator (Bovon 1989 z.St.). Streng genommen müsste man sagen, der Mitgekreuzigte redet Jesus als seinen Bruder an, zugleich aber als einen Gott; diese letzte Konsequenz auszusprechen, scheut sich der Kommentator indes, eine Scheu, die noch wiederholt begegnen wird. Der Text selbst in seiner Prägnanz und Kürze ist aber deutlich: Jesus ist Bruder, ist also Mensch. Und ist zugleich auch Gott. Wortschöpfend könnte ich sagen: Jesus erscheint hier als „Gott-Mensch“. Das ist überraschend, erstaunlich – und wohl nur schwer nachvollziehbar oder gar verständlich. „Gott-Mensch“ – dieser Begriff wird noch einer Klärung zu unterziehen sein.
Nun aber Jesu Antwort, auf die der Wortwechsel hinausläuft: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“ Das Wort „Paradies“ ist innerhalb der Evangelien ein „Hapaxlegomenon“; es erscheint ausschließlich an dieser Stelle. Fernhalten muss man die Erklärung, Jesus meinte damit den Ort, an dem die „Seligen“ nach ihrem Tod auf das Jüngste Gericht warten; derartiges gibt es erst im späteren Mittelalter. Tatsächlich wissen wir nicht, worauf Jesus – oder der Autor dieses Wortwechsels – hier mit dem Begriff „Paradies“ zielt. Ich vermute aber, es ist Gott selbst damit gemeint, dessen Namen auszusprechen man um dessen Heiligkeit willen vermied, sei es mithilfe passivischer Konstruktionen (das sogenannte „passivum divinum“) oder durch Verwendung alternativer Ausdrücke wie etwa: „der Heilige“, oder hier eben: „Paradies“.8
Für Jesus und den mit ihm Gekreuzigten steht das Ende unmittelbar und unausweichlich bevor. Aber an diesem Ende steht nicht ein dunkles Nichts, sondern das Paradies, diese einzigartige „Gottesentfaltung“. Von dem Begriff des Paradieses und wie er hier gemeint und im dann Folgenden verstanden sein soll, wird gleich noch ausführlicher die Rede sein.
Klimax und damit Kern dieses traditionellen oder redaktionellen Wortwechsels am Kreuz ist somit dies: „Am Ende – das Paradies!“ Das ist zwar nicht der Kern der Jesus-Botschaft, denn dieser wäre wohl eher mit dem Begriff des „Reiches Gottes“ zu benennen, das wird noch ausführlich dargestellt werden. Wohl aber ist es der Kern dessen, was sich aus Jesu Leben, Sterben und Auferstehen ergeben hat, verbunden mit dem Stichwort der „Auferstehung“; auch diese wird noch ausdrücklich dargestellt.
Das Stichwort des „Reiches Gottes“ benennt die von Jesus angesagte und schon von ihm selbst vorweggenommene Bewegung des Kommens Gottes aus seinem „Jenseits-Himmel“ herab zur Erde. Das Stichwort des „Paradieses“ aber benennt hier die umgekehrte, entgegengesetzte Bewegung: die Jesu und seines Mitgekreuzigten nach oben hin, zu jenem im „Jenseits-Himmel“ thronenden Gott. Just darauf zielt hier das Wort „Paradies“, das kaum anderes meint als „in Gott“ zu sein, aber zusätzlich eben die Qualität dieses Seins in Gott benennt. Das, was Jesus getan, gesagt und gewollt hat, ist also etwas anderes als das, was aus ihm wurde.
Weil so nun aber der Begriff des Paradieses von grundlegender Bedeutung für die dann zu erzählende Geschichte des Jesus aus Nazareth geworden ist, werde ich diese Geschichte mit einem freien Versuch beginnen, den Begriff des „Paradieses“ darzulegen, wie er alsdann stets gemeint sein soll.
8 Ob diese jüdische Vorsicht auch noch für den griechischen „Lukas“ in Anschlag zu bringen ist, muss natürlich fraglich bleiben. Wenn nicht, muss hier doch schon Tradition vorliegen und nicht nur Redaktion.
II. Vom Paradies
Gott, so die biblische Schöpfungslegende, schuf die Welt und setzte in die Mitte hinein einen Garten: den Garten Eden, das Paradies. Darin war es so, wie Gott es sich gedacht und wie er alles Seiende gemeint hatte, gleichsam die vollendete Schönheit Gottes. Aber noch fehlte ihm eines: der Mensch. Ihn nun schuf Gott aus Lehm, so die Legende, und hauchte ihm seinen Atem ein als seinen Lebensatem, insofern hatte der Mensch von Anbeginn Göttliches an sich und in sich. Aber der Mensch, Adam, überhob sich, nahm und aß Früchte von einem verbotenen Baum. Darum musste er das Paradies verlassen und wohnte fortan in Mühe, Arbeit und Schmerz „jenseits von Eden“. (Gen. 2,4 ff.)
Dieses biblische Paradies – legendarisch also. Der Gottesgarten, das Innere Gottes gleichsam – anscheinend ein Phantom. Also gibt es „in Wirklichkeit“ gar kein Paradies? Ist das Paradies nur ein ewig währender Traum vieler Menschenseelen? Der heile Ort ohne bedrückende Notwendigkeiten – nur ein „frommer Wunsch“?
II.1. Lebenswille
Das Leben ist ein Weg von ungefragter Geburt zu ungewolltem Tod. Es ist bildlich gesprochen ein Tanz auf einem Seil, das am Lebensanfang aufgehängt und an seinem Ende festgebunden ist, darunter aber öffnet sich ein schroffer Abgrund, und auch darin lauert: der Tod. Das Leben ist also ein Seilgang, mit dem Tod von zwei Seiten her drohend: vom Ende her, und aus dem Abgrund heraus. So ist die Angst immerzu allgegenwärtig, vorzeitig zu stürzen oder am Ende sich ins Nichts aufzulösen. Es ist die Angst, verloren zugehen. Diese Angst ist immer da, einmal leise, dann laut, jetzt scheint sie geschwunden, gleich brüllt die wieder auf. Die Angst ist unberechenbar, und sie erscheint unüberwindlich.
Obwohl der Mensch nie befragt wurde, ob er je auf ein solches Seil hinaus geboren werden wollte, geht er doch das Seil entlang, und zwar: tatsächlich dies auch wollend, nur nicht autonom, sondern heteronom: Denn im Menschen steckt eine Kraft, über die er nicht verfügen kann, die er einfach hat, weil sie zu seiner festen Ausstattung gehört: der Lebenswille. Es ist diese Kraft des Lebenwollens, die den Menschen auf seinem Seil hält und Schritt für Schritt weitergehen lässt. Es ist diese Kraft, die ihn auf die Frage: „Willst du jetzt nicht sterben?“, sofort und unbedacht antworten lässt: „Nein!“ Es ist Ausdruck dieser Kraft, dass ein Mensch beiseite springt, wenn ein Auto ungelenkt auf ihn zu rollt. Und ihr verdankt der Krebskranke die Energie, die schlimme Therapie auf sich zu nehmen, und die ihn, wenn diese nicht anschlägt, dazu drängt, anderes zu suchen, das ihn am Leben hält – bis hin zu Obskurem, denn Not lehrt nicht nur beten.
Dies sind die „Eckdaten“ jedes menschlichen Lebens: Zum einen das schwankende Seil zwischen den Pflöcken von Geburt und Tod, zum anderen der Abgrund unter dem Seil, der die Todesdrohung verdoppelt, und schließlich diese Ewigkeit suchende Lebenskraft, die aus dem Tod überhaupt erst eine Bedrohung macht – das Koordinatensystem des Lebens.
Allerdings: Es scheint, als könnte diese Lebenskraft erlahmen und am Ende gänzlich verloren gehen, etwa wenn die Krankheit derart Macht gewonnen hat, dass ein Leiden nicht mehr abwendbar ist, sondern als künftig andauernd vorgestellt werden muss, und nicht einmal Schmerzmittel mehr Linderung bringen. Das ist schlimm, ein arges Schicksal.
Mir scheint jedoch, selbst dann ist der Lebenswille nicht geschwunden, sondern hat sich verwandelt – in ein nicht mehr stillbares „Heimweh“ nach dem Möglichsein in Gott, in die Sehnsucht nach dem Paradies – also in ein Sterbenwollen. Solange aber dieser Wille noch in seiner „reinen“ Form besteht, wird ein Mensch die Schritte auf seinem Lebensseil weiter wagen und tastend suchen – in einer bestimmten Weise allerdings.
II.2. Lebensformen
Ein Mensch weiß: Wenn er nicht isst und trinkt, wird er sterben. Dagegen steht sein Lebenswille. Dieser macht es, dass Nahrung zu sich zu nehmen zu einem unerlässlichen, also zu einem notwendigen Handeln wird. Somit ist es aber auch notwendig, sich diese Nahrung zu beschaffen. Auch die Mittel, die man dafür benötigt, sind Instrumente des Notwendigen. In der Regel handelt es sich um Geld, das man verdienen muss. Dazu muss man meist einen Beruf ergreifen, den man jedoch zuvor erlernt haben muss. Auch Lernen ist darum notwendig, es beginnt mit dem ersten Tag des Lebens. Und streng genommen hört es auch nicht auf, solange man lebt. Die Maßnahmen des Lernens, also zur Schule, in die Lehre zu gehen, zu studieren, gehören samt und sonders in den Bereich des Notwendigen.
Wenn aber ausgelernt und der Beruf ergriffen ist, endet die Notwendigkeit dennoch nicht: Eine Stelle suchen und sie ausfüllen, oder ein Geschäft eröffnen und es führen oder welchen Erwerb auch immer ausüben – alles dies geschieht unter dem Vorzeichen des Notwendigen.
Wenn man es streng überlegt, wird man bemerken, dass nahezu alles, was ein Mensch von Tag zu Tag tut, er mit Notwendigkeit bewältigen muss. Die Notwendigkeit ist weitgehend die Beherrscherin des Menschenlebens. Und zugleich seine Knute. Weil ein Mensch leben will, ist er den Bedingungen unterworfen, die ihm die Notwendigkeit diktiert. Sie beginnen mit den Beschaffungen der Überlebensmittel und setzten sich von dort aus fort, sich selbst „vererbend“ bis in kleinste und privateste Details des Menschenlebens hinein.
Dass nun ein Kind zur Schule geht und dort lernt, ist eine Notwendigkeit. Aber es ist denkbar, dass dieses Kind gerne in die Schule geht, mit Freude lernt, und die Gemeinschaft der Mitschüler schätzt. So leidet das Kind nicht unter der Notwendigkeit. Zum Glück geht es recht vielen Kindern so. In derartiger Freude wird die Unerbittlichkeit der Notwendigkeit zugedeckt, der Zwang wird womöglich gar nicht mehr wahrgenommen. Nicht jede Entsprechung einer Notwendigkeit muss ein Akt der Unterwerfung, manche kann auch einfach „gern erfüllt“ sein.
Aber es kann einem Menschen die Kraft über all das Müssen schließlich klein werden. Die immerwährende Funktionierens-Tüchtigkeit kann die Freude am Tun schwinden lassen – bis sie austrocknet. Dann bleibt nur die Empfindung der Last; müde ist man geworden, fühlt sich ausgebrannt. Nun braucht ein Mensch Hilfe, die von Freunden, die ihm zusprechen, oder Seelsorgern, die ihn trösten oder von Ärzten, die seine Qual lindern – sei es durch Psychotherapien, sei es durch betäubende Pharmaka. Nur kann kein Helfer, auch der beste nicht, erreichen, was die Not wirklich lindern würde: Das wäre, die Notwendigkeit zu begrenzen. Das aber ist nicht möglich, die Notwendigkeiten bleiben rücksichtslos bestehen. Leben unter der Notwendigkeit ist darum ein gefährdetes Leben, weil sich seine Herrscherin als drückende Unerbittlichkeit mehr und mehr enthüllen kann. Dies aber nicht muss. Doch auch dann wird von Zeit zu Zeit die Empfindung aufsteigen und der Wunsch laut werden, die Notwendigkeit nähme doch ihre Belastung einmal fort und legte sie für eine Weile beiseite. Das ist Wunsch und Traum des Aufatmens. Unmöglich ist das nicht.
Und geschieht sogar dann und wann. Denn unter der Notwendigkeit zu stehen, ist nur die eine Lebensform. Die andere ist es, sich der Möglichkeiten zu erfreuen. So mancher erlebt auf seiner Urlaubsinsel mit den Traumstränden, der üppigen Vegetation und wohlvorbereiteter Vollpension Paradiesisches. Urlaub zu nehmen und auf solche Insel zu reisen, fällt nicht unter die Notwendigkeiten des Lebens. Aber es ist eine Möglichkeit. Auch auf der Insel selbst ist man von Notwendigkeiten frei. Man gestaltet sich seinen Tag nach eigenen Wünschen. Alles ist jetzt möglich: zu segeln oder zu wandern – oder im Bett zu bleiben. Nichts muss geschehen, aber alles kann geschehen. So sieht Freiheit aus, welche die Atmosphäre der Möglichkeit erfüllt. Und diese Freiheit der Möglichkeit vererbt sich gleichfalls bis in jedes Detail hinein. Auch das Essen hat am Mittagsbuffet seine Notwendigkeit abgelegt und ist zur appetitlichen Möglichkeit geworden.
Allerdings: Als schöne Möglichkeit stellt sich diese Urlaubsinsel nur dem Reisenden dar, nicht aber dem zur Insel gehörigen Einwohner, nicht dem Portier, nicht dem Zimmerservice, nicht dem Koch oder der Kellnerin. Was sie dem Reisenden an Möglichkeiten bereitstellen, tun sie unter dem alltäglichen Zwang der Notwendigkeit. Sie müssen warten, bis sie selbst einmal ihre Urlaubsinsel finden, auf der wiederum sie in das Kleid der freien Möglichkeit schlüpfen können.
So fällt das Leben eines Menschen unter zwei Herrschaften: unter das bedrängende Regime der Notwendigkeit und die milde Herrschaft der befreienden Möglichkeit.
II.3. Paradies
Nach diesen Hinleitungen kann ich nun ausdrücken, was das Wort „Paradies“ jetzt und im Folgenden bedeuten und bezeichnen soll: das Sein in der Freiheit der Möglichkeiten. Mit dem Paradies meine ich also fortan keinen bestimmten, sondern jeden Ort, an dem ein Mensch solche Freiheit erlebt, und ein „Paradies“ ist solches auch nur solange, wie diese Freiheit währt. Paradies soll jetzt nicht mehr ein „mythischer“ Ort sein, sondern eine Seinsbefindlichkeit, in welcher die Möglichkeit die Notwendigkeit abgelöst hat.
Das ist nicht nur auf Urlaubsinseln möglich: Ich denke mir im sommerlichen Abend ein Lagerfeuer am Waldrand, an dem Freunde sich mit gutem Essen, Wein und vielleicht einigen Gitarren eingefunden haben. Keiner der Freunde war dorthin zu kommen gezwungen. Es war jeweils der freie Entschluss. Man redet. Man isst. Man singt. Man trinkt. Alles Erforderliche ist abgetan. Nichts mehr, das jetzt bedrückt, selbst der Tod ist fern. Auch das ist ein Paradies.
Ein anderes Beispiel ist das Weihnachtsfest. Niemand muss es feiern. Aber es ist möglich, das zu tun. Ich muss den Heiligen Abend wohl nicht beschreiben: den Glanz der Kerzen, den Duft des Tannenbaums, das Singen, das Schenken, das Festessen – wenn alles gelingt, ist es buchstäblich paradiesisch. Nur geht es nicht immer gut, wie man hört, und endet gar zu oft in Streit und Bösartigkeiten. Als Grund dafür vermute ich, dass man das Weihnachtsfest nicht als Möglichkeit angesehen und gefeiert hat – sondern als Notwendigkeit. Gerät Weihnachten unter gesellschaftliche Zwänge, verliert es seine freie Möglichkeit und fällt unter das Vorzeichen der Notwendigkeit. Diese nötigt zum Gelingen des Paradies-Festes. Und nimmt ihm so das Paradiesische.
Blickt man jedoch auf eine gelungene Weihnacht, wie auch auf das Fest am Waldrand oder den Urlaub auf der paradiesischen Insel, fällt auf, dass stets die Notwendigkeit nur vorübergehend wirklich geschwunden ist. Das Mittagsbuffet auf der Insel erinnert doch ein wenig schon wieder an die Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme. Wenn am Lagerfeuer das Mobiltelefon klingelt, ist oft der Zauber schon wieder vorbei. Und ist die Weihnachtsgans verbrannt, ist es das Fest gleich mit. Die Paradiese der Menschen sind zeitlich begrenzt, von Einbrüchen jederzeit gefährdet, verwundbar, zerstörbar. Sie sind verschieden groß und haben unterschiedliches Gewicht. Ein absolutes Paradies kennen wir nicht. Wir müssen mit kleinen und zerbrechlichen Abbildern vorliebnehmen. Das ändert nichts daran, dass ein Mensch immer und überall auf der Suche nach Paradiesen ist. Im Grunde aber: immer sogar nach dem absoluten Paradies.
Ein Paradies kann sehr kurz und scheinbar sehr klein sein. Das kleine Kind, das vor Angst und Unruhe schreit und zur Nacht nicht einschlafen kann, wird von der Mutter aufgenommen, sie schließt das Kind in ihre Arme und streicht ihm übers Haar: „Alles ist gut“, tröstet sie ihr Kind, „alles ist gut!“ Und siehe – plötzlich sind die gefährdeten Notwendigkeiten, die Figuren der Angst dahin – und es ist für das Kind Paradies geworden. Es schläft ein.9
Aber ist das wirklich nur ein „kleines“ Paradies? Nein, es gibt nicht mehr oder weniger Paradies, sondern wenn es ist – dann ist es ganz, oder es ist nicht – dann ist es gar nicht. Die Relativität des Paradieses ist seine zeitliche Begrenztheit. Absolute Paradiese sind zeitlos. Ein anderes Wort für „zeitlos“ ist „ewig“.
Dem Willen zu leben steht als Kontrapunkt der Tod gegenüber. Der Lebenswille macht aus dem Tod den Feind. Denn der Tod ist der Inbegriff des Nötigen: Sollten auch alle Notwendigkeiten geschwunden sein, so bleibt der Tod doch bestehen als Ausdruck dafür, dass ein Mensch sterben muss. Darum wird ein Paradies vollkommen nur sein, wenn auch die Notwendigkeit, die der Tod setzt, zur Seinsmöglichkeit geworden ist. Auf der paradiesischen Urlaubsinsel ist das weitgehend so: Man genießt das freie Dasein und denkt jetzt gewiss nicht – an Tod und Sterben. Für eine Weile negiert man unbewusst oder bewusst die Todesmacht, die damit, subjektiv, für den Augenblick auch nicht mehr besteht. Aber bloße Negation hebt das Verneinte nicht auf. Der Tod mag zurückgedrängt, mag in den Hintergrund geschoben worden sein. Aber er ist nicht fort. Er wird sich wieder bemerkbar machen. Die Notwendigkeiten kehren zurück. Somit ist aber die Fülle eines Paradieses erst dort erreicht, wo auch der Tod seine Macht verloren hat. Also dort, „wo nicht mehr sein wird Leid noch Geschrei noch Schmerz und nicht einmal mehr der Tod“. (Offb. 21, 4.) Ein Paradies ist das freie Feld der Möglichkeiten. Oder: Das Paradies ist kein Ort, sondern das feste Wissen, nicht verloren zu gehen. In diesem Sinn soll das Wort „Paradies“ im Folgenden gemeint sein, wenn es im Jesus-Narrativ erscheint.
„Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“ – gemeint ist hier das absolute Paradies, grenzenlos, ungeortet und zeitenfrei, also Gott: „In paradisum“ ist nichts anderes als „in deum“.
Nach dieser Wortklärung kann ich nun das eigentliche Jesus-Narrativ aufnehmen. Darin muss sich dann diese Wortklärung schließlich bewähren.
9 Berger 1991.
III. Jesus
III.1. Stimmen
Wer Jesus ist – darüber gehen die Meinungen auseinander.
Für die einen ist er der Grund ihres Glaubens und der Herr ihres Lebens. Für die anderen ist er immerhin ein „guter Mensch“ oder gar ein soziales und ethisches Vorbild. Es gab Zeiten, da hielt man Jesus für einen Revolutionär, und es war kein Zufall, dass ein bestimmtes Plakat von Ernesto „Che“ Guevara derart gestaltet war, dass jeder im Bildnis mühelos das Klischeebild von Jesus wiedererkennen konnte. Dieses Bild: Ein junger Mann, schlank, gutaussehend, mit langen braunen Haaren und Bart, unverständlicherweise gerne auch mit leuchtend blauen Augen, dazu in wallende weiß signalisierende Gewänder gekleidet und auf Sandalen schreitend, ein Bild, an dem die Filmindustrie Hollywoods nach Kräften mit gestrickt hat, und von dem niemand auch mit bestem Willen sagen kann, ob es zutrifft. Dennoch bin ich fast sicher: Es trifft nicht zu. Für manche ist Jesus der Erfinder des Pazifismus – das trifft genauso wenig zu; Jesus war keineswegs die andauernde Sanftmut in Person. Und Jesus ist auch nicht der „woke“ Menschen- und Naturfreund, den man in der Grünen Partei ansiedeln würde, wie er von weit mehr als nur etlichen Kanzeln herunter schallt. Ich bin dem Folgenden nicht nachgegangen, aber für so manche Feministin ist Jesus „letztlich“ oder „im Grunde“ – eine Frau!
Es sind uns aber auch Kennzeichnungen aus Jesu Umwelt bekannt, die historisch zuverlässig sind: Er sei ein Fresser und Weinsäufer gewesen. Das ist zwar polemisch, aber nicht ohne jeden Anhalt an der Person des so Inkriminierten. Seine Familie, zu der natürlich auch die nunmehrige katholische Heilige Maria gehörte, hielt ihn für verrückt, „er ist von Sinnen“, heißt es. Man wird sehen: Auch das ist durchaus nachvollziehbar. Denn Jesus hielt sich – „irre“ genug – für Gott oder zumindest für eine „göttliche Gestalt“. Wenn jemand derartiges sich selbst zuspricht, liegt es durchaus nahe, dass man, statt es zu glauben, lieber nach dem Arzt rufen wollte. Ein Gotteslästerer sei er, tönt es aus der griechischen Bibel – das ist dann natürlich kein Wunder. Mose sei geringerwertig als er, und den Tempel wollte er gar zerstören, heißt es – beides hat, wie man sehen wird, seinen guten Grund.
Die hier aufgeführten Stimmen aus Jesu Zeitgenossenschaft passen nicht so recht zu den am Anfang angeführten Stimmen vom „guten Menschen“ oder „ethischen Vorbild“.
Ich selber habe Jesus zu Beginn als einen „Gott-Menschen“ tituliert, ich hätte auch sagen können: einen Menschen-Gott. Wie fügt sich das zu den bis hierher aufgelisteten Jesus-Titulaturen und -Zuweisungen?
III.2. Gott-Mensch
Kommt alles aus Gott, dem Schöpfer, der absoluten Schaffenskraft, der „potentia absoluta“, so kommt auch Jesus von Nazareth aus Gott.10
Er war verborgen in den Möglichkeiten Gottes, bis es „an der Zeit war“ zu „werden“, nämlich Mensch zu werden. Insofern könnte man ihn auch den „Sohn Gottes“ nennen, aber nicht in genetisch-genealogischem Sinn, sondern bildlich in dem Sinn eines „Gewordenen“ aus der Fülle der Möglichkeiten Gottes heraus. Insofern ist Jesus Gott, also nicht „leiblich“, sondern im Sinne einer Teilhabe am Gott-Sein.
Solches Kommen Jesu aus Gott benennt auch der Prolog des Johannes-Evangeliums, der Jesus als göttliches „Wort“ kennzeichnet, als „logos“:
Im Anfang war das Wort, der Logos, und der Logos war bei Gott, und von Gottes Wesen war der Logos. … und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. (Joh. 1,1.14)
Und im Philipperbrief teilt der Apostel Paulus mit:
Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. (Phil. 2,6 ff.)
In diesem traditionellen Hymnus, den Paulus überliefert, ist das Kommen des gottgleichen Menschen Jesus aus Gott ebenso benannt wie auch seine Rückkehr zu Gott.
Als solcher ist Jesus ein „Gott-Mensch“: Gott, insofern er aus Gott kommt und wieder zu Gott wird, und Mensch ohnehin: als Marien-Sohn. Als dieser „Gott-Mensch“ bleibt Jesus aber nicht allein, denn hinzu kommt dieses:
Und das Volk saß um ihn herum, und sie sagen zu ihm: Schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnet ihnen: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Geschwister? Und er schaut, die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem andern an und spricht: Das hier ist meine Mutter, und das sind meine Brüder und Schwestern! (Mk. 3,34 ff.)
Diese vermutlich historische Episode zeigt, dass Jesus seine Mitmenschen nicht anders ansieht als sich selbst: als Wirklichkeiten bestimmter göttlicher Möglichkeiten, auch sie also: je einzelne Verwirklichungen Gottes im Sinne der somit gegebenen Teilhabe am Göttlichen. Alle haben denselben „himmlischen Vater“, denselben Ursprung in der göttlichen Möglichkeit, und alle verdanken sich der darin wirkenden göttlichen dynamischen Werdekraft. Daran erinnert die im Verlauf der Kirchengeschichte sich durchhaltende Anrede der Christen untereinander als „Schwestern und Brüder“, mit der sie sich ihrer gemeinsamen Herkunft und, wie ich hinzufügen muss, ihres gemeinsamen Ziels erinnern und sich dieser Gemeinsamkeit versichern.
Jedes Leben, das Jesu und das aller seiner Brüder und Schwestern, ist ein Ring, dessen Anfang und Ende sich in Gott verbunden weiß. Auch dies ist nicht einfach „esoterische Rede“, sondern vor allem hinter der Rückkehr zu Gott steht die schon altkirchliche Theosis-Lehre der „Vergottung“: „Gott wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht würde“, so der höchst orthodoxe Bischof von Alexandrien, Athanasios (gest. +373). Dies ist nur ein Votum aus einer langen, bis in die Gegenwart (mindestens bei Kirchen orthodoxer Konfession) reichende Erlösungslehre der „Vergottung“ als dem Ziel menschlichen Lebens. Ich kann diese Lehre hier nicht dezidiert nachzeichnen,11 denke aber, dass die skizzenhaften Andeutungen insgesamt bereits ausreichen, um zu verdeutlichen: Auch unter einem „modalen Gottesbild“, wie ich es unten zu skizzieren versucht werde (=> VI.), ist das evangelische Kerngeschehen des Kommens Jesu von Gott her und seines Gehens zu Gott hin sehr wohl aussagbar. So weit ist Jesu „Auftreten“ also an ein theistisches Gottesbild nicht notwendig gebunden. Allerdings wird über die Frage der „Rückkehr“ Jesu vermittels seiner „Auferstehung“ noch ausdrücklich und gesondert zu reden sein (=> XI.).
Es mag ungewöhnlich und befremdlich klingen, alle Menschen, insofern sie aus Gott kommen, „göttlich“ zu nennen. Dies wird aber noch erläutert werden. Noch befremdlicher mag es erscheinen, dass Jesus ein Gott gewesen sein soll, mindestens in seiner Selbstsicht und in seinem Selbstverständnis. Aber auch der Sinn dessen wird noch aufgeklärt werden (=> IX.). Alle historischexegetischen Ausleger unserer Jesus-Quellen, obwohl sie Jesus viel Autorität zubilligen, scheuen vor der Bezeichnung Jesu als eines Gottes zurück. Nicht so die altkirchliche Trinitätslehre, bis heute ungebrochen in nahezu allen Kirchen und Konfessionen akzeptiert und gültig: Der Vater ist Gott, der Sohn, also Jesus, ist Gott, und der Heilige Geist ist Gott. Diese Trinitätsbehauptung ist weniger absurd als sie hier zunächst erscheinen mag. Soviel
aber muss schon jetzt deutlich sein: Die „Gottheit“ Jesu unterstreicht sie allemal – und damit eben auch zwangsläufig sein Gott-Sein als „Gott-Mensch“.
So viel einstweilen zu den Stimmen, wer Jesus war, was man ihm zuschrieb, welche Würde er sich beimaß. Nun aber dazu, wie er zu dem wurde, was er war – erst einmal bis hin zu seinem „Auftritt“ am See Genezareth in Galiläa.
III.3. Beginn
Ob „Herr des Lebens“ oder wenigstens „guter Mensch“, ob „Fresser und Weinsäufer“, Verrückter oder gar „Gott-Mensch“ – das ist nicht einstimmig. Aber was immer davon zutraf – er musste es erst einmal geworden sein. Am Anfang dieses „Werdens“ steht die Geburt.
Aber bezüglich dieser Frage, sowie jener nach Jugend und Familie, fasse ich mich kurz. Jesus ist wahrscheinlich in Nazareth geboren und aufgewachsen. Bethlehem als Geburtsort ist dagegen unwahrscheinlich und verdankt sich dem urgemeindlichen Zug, möglichst viele Prophetenworte auf Jesus zu beziehen, hier eine Weisung des Propheten Micha (-8. Jahrhundert), der Messias werde als „Sohn Davids“ aus Bethlehem kommen. Der Zeitpunkt der Geburt ist ein wenig vor oder nach dem Jahr +1 anzusetzen, die umfängliche Debatte der Historiker, ob -4 oder +2 übergehe ich aus Ermüdungsgründen, zumal das genaue Jahr herzlich bedeutungslos ist. Wichtiger ist der Tod, der unter der Präfektur von Pontius Pilatus verbürgt ist. Insgesamt wurde Jesus wohl nur wenige Jahre älter als dreißig.
Die Mutter Jesu war eine junge Frau namens Maria. Dass sie eine Jungfrau gewesen sein soll, verdankt sich einem Übersetzungsfehler. Möglich, dass sie bei Jesu Geburt ledig war, möglich auch, dass ihr späterer Ehemann Joseph hieß, den man wohl als Baufacharbeiter einzuordnen hat. Mit Josef hatte Maria etliche Kinder, von den Söhnen weiß man die Namen, von den Töchtern nicht. Ob man diese alle als Geschwister oder nur als Halbgeschwister Jesu anzusprechen hat, mag sich die Phantasie eines jeden selbst ausmalen. Nach anfänglichen Vorbehalten gegenüber Jesus ist wenigstens einer seiner Brüder mit Namen Jakobus später „Vorsteher“ der ersten Gemeinde in Jerusalem geworden; was ihn von seinen Vorbehalten abbrachte, wissen wir nicht, es ist auch belanglos.
Nicht belanglos ist die folgende Liste weiteren Nichtwissens: Wir wissen nicht, was Jesus veranlasst hat, sein Elternhaus zu verlassen, und nicht, wo er alsdann gewesen ist, am wenigsten, wie er zu seinem eklatanten Selbstbewusstsein gekommen ist, das ich angedeutet habe und von dem die Rede noch ausführlich wird sein müssen. Wir wissen ferner nicht, ob Jesus lesen oder sogar schreiben konnte, wir wissen nicht, welche Sprachen er außer dem heimischen Aramäisch beherrschte. Wir wissen auch nicht, woher er seine offenbar profunde Schriftkenntnis hatte, noch weniger, woher seine verbürgte Fähigkeit kam, Kranke zu heilen, vor allem als Exorzist, auch davon wird die Rede noch sein. Um die Liste etwas pikant abzuschließen: Wir wissen auch nichts über Jesu allerdings offenbar besonderes Verhältnis zu dem weiblichen Geschlecht, auch nicht, ob er eine Geliebte namens Maria Magdalena hatte oder gar eine Ehefrau diesen oder anderen Namens – oder ob er stattdessen homosexuell war, ist doch in einem allerdings späteren Evangelium von einem „Lieblingsjünger“ die Rede, den man nicht recht einordnen kann. Zu welchem Ergebnis an dieser Stelle auch immer die interessierten Gedanken der Leser kommen mögen – sie sind insofern allesamt von vornherein falsch, weil niemand auch nur ein halbes Stück von alledem wissen kann. Es muss also viel an sich Interessantes von und über Jesus im Dunklen bleiben. Das liegt an den Quellen, die man sich eben nicht als „Jesus-Biographien“ denken darf, sondern sie funktionieren wie ein Setzkasten, in dessen Fächer einzelne Brocken eingelegt wurden, je nach Hang und Neigung des jeweiligen Setzers. Und nicht einmal alle enden mit dem scheinbar biographischen Ende der Hauptperson, sondern sind „reine“ Setzkästen wie die von Exegeten herausgearbeiteten schriftlichen Spruchquelle Q oder das Thomas-Evangelium.1
Was man aber aus der „Vorbereitungszeit“, also dem „Werden“ Jesu weiß: Er gehörte eine Zeitlang zu Johannes, den man „den Täufer“ nannte.
III.4. Johannes
Dieser Johannes, eine Art später israelitischer „Prophet“, rief die Menschen seiner Zeit heraus an den Jordan, wo er ihnen angesichts des nahen Weltendes Umkehr predigte, sie zur Buße rief und sie durch eine Taufe für das bevorstehende Gottesreich – und damit in eins auch: Gottesgericht! – reinigte. Umkehr meinte: endlich und dann ein für alle Mal nach dem Leben schaffenden Gesetz Gottes zu handeln. Und die Reinigung durch die Taufe erlaubte es, rein vor Gott zu treten, wenn es so weit wäre, lange würde es ja nicht mehr dauern:
„Schon ist ja die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt: Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen.“ (Lk. 3, 9) Johannes gehört zu dem, was ich nachher als „Apokalyptik“
genauer skizzieren werde (=> IV.2.). Bei ihm war ein „Endzeitklima“ deutlich spürbar. Die Zeit lief aus. Die Welt war verloren, weil die Menschen gottfern waren. Das Ende klopfte schon an die Tür. Gott selbst würde kommen, allem sein Ende zu bereiten. Und die Menschen alsdann nach ihren Taten zu richten. Dies würde bald geschehen, sehr bald, daher die Dringlichkeit dieser „Umkehrtaufe“.
Von solch apokalyptischen Vorstellungen gefärbt mahnte und drohte Johannes der Täufer. Fragwürdig ist aber, ob er zudem wirklich auf einen verwiesen hat, der „nach mir kommt“, was in der griechischen Bibel zweifelsfrei auf Jesus als „dem größeren“ zielt. Aber das klingt doch gar zu sehr nach einem nachträglichen Christeneinfall zur gefälligen „Erhöhung“ des eigenen Namensgebers.
Anderes ist wichtiger: Johannes wird in einen Zusammenhang mit dem Propheten Elia gebracht (-9. Jahrhundert, Israel). Elia muss in Gottes Augen ein äußerst trefflicher Sachwalter seiner Vorstellungen gewesen sein – was angesichts der Ermordung von rund 500 Baal-Priestern nicht leicht nachzuvollziehen ist – weswegen Gott ihn nicht hat sterben, sondern in einem feurigen Wagen vor den Augen seines „Nachfolgers“ Elisa gen Himmel fahren lassen. Von diesem so entrückten Elia hieß es bei dem Propheten Maleachi:
Seht, ich sende meinen Boten, und er wird den Weg freiräumen vor mir. … Und der Bote des Bundes, an dem ihr Gefallen habt, seht, er kommt!, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber könnte den Tag ertragen, da er kommt? Und wer könnte bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz der Walker. Und er wird sich niedersetzen und schmelzen und das Silber rein machen, und er wird die Leviten rein machen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber. Und sie werden dem Herrn Gaben darbringen in Gerechtigkeit. … Und ich werde mich euch nähern zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen Zauberer und gegen Ehebrecher und gegen jene, die schwören und dabei lügen, und gegen jene, die den Tagelöhner um seinen Lohn bringen, Witwe und Waise unterdrücken und den Fremden wegdrängen und mich nicht fürchten!, spricht der Herr der Heerscharen. (Mal. 3,1 ff.)
Und dieser Bote, so findet es sich bei Maleachi als hellenistischer Epilog, wird der im Himmel just dazu aufbewahrte Elia sein. Der zitierte Text hat sich in solcher ergänzten Gestalt als nunmehr „apokalyptisch“ enthüllt,12 und Apokalyptik ist just, was Johannes da praktizierte. War er also in solchem Rahmen der verheißene Elia? Johannes sagte nein, Jesus sagte ja. Was zutrifft, wissen wir nicht, keine von beiden Äußerungen erscheint verlässlich. Verlässlich ist nur, dass im endzeitdenkenden, also „apokalyptischen“ Gedankenklima jener Zeit „messianische“ Heilsgestalten wie Elia eben auch mit „Wetter machten“, Gestalten, die im Prozess der großen Wende zum himmlischen Gottesreich „Rollen“ oder „Funktionen“ hatten. Und Gestalten, die man in Menschengestalten wie Johannes als ihrem Muster wiedererkennen, die man mit solchen Gestalten identifizieren konnte. Bezüglich Elias geschieht das übrigens nicht nur bei Johannes, sondern auch im Umfeld Jesu selbst: Bei seiner sogenannten „Verklärung“ (Mk. 9,2 par.) steht Jesus gottgleich auf dem Berg mit Mose (dem Gesetz) zur einen und eben: Elia (den Propheten) auf der anderen Seite.
Zur Beruhigung: Diese „Verklärung“ ist ein „Sprachbild“ wie etwa auch der auf dem Wasser wandelnde Jesus, dem man noch begegnen wird (=> VII.2.2.), ein Bild also, keine historische Reportage. Jesus stand nie „in Wirklichkeit“ mit dem längst toten Mose und dem kaum weniger lange toten Elia auf einem hohen Berg. Sondern das Bild „malt“ das „Wesen“ des Christus in seiner erhabenen Würde, nicht aber dessen historische Schrittsetzungen.
Und als Jesus schließlich am Kreuz ruft „eli, eli, lama asabtani?“, bezieht er sich damit sprachlich zwar auf Gott, aber die Leute verstehen klanglich: „Halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihm hilft!“ (Mt. 27,49) Weder das eine noch das andere ist „historisch“, außer in dem Sinn, dass alles zusammen zeigt, wie durchaus wach und wohl doch recht verbreitet im jüdischen „Endzeitklima“ jener Zeit das Wissen um solche letztgültigen Heilsmittler gewesen ist, mit deren „Auftritt“ in der „Wende“ des alten zum neuen apokalyptischen Äon man rechnete. Es finden sich in anderen apokalyptischen Schriften weitere solcher Heilsmittler, darauf werde ich zurückkommen. Hier kam es mir nur darauf an, herauszustellen, dass die Identifikation eines Menschen, in diesem Fall: Johannes des Täufers, mit einer solchen Heilsgestalt, hier Elia, nicht absurd, sondern vorstellbar war – und womöglich hier und da auch vollzogen wurde.
Es ist zwar spekulativ, aber doch wohl möglich, dass Johannes sich tatsächlich mit dieser Elia-Gestalt identifiziert hat. Wenn das so wäre, könnte er auch mit der Figur einer solchen „Selbstidentifikation“ für Jesus „Vorbildcharakter“ gehabt haben (=> VII.).
Umkehr also forderte Johannes, denn der letzte Tag der Welt und der erste Tag des Herrn standen vor der Tür. Wer bei Gottes Kommen nicht reinen Herzens war, würde verworfen werden. Niemand könnte sich dann noch auf Gottes Bund mit Abraham berufen,
„denn ich sage euch: Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken!“ (Mt. 3,9)
Darum also der Ruf des Johannes zur Buße an jedermann, darum die Waschung im Jordanwasser – zur Reinheit der Menschen und damit zu ihrer Bereitung für das Gottesreich.
Was Johannes da tat, war nicht nur Marotte eines Sonderlings in zotteliger Kleidung, der sich von Heuschrecken und wildem Honig nährte, sondern er schuf damit eine „Bewegung“, die anwuchs, an Größe zunahm, bis es selbst dem zuständigen Kleinkönig Herodes Agrippa zu bedrohlich wurde, der hier Aufstand witterte: Er nahm Johannes gefangen und enthauptete ihn. Das war dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus immerhin eine seriöse Notiz wert.13
Dass nun Jesus zu Johannes kam, ist unbestritten. Dass er sich hat taufen lassen, gleichfalls, nur hat nachfolgenden Denkern und Theologen das zu schaffen gemacht, weil Jesus damit eingestanden hätte, sündhaft gewesen zu sein. Das war aber gegen die spätere Dogmatik, der zufolge der Mariensohn gefälligst sündlos zu sein hatte. Ob Jesus das interessiert hätte, ist fraglich. Wichtiger ist: Auch das Handeln des Johannes war nahe daran, „gegen die Dogmatik“ zu sein, diesmal der jüdischen, denn Sündenvergebung ereignete sich demnach durch Gott – und zwar im Tempel von Jerusalem, nicht im Wasser des Jordan. Zwar vergab nicht Johannes selbst die Sünden, sondern taufte nur auf die zukünftige Sündenvergebung durch Gott hin. Dennoch sprach Johannes mit seinem Tun dem Tempel seine wichtigste Funktion ab. In wessen Auftrag tat er das? Mit welcher Berechtigung? Also doch als der „Gottesbote“ Elia? Wir wissen es nicht. Aber auch in seiner kritischen Haltung zum Jerusalemer Tempel könnte Johannes Vorbild für Jesus gewesen sein.
Johannes, drohend, wütend, finster und unerbittlich das Ende ansagend – ein „Apokalyptiker“ aus dem Bilderbuch. Rief aber nicht auch Jesus zur Umkehr? Sagte nicht auch er das bevorstehende Ende an? Verband die beiden also womöglich vor allem – eben diese apokalyptische Gedanken- und Überzeugungswelt?
Die ältere exegetische Tradition will Jesus von aller Apokalyptik fernhalten,14 vor allem apokalyptische Hoheitstitel („Elia“, „Menschensohn“ etc.) seien, wenn sie eine Rolle spielten, „Werkstücke“ erst der nachösterlichen Gemeinde gewesen, die mit ihrer Hilfe Auftreten, Scheitern und Auferstehen des Christus sich zu deuten suchte. Sie hätten aber mit dem historischen Jesus nichts zu tun. Die Namen Ernst Käsemann (Käsemann 1954), Philipp Vielhauer (Vielhauer 1963), Günther Bornkamm (Bornkamm 1956) müssten hier mindestens genannt werden. Durchaus auch noch Helmut Merkel (Merkel 2022), dieser ist sich aber schon nicht mehr so sicher. Ich halte es für irrig, Jesus von der Apokalyptik „freizuhalten“. Schon seine zweifelsfreie Nähe zu dem nun unbestrittenen und wahrhaft grundsätzlichen „Apokalyptiker“ Johannes am Jordan zeigt, dass man Jesu „Apokalyptik-Ferne“ kaum aufrechterhalten kann. Und heute tut das wohl auch niemand mehr, so weit ich es habe sehen können.
Aber Jesus war nicht einfach die kleine Kopie des großen Täufers. Er hatte eigenes zu sagen. Den „Tag des Herren“, den Johannes erst nahen sah – Jesus vollzog ihn. Er sagte das Gottesreich an. Er lebte es. Und er war es. Nicht bald. Sondern: Jetzt.
Aber eben: Jesus kündete erst einmal nichts vom Paradies. Sondern sprach und handelte vom Gottesreich. Was ist das für ein Reich? Und vor allem – was ist das für ein Gott, der im Grunde die zentrale Stelle in Jesu Denken und Handeln besetzte? Den Versuch, das zu erhellen, unternimmt das folgende Kapitel.
10 Zu den hier gemachten wenigen Äußerungen über Gott => VI.
11 Angleichung an Gott gibt es schon bei Platon, wenn sich die Vernunft der Weltseele angleicht, vgl. Michael Bordt, Angleichung an Gott, in Horn 2009, S. 253 ff. und Roloff 1970. Aristoteles ist nicht weit davon entfernt: Der Mensch „macht sich unsterblich, indem er sich mit dem reinen Denken vermischt. Auf diese Weise wird er göttlich“, Aristoteles 2019c, X 7, 1178a. Zur „Vergottungslehre“ (Theosis) ausführlicher Nohr 2022, S. 202 ff.
1 Zu den Quellen und ihre Kritik => XIV. Anhang.
12 Der Text modifiziert somit das zweite der unten => IV.2. genannten sechs Apokalyptik-Kriterien: „Nur Gott kann Heil schaffen“ heißt es da, hier aber tritt ihm Elia zur Seite als eine „Heilsgestalt“, die „das Silber rein machen und die Leviten läutern wird“, gemeint ist eigentlich „lesen“, wie Erbsen „auslesen“, im Sinne vom Grimms Aschenputtel-Märchen: „die guten ins Töpfchen, die bösen ins Kröpfchen“.
13 Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae XVIII 5, 2, s. Clementz 1998. Wie es ohne „Kommunikationsmedien“, wie wir sie heute gewohnt sich, überhaupt zu derartigem wie einer „Bewegung“ kommen kann, ist schwer zu sagen. Die Quellen stellen es nur fest, begründen und beschreiben den Vorgang aber nicht. Dabei wäre die Frage zu lösen keineswegs belanglos, denn auch Jesus selbst hat ja eine Art „Bewegung“ geschaffen, die in Umfang und Größe womöglich über das hinaus ging, was man ihm vorurteilbelegt zubilligen wollte, das werden die Jerusalemer Ereignisse zeigen => VIII.
14 Koch 1996, S. 109 ff.
IV. Der Gott Jesu
Der jüdische Gott zur Zeit Jesu war als Schöpfer, Herr und König der Welt gedacht und vorgestellt. Er war ein Gott, der einen Willen hatte, der Bewegung zeigte, der sich sein Volk erwählt, die Juden nämlich, und ihm ein Gesetz gegeben hatte. Es war dies ein Gott nach Art einer Person gedacht – nur ungleich größer, mächtiger, erhabener und heiliger als alle menschlichen Personen. So im Übermaß heilig war dieser Gott, dass man das hebräische Tetragramm seines Namens nicht aussprach oder durch passive Formulierungen des Gemeinten vermied, das ist das „passivum divinum“, etwa nach der Weise „Es ist zu den Alten gesagt …“ (Mt. 5,21 ff.); das meint: Gott (hier müsste streng genommen das Namens-Tetragramm stehen) hat den Alten gesagt … Aber eben: Dieser „überheilige“ Gott hatte einen Namen, was den Personcharakter seines Trägers unterstreicht. Eine derartige Vorstellung von Gott nennt man: „Theismus“.
Ein solcher Theismus beherrscht zum Teil noch immer die religiöse Sprache der Christen. Wer hungrig zu den Kanzeln hochsieht, wird weiterhin mit „massivem“ Theismus gespeist. Es sei angedeutet, dass solcher Theismus aber höchst problematisch ist. Er fällt mit der Frage nach dem Bösen in der Welt dahin, der „Theodizee-Frage“. Es ist aber nicht notwendig, im Theismus zu verbleiben. Man kann auch nicht-theistisch von Gott reden.15
IV.1. Das Werden Gottes
Der Ursprung des israelischen Gottes liegt im Dunkel. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs könnten durchaus als Sippengötter der Nomadenzeit (um -1200) seine Vorgänger gewesen sein. Sie waren anfänglich wohl gar drei verschiedene Götter, die erst nachträglich zusammenwuchsen und genealogisiert wurden, als nämlich die Trägergruppen sich miteinander verbanden. Wahrscheinlich hat auch die „Ägyptengruppe“, die dann dazustieß, einen „eigenen“ Gott mitgebracht – einen recht wilden und barschen Berggott, der dann mit seinen





























