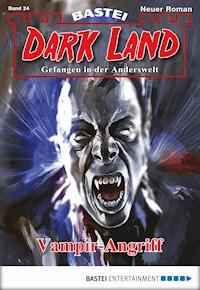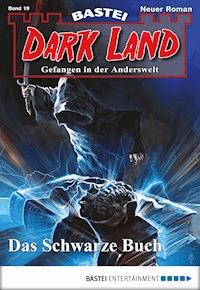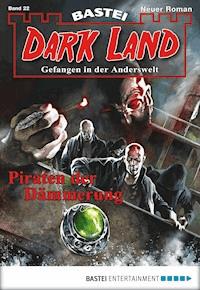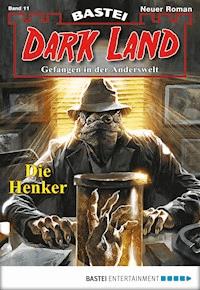1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Kein Mensch wusste von der Existenz der einsamen, mitten im Wald gelegenen Hütte. Sie lag versteckt an den Hängen eines abseits gelegenen Berges tief in den schottischen Highlands. Weder Straßen noch Wege oder Wanderpfade führten hier vorbei, und der nächste Ort lag über zwanzig Kilometer entfernt.
So ahnte niemand, dass der Bereich um den einfachen Holzbau eine tote Zone war. Die Tannen waren schon vor langer Zeit verdorrt, das Gras ebenso, und wenn ein Pflanzenkeim vom Wind in diese Gegend getrieben wurde, zerfiel er auf der Stelle zu Staub. Tiere, die die Highlands durchstreiften, hielten sich ganz automatisch von der Hütte fern, denn ihre Instinkte sagten ihnen, dass ihre Nähe nur den Tod brachte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Wir jagten den Totensauger
Briefe aus der Gruft
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Kiselev Andrey Valerevich; Matthew Storer/shutterstock
eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7517-0571-4
„Geisterjäger“, „John Sinclair“ und „Geisterjäger John Sinclair“ sind eingetragene Marken der Bastei Lübbe AG. Die dazugehörigen Logos unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Die Figur John Sinclair ist eine Schöpfung von Jason Dark.
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Wir jagten den Totensauger
von Rafael Marques
Kein Mensch wusste von der Existenz der einsamen Hütte mitten im Wald. Sie lag versteckt an den Hängen eines abseits gelegenen Berges tief in den schottischen Highlands. Weder Straßen noch Wege oder Wanderpfade führten hier vorbei, und der nächste Ort lag über zwanzig Kilometer entfernt.
So ahnte niemand, dass der Bereich um den einfachen Holzbau eine tote Zone war. Die Tannen waren schon vor langer Zeit verdorrt, das Gras ebenso, und wenn ein Pflanzenkeim vom Wind in diese Gegend getrieben wurde, zerfiel er auf der Stelle zu Staub. Tiere, die die Highlands durchstreiften, hielten sich ganz automatisch von der Hütte fern, denn ihre Instinkte sagten ihnen, dass ihre Nähe nur den Tod brachte …
Trotzdem war die Hütte nicht verlassen. Hin und wieder kam Leben in sie, wenn ihre einzige Bewohnerin den Weg zu ihr suchte. Sie war kein Mensch, sondern eine magische Gestalt. Eine besondere Frau, der man über die Jahrhunderte viele Namen gegeben hatte – Banshee, Hexe, Teufelin und noch zahlreiche andere.
Nur wenige kannten ihren wahren Namen. Ismelda war jemand, der seit für Menschen unglaublich langer Zeit in den Schatten der Geschichte existierte und versuchte, sie für ihre Zwecke zu manipulieren. Oder für die ihres Meisters, denn sie diente einem mächtigen Dämon, der in der Hierarchie der Hölle weit oben stand.
Nach längerer Zeit war sie wieder in die Hütte zurückgekehrt, um sich mit einer anderen, ebenfalls ganz besonderen Gestalt zu treffen. Sie hatte sie um Hilfe gebeten, und sie konnte diese auf keinen Fall ablehnen, selbst wenn sie das gewollt hätte. Deshalb zündete sie nach und nach die aufgestellten Kerzen an, deren Wachs ätherische, betörende Düfte verströmte. Sie verschleierten nicht nur die Sinne, sie sollten ihr auch dabei helfen, ihre speziellen Kräfte zu aktivieren.
Auf einem breiten Tisch lagen zehn Karten bereit. Es war ein magisches Kartenset, mit der sie ihrem alten Bekannten die Zukunft voraussagen sollte. Mit Hilfe der Kerzen würde ihr auch genau das gelingen, ebenso wie mit den seltsamen Zeichen, die die Wände der Hütte zierten. Es handelte sich um an Sammelsurium aus Symbolen, zusammengetragen aus Sprachen, die schon lange Zeit von der Menschheit vergessen worden waren. Zusätzlich loderten an allen vier Ecken des kleinen Gebäudes grüne Flammen, ein Erbe ihrer Heimat, dem Paradies der Druiden.
Aibon mit seinen unzähligen fantastischen, bizarren, teilweise urbösen und gefährlichen Wesen lag schon lange hinter ihr, aber die Magie dieses Landes trug sie immer bei sich. Und manchmal war sie ihr noch immer von Nutzen.
Eine Uhr besaß sie nicht, und doch spürte sie, dass das Treffen kurz bevorstand. Auch, weil sie mit ihren besonderen, geschärften Sinnen die Aura des Wesens wahrnahm, das sich langsam der Hütte näherte. Sie kannte es nur zu gut und wusste genau, woran sie bei ihm war.
Nicht weit von ihr entfernt nahm sie seltsame Geräusche wahr. Es waren Flügelschläge, die nicht von einem großen Tier stammten, sondern von demjenigen, den sie erwartete. Ismelda lächelte wissend, trat hinter den Tisch und strich mit ihren ausgestreckten Fingern über die Karten hinweg, die bei den leichten Berührungen zu flimmern begannen. Für kurze Zeit hoben sie sogar von der Platte ab, bis die Hexe sie wieder herunterdrückte. Obwohl sie als magische Gestalt keinen Sauerstoff mehr benötigte, atmete sie tief ein und aus und schloss die Augen, um sich noch einmal zu konzentrieren.
Leise Schritte erklangen, und im nächsten Moment wurde die Tür von mehreren harten Schlägen erschüttert. Das Wesen war also wirklich gekommen.
»Komm herein«, rief sie ihm zu.
Die Tür wurde aufgezogen. Im Ausschnitt erschien eine düstere Gestalt, ein Mann, der mit einem langen, dunklen Stoffmantel bekleidet war. Das Gesicht hatte eine besondere Schönheit, der man kaum widerstehen konnte, andererseits stieß es einen auch auf eine kaum erklärbare Weise ab. Und dann waren da noch die Augen, die keine Pupillen hatten. Stattdessen blickte Ismelda in eine konturenlose Schwärze, in der jedoch etwas aufblitzte, als sie den Blick des Mannes auf ihr lasten spürte.
Seine schwarzen, schulterlangen, wallenden Haare wehten leicht im Wind, bis der Mann die Tür mit einem kurzen Stoß zugleiten ließ. Er nickte ihr zu, griff in seinen Mantel und zog ein handtellergroßes Stoffsäckchen heraus. »Ein Geschenk«, drang es zwischen seinen nur leicht geöffneten Lippen hervor. »Ich dachte, du kannst es gebrauchen.«
Ismelda umrundete den Tisch, trat vor die Gestalt und streckte die Hand aus. Als sie den Stoff berührte, war ihr sofort klar, was sich darin befand. »Was ist es?«, fragte sie trotzdem.
»Ein Aibon-Kristall. Ich habe ihn einem Vampir abgenommen.«
»Einem Vampir?«
»Jean-Paul Vagnier. Der Sammler und Hexenmeister. Du erinnerst dich? Er hatte sehr ähnliche Kräfte wie du.«
»Ich weiß. Du hast ihn also getötet?«
»So wie viele andere zuvor. Vampire und Menschen, die mit einer bestimmten Person in Verbindung standen, von der du weißt, dass ich den Auftrag erhalten habe, sie zu töten. Die Schlinge zieht sich immer enger, aber ich komme einfach nicht direkt an sie heran. Deshalb bin ich hier. Ich will, dass du mir den Weg zu meinem Ziel zeigst.«
Ismelda nickte. »Ich weiß. Jeder sucht nach dem Punkt, zu dem ihn sein Schicksal führt.«
»Mein Schicksal ist noch nicht geschrieben, Ismelda.«
»Bist du dir da sicher?«
Die Hexe wandte dem Mann den Rücken zu, umrundete wieder den Tisch und baute sich hinter den zehn in einer Reihe liegenden Karten auf. »Dein Schicksal wartet bereits auf dich, Samartan. Ich habe mir die Karten noch nicht angesehen, das ist ohne dein Zutun auch gar nicht möglich, aber ich nehme ihre Signale wahr. Sie sagen mir, dass du vor einem entscheidenden Punkt in deiner Existenz stehst.«
»Meinst du, dass ich jetzt Angst haben sollte? Ich fürchte mich nicht vor der Zukunft, Ismelda. Wir beide existieren schon sehr lange und haben so viel er- und überlebt. Wir haben längst gelernt, dass wir unsterblich sind und das Schicksal lediglich an uns vorbeistreift, ohne uns zu berühren. Niemand kann uns stoppen, auch solche Menschen nicht, die sich in all den Jahren als Dämonenjäger bezeichnet haben. Und erst recht wird mich nicht unser gemeinsamer Freund besiegen können. Dazu ist er gar nicht stark genug.«
»Dann such dir deine Karten aus.«
Samartan trat vor und strich seinerseits über den Tisch hinweg. Wieder fuhren die Karten in die Höhe, sobald sie die Nähe des Mannes spürten. Kleine Blitze zuckten über ihre Oberflächen hinweg. Auf ihren Rücken zeichneten sich uralte Symbole ab, die jetzt leicht aufglühten und die vor ihr stehende Gestalt erfassten.
Nach einer Weile ließ Samartan seine Hand auf der dritten Karte von links ruhen. Er hob die Finger wieder an, und das aus festem Papier bestehende magische Artefakt schwebte mit ihnen in die Höhe.
Obwohl Ismelda nur die Rückseite sah, nahm sie wahr, was für eine Karte ihr Gast gezogen hatte. Es war die Sonne, die ihr Licht über eine halbnackte Frau mit dunkelblonden Haaren abstrahlte. Während die menschliche Gestalt unverändert blieb, dunkelte die Sonne ein, bis ihre Strahlen sich in blutrot geschuppte Schlangen verwandelten, die wild über die Karte hinweg züngelten.
»Eines deiner nächsten Opfer, Samartan«, erklärte Ismelda. »Und er, der über uns wacht.«
»Ich weiß. Das hilft mir nicht weiter.«
»Dann nimm die nächste Karte.«
Der Langhaarige verzog kurz die Lippen, bevor er, diesmal mit beiden Händen zugleich, über die Symbole hinwegstrich, bis er sich für die zweite Karte von rechts entschied. Oder vielmehr, bis sie sich für ihn entschied, denn das Schicksal hatte seine Wahl bereits vorherbestimmt.
Samartan zog seine Finger wieder zurück und sorgte so dafür, dass die Karte in die Höhe schwebte. Die Vorderseite zeigte Fortuna, die Schicksalsgöttin, mit ihrem randvollen Füllhorn. Wieder begann sich das Bild nach kurzer Zeit zu verändern. Die Umrisse Fortunas verzogen sich, wurden zu einem unförmigen Fleck und bildeten sich bald neu aus.
Aus der wunderschönen Frau wurde ein blonder Mann, der zudem kein Füllhorn, sondern ein silbernes Kreuz in der Hand hielt. Hinter den Umrissen des Mannes erschienen drei längliche Symbole, die zusammen die römische Zahl III bildeten. Dann veränderte sich das Bild noch ein zweites Mal. Auf der Karte erschien nun ein Abbild Samartans, der inmitten eines Meeres aus Flammen stand, die unaufhörlich auf ihn hereinprasselten, bis sein Körper Feuer fing, langsam verbrannte und zu Asche zerfiel.
Plötzlich verzerrte sich das Gesicht des Langhaarigen. Er fluchte und zischte etwas Unverständliches, bevor er nach der Karte griff und sie einfach zerriss. »Was soll das, Ismelda?«, fuhr er die Hexe an. »Was willst du mir damit sagen? Ich werde nicht sterben, niemals, und schon gar nicht durch die Hand dieses Mannes. Was habe ich mit ihm zu tun? Nichts! Er ahnt nicht einmal etwas davon, dass ich existiere. Wie sollte er mir dann auf die Spur kommen und mich vernichten? Das ist unmöglich.«
»Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Es ist das Schicksal, und wenn dir die Karte sagt, dass es so geschehen wird, dann habe ich keine Zweifel daran, dass es auch so kommen wird.«
»Dann werde ich in drei Tagen sterben.«
Ismelda hob die Schultern. »Für Wesen wie uns gibt es immer einen Ausweg, das weißt du. Der Tod ist vielleicht nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Aber nur, wenn du deine Konsequenzen aus dem ziehst, was die Karte dir gezeigt hat.«
»Und das heißt?«
»Sag du es mir.«
Samartan murmelte etwas vor sich hin und fuhr sich mit beiden Händen durch die langen Haare, bevor er sich wieder beruhigte und genauso stoisch vor ihr stand wie zuvor. »Gut, Ismelda. Du hast recht. Ich muss meine Konsequenzen ziehen, und das werde ich auch. Entschuldige, dass ich die Karte zerrissen habe. Ich hatte mir nur etwas völlig anderes erwartet – eben einen Hinweis auf denjenigen, den ich jage. Dass es jetzt um mein Leben geht, macht die Sache komplizierter, aber nicht aussichtslos. Ich muss jetzt gehen und entsprechende Vorbereitungen treffen. Wir sehen uns wieder, Ismelda. Das schwöre ich dir.«
»Da bin ich sicher, Samartan.«
Ohne ein weiteres Wort des Abschieds drehte sich ihr Gast herum, zog die Tür auf und verschwand aus ihrem Blickfeld. Wieder erklangen merkwürdige Geräusche, und bald hörte sie, wie sich etwas mit großen Flügeln in die Lüfte erhob. Sie dagegen blieb einfach stehen und beobachtete, wie die Reste der Schicksalskarte in die Höhe schwebten und sich wieder zusammensetzten, bevor sie sich auf dem Tisch niederließ.
Das Treffen war vorbei, weshalb es keinen Grund für sie gab, noch länger an diesem Ort zu bleiben. Zunächst brachen die vier Flammen zusammen, dann lösten sich die zehn Karten auf, und schließlich verwandelte sich die Hexe in einen Feuervogel, der blitzschnell durch die Tür und in den Totenwald hineinjagte. Auf den Ästen der abgestorbenen Bäume warteten ihre Raben und begannen, ihr hinterher zu flattern …
☆
Zwei Tage später
Der Schrei zerstörte die morgendliche Stille in dem so friedlichen Park um die altehrwürdige St. Luke’s & Christ Church. Eine Frau rief verzweifelt um Hilfe, bis ihre Stimme schlagartig wieder verstummte und sich eine geradezu drückende Stille über das Areal legte.
Die beiden Polizisten, die am Rand des Parks standen und eigentlich nur einmal durchatmen wollten, ließen es nicht darauf beruhen. Sergeant Dwight Cole und seine junge Kollegin Constable Jessica Libby liefen so schnell sie konnten in die Richtung, aus der der Schrei aufgeklungen war.
Innerlich verfluchte der zweiundvierzigjährige Beamte sein Schicksal. Als wären die letzten Wochen privat nicht schon hart genug gewesen, ließ ihm der Job keine Atempause. Seine Frau Tiffany wollte sich von ihm scheiden lassen, weil er einfach keine Zeit für sie fand. Und obwohl er ihr immer wieder klarzumachen versuchte, dass es nun einmal seine Aufgabe war, rund um die Uhr für die Menschen in London da zu sein, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er einen Brief ihres Anwalts in seinem Briefkasten fand. Ausgezogen war sie schon vor einer Woche.
Seitdem glaubte er, wirklich nur noch für die Arbeit zu leben. Eigentlich wäre seine Schicht schon vor zwei Stunden vorbei gewesen, doch ein Notruf aus dem Royal Brompton Hospital und die Tatsache, dass viele seiner Kollegen krank waren, hatte ihm bei all seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Streit zwischen zwei Patienten war glücklicherweise geschlichtet, nur waren sie jetzt, wo sie nur einmal kurz ausspannen wollten, wahrlich vom Regen in die Traufe geraten.
Der Park um die Kirche war relativ klein und bestand lediglich aus einigen Laubbäumen und kleineren Büschen. Viele Möglichkeiten, sich vor ihnen zu verstecken, gab es nicht, deshalb wunderte es Dwight schon, dass sie die Quelle des Schreis noch nicht ausgemacht hatten.
»Da vorne, an der Kirche!«, rief ihm seine Partnerin zu und wies in Richtung der steinernen Mauern.
Nicht weit von einer Seitentür entfernt schlichen zwei Männer mit südländischem Teint entlang, die etwas mit sich zu schleifen schienen – oder vielmehr jemanden. Eine Frau mit hellbraunen Haaren, einer kurzen Lederjacke, Jeans und weißen Turnschuhen. Wie eine Puppe hing sie in den Armen der Männer. Der Größere der beiden trug ein dunkles Hemd, Jeans und schwarze Stiefel, der Kleinere eine ausgefranste Lederjacke.
Dwight wollte etwas rufen, als er die Zeichnung an der Tür entdeckte. Es handelte sich um ein auf dem Kopf stehendes, rotes Kreuz. Direkt darüber war ein auf der Spitze stehendes Dreieck in das Holz geritzt worden.
Bei dem Sergeant klingelten alle Alarmglocken, und als er sich die Männer, denen sie noch nicht aufgefallen waren, genau ansah, erkannte er sie von den Phantombildern wieder. Es konnte gar nicht anders sein – sie hatten Ramon und Sergio Torres, die beiden Satanisten, die gemeinsam mit ihrer Schwester seit einer Woche London in Angst und Schrecken versetzten, bei dem Versuch ertappt, sich ein siebtes Opfer zu holen.
Er wechselte mit seiner Partnerin einen kurzen Blick, die genau zu wissen schien, was er dachte. Sie nickten sich zu und zogen gemeinsam ihre Waffen.
»Stehen bleiben, Polizei!«, riefen sie zeitgleich.
Die beiden Brüder zuckten zusammen, wobei der Kleinere der beiden, der durch einen dichten Vollbart auffiel und bei dem es sich wohl um Sergio Torres handelte, im Stand herumwirbelte.
Dwight fluchte, als er die Pistole in der Hand des Mannes sah, und drückte ab.
Auch Jessi schoss, ebenso wie Sergio Torres. Ihre Kugeln verfehlten ihn knapp und prallten als Querschläger von den Mauern der Kirche ab, zugleich gingen Dwight und seine Partnerin in Deckung, indem sie sich zu Boden warfen.
Torres rief seinem Bruder etwas auf Spanisch zu, dann packte Ramon die leblose Frau, während der kleinere der beiden Männer weiter in ihre Richtung schoss. Auch Dwight feuerte weiter – und traf. Eine seiner Kugeln streifte den rechten Unterschenkel des Satanisten, der laut fluchte und humpelnd seine Flucht fortsetzte.
Als sie die rechte, vordere Ecke des Gotteshauses erreichten, war das Magazin des Schützen leer. Bevor Dwight oder seine Partnerin jedoch auf ihn anlegen konnten, waren die Brüder aus ihrem Blickfeld verschwunden.
»Gib eine Meldung an die Zentrale und hol den Wagen«, zischte Dwight seiner Partnerin zu.
»Und du? Willst du den Helden spielen?«
»Und wenn? Tu es einfach, verdammt!«
»Arschloch.«
Dwight ignorierte Jessis Wut, richtete sich auf und rannte in Richtung Kirche. Er hoffte inständig, dass sich niemand in dem Gotteshaus oder der näheren Umgebung aufhielt und von den Schüssen angelockt wurde. Diese Torres-Geschwister waren extrem gefährlich und unberechenbar, und eigentlich war Jessi und Dwight eingeschärft worden, im Ernstfall den Leuten von Scotland Yard die Fahndung nach den Satanisten zu überlassen. Doch der Yard war weit weg, und der Sergeant konnte die junge Frau nicht einfach diesen Verrückten überlassen.
Vor der Kirche befand sich ein Parkplatz, auf dem ein einziges Auto stand. Der Motor des Toyota heulte auf, während Sergio Torres die Frau auf den Rücksitz schleuderte und die Tür hinter ihr ins Schloss rammte. Als er gerade die Beifahrertür aufriss, eröffnete Dwight wieder das Feuer.
Er war kein besonders guter Schütze, das wusste er selbst, und im Laufen war es gleich doppelt schwer, einen gezielten Schuss abzugeben. Eine seiner Kugeln schlug in den unteren Bereich der Karosserie, zwei weitere gingen fehl.
Der Spanier fluchte, warf sich aber trotzdem ins Auto. Sein Bruder trat aufs Gas und sorgte dafür, dass der Wagen einfach direkt über die Wiese jagte.
Dwight rannte zunächst weiter, bis er schlagartig stehen blieb, die Waffe in beide Hände nahm und noch einmal versuchte, genau zu zielen. Dann drückte er drei Mal ab, und diesmal traf er. Die Geschosse schlugen in den rechten Hinterreifen des Toyota und zerfetzten ihn. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und raste weiter über die Wiese hinweg, bis er quer zur Fahrtrichtung auf die Cale Street geriet.
Ein lautes Hupen schallte durch die ruhige Straße, bevor ein grauer Van gegen die rechte Front des Toyota prallte und sich quer stellte. Das Fluchtfahrzeug der Torres-Brüder rollte noch einige Meter weiter und krachte in einen geparkten Smart.
Das Herz des Sergeants pumpte wie wild, während er über die Wiese hetzte. Die Türen des Toyota wurden von innen aufgestoßen, und diesmal richtete nicht nur Sergio seine Waffe auf ihn, sondern auch sein Bruder Ramon.
Dwight fluchte, schoss aber dennoch. Die Scheibe der Beifahrertür zersprang, und er war sich sicher, auch Sergio Torres ein weiteres Mal erwischt zu haben, bevor er sich zur Seite warf.
Die Kugeln der Satanisten schlugen in den Boden oder fegten über ihn hinweg. Er versuchte, irgendwie in das höhere Gras zu kriechen und sah dabei, wie Ramon die junge Frau aus dem Fond des Wagens zerrte. Zugleich stieß der Fahrer des Vans die Tür auf. Darauf schien Sergio Torres nur gewartet zu haben. Er nahm die Tür selbst in die Hand, zog sie noch weiter auf, packte den Fahrer und riss ihn aus dem Inneren seines Fahrzeugs.
Als der völlig überraschte Mann sich wieder aufrichtete, wurde er von einem harten Schlag niedergestreckt. Blut spritzte aus seinem Mund, währende der etwa sechzig Jahre alte Fahrer zusammensackte.