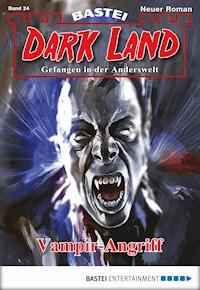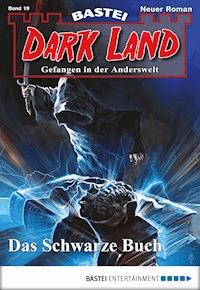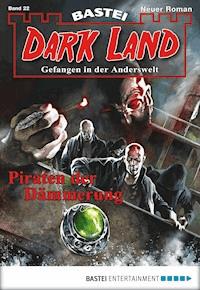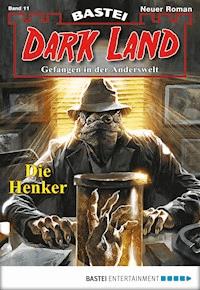1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Die junge Frau kannte nur noch einen Gedanken: Flucht!
Flucht vor dem Grauen und dem Tod, denn der wartete auf sie, wenn sie jetzt aufgab. Die düsteren Gestalten, die ihr hinterherjagten, würden keine Gnade kennen und genauso über sie herfallen, wie sie es bei einer ihrer Fluchtgefährtinnen gesehen hatte.
Was genau mit ihr geschehen war, wusste sie nicht, aber ihre grauenvollen Schreie hallten jetzt noch in ihrem Kopf nach ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Das Vampir-Amulett
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Das Vampir-Amulett
von Rafael Marques
Die junge Frau kannte nur noch einen Gedanken: Flucht!
Flucht vor dem Grauen und dem Tod, denn der wartete auf sie, wenn sie jetzt aufgab. Die düsteren Gestalten, die ihr hinterherjagten, würden keine Gnade kennen und genauso über sie herfallen, wie sie es bei einer ihrer Fluchtgefährtinnen gesehen hatte.
Was genau mit ihr geschehen war, wusste sie nicht, aber ihre grauenvollen Schreie hallten jetzt noch in ihrem Kopf nach ...
Sie hörte sie, wie sie auf sie lauerten. Innerhalb des Mondscheins krochen die Nebelschwaden zwischen dem endlosen Tannenmeer dahin. Die graue Masse verschluckte jedoch nicht die Geräusche der in ihr lauernden Gestalten. Mal erklang das Trappeln von Hufen, dann wieder das Wiehern eines Pferdes, gefolgt von dem höhnischen Lachen ihrer Peiniger.
Einmal hatte sie sie schon gesehen. Menschen waren das nicht, davon war sie überzeugt. Eher ganz in schwarz gekleidete Geschöpfe der Finsternis, die wie der personifizierte Tod ihre Sensen schwangen und nur darauf zu warten schienen, ihre Klingen in ihr warmes Fleisch zu treiben.
»Komm, weiter!«, feuerte Annelene Maier ihre Begleiterin an, die hechelnd am Stamm einer alten Tanne lehnte.
Auch wenn sie am Ende ihrer Kräfte war, aufgeben konnte und wollte sie nicht. Denn wenn sie das tat, war sie so gut wie tot.
Die viel jünger als sie wirkende blonde Jessica, deren Nachnamen sie nicht einmal kannte, ließ sich einfach von ihr mitziehen. Es war offensichtlich, dass sie nicht einmal annähernd ihre Kondition hatte, andererseits wollte sie sie auf keinen Fall zurücklassen. Nicht nach dem, was mit der anderen Frau geschehen war ...
»Ich kann nicht ...«, begann ihre Gefährtin, brach aber schnell ab, weil Annelene sie einfach mit sich riss.
Der Wald, der wolkenverhangene Himmel, der Nebel, das hin und wieder aufblitzende Mondlicht – alles kam ihr wie ein Albtraum vor, und vielleicht war es auch genau das. Zumindest hoffte sie es, denn was hier mit ihr geschah, war zu irreal, als dass es wahr sein konnte. Und doch, sie atmete, spürte die kleinen Risse an ihren nackten Füßen und Armen und ihr Herz, wie es bis zum Anschlag pochte.
Trotzdem, sie würde niemals aufgeben, so wie in ihrem ganzen bisherigen Leben nicht. Mit 13 war sie von zu Hause weggelaufen, nachdem ihr Vater ihre Stiefmutter zum wiederholten Male verprügelt hatte. Seitdem lebte sie quasi auf eigene Rechnung, mal hier, mal dort, wobei sie sich nicht darüber Gedanken zu machen versuchte, dass es so wie in den letzten sechs Jahren nicht den Rest ihres Lebens weitergehen konnte.
Da war ihrTheo, der Vermittler, gerade recht gekommen. Er wollte ihr dabei helfen, weg von den Drogen und der Straße und in einen normalen Job zu kommen. Theo war in der Szene bekannt – ein engagierter Streetworker, dem man den ehemaligen Polizisten einfach ansah. Dass er selbst Drogen verkaufte, um Annelene und anderen näher zu kommen, passte da jedoch nicht so ganz ins Bild.
Sie hätte eigentlich längst Verdacht schöpfen sollen, als er sich mit ihr in einer leer stehenden Lagerhalle treffen wollte, um ihr eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie in ein geordnetes Leben zurückkehren konnte. Es war eine Falle gewesen, und die beiden ganz in schwarz gekleideten Typen, die statt Theo dort aufgetaucht waren, hatten ihr keine Chance gelassen. Irgendwann war sie ohnmächtig geworden und erst in dem tiefen, dunklen Wald erwacht, unweit der düsteren Mauern eines alten Schlosses.
Dann hatte sie sie gesehen. Zwei Männer, maskiert und mit Sensen bewaffnet, dazu gekleidet in dunkle Anzüge und auf schwarzen Pferden sitzend. Ein dritter, ein junger, bleicher und irgendwie attraktiv wirkender Mann, war ihr mit einem Gewehr in der Hand entgegengetreten. In seinen Augen hatte etwas Lauerndes gelegen, ebenso eine unbändige Gier, und es hätte sie nicht überrascht, zu erfahren, dass er sich auf ihre dritte Fluchtgefährtin nicht nur gestürzt hatte, um sie zu töten.
»Dreißig Sekunden, mehr gebe ich euch nicht«, hallten noch einmal seine Worte durch Annelenes Kopf, während sie über eine querliegende Fichte sprang. »Das ist eure Chance, uns zu entkommen. Wenn ihr sie nicht weise nutzt, seid ihr dem Tode geweiht. Aber vielleicht seid ihr das auch so ...«
Mit einem Schuss hatte er die Menschenjagd eröffnet, denn um nichts anderes handelte es sich bei dieser mörderischen, gnadenlosen Hatz. Wahrscheinlich waren sie nicht die ersten gewesen, die in dieses Spiel der drei Männer geraten waren. In den endlosen Wäldern des Taunus fiel es kaum auf, wenn junge Frauen mitten in der Nacht von düsteren Gestalten gehetzt wurden. Und noch weniger, wenn ein paar Obdachlose, Junkies und Umherziehende im Frankfurter Bahnhofsviertel verschwanden.
Annelene und den anderen beiden Mädchen war kaum Zeit geblieben, zu erfassen, was hier eigentlich geschah. Selbst jetzt fiel es ihr schwer, aber sie wollte leben, und dieser Gedanke allein sorgte dafür, dass sie sich irgendwie zusammenriss. Sie musste ihr Leben so teuer wie möglich verkaufen, und wenn ihr das gelang, gab es vielleicht noch eine Möglichkeit, diesem Albtraum zu entkommen.
»Anne, bitte, lass mich los!«
Beinahe wütend fuhr sie herum und blieb stehen, sodass Jessica gegen sie prallte und sie gegen einen Stamm taumelte. »Willst du sterben?«, entgegnete sie. »Ich nicht, und ich will dich auch nicht zurücklassen, so wie ...«
»Verdammt, ich kann nicht mehr. Ich bin nicht so schnell wie du. Außerdem höre ich sie nicht mehr.«
Annelene wollte etwas erwidern, begann aber stattdessen zu lauschen. Es war tatsächlich totenstill um sie herum. Das Hufgetrappel war verklungen, ebenso das höhnische Anfeuern ihrer Verfolger.
Hatten sie aufgegeben oder wollten sie Jessica und sie nur in Sicherheit wiegen? Annelene tippte eher auf Letzteres. Sie kannte das Gesicht ihres Entführers und des jungen Mannes mit dem Gewehr, da würde man sie wohl kaum gehen lassen. Nein, diese Typen hatten längst ihr Todesurteil unterschrieben, davon war sie überzeugt.
»Siehst du?«, fragte Jessica. »Es ist vorbei. Sie lassen uns in Ruhe.«
»Das glaubst du doch selbst nicht. Wir kennen ihre Gesichter.«
»Ich nicht«, erwiderte Jessica, erst leise, dann noch einmal lauter. »Hört ihr? Ich habe nichts gesehen! Okay?«
Annelene schüttelte nur den Kopf. Sie wusste, dass sie weiterlaufen musste, und trotzdem blieb sie stehen und sah sich um. Durch die Wolken gelang es dem grellen Mondlicht nur selten, die Finsternis zu durchdringen. Sie befanden sich in einem etwas lichteren Teil des Tannenwaldes, nicht weit von einem Bereich mit zahlreichen querliegenden Stämmen. Hinzu kamen die dünnen Nebelschwaden, die über sie hinwegtrieben. Kein guter Ort, um einfach stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass etwas geschah.
»Wir müssen hier weg, Jessie«, versuchte sie es noch einmal. »Sie werden uns weiter jagen.«
Jessica schüttelte energisch den Kopf. Das Mädchen mit den langen, blonden Haaren blieb stur. »Dich vielleicht«, erwiderte sie. »Außerdem kann es dir doch egal sein, was aus mir wird. Bisher war das jedem scheißegal, und jetzt meinst du, mich retten zu müssen. Ich ...«
»Sei still!«
Jessica zuckte zusammen und blieb tatsächlich stumm. Sie sah sie erst wütend, dann angsterfüllt an. Noch zeigte sich keiner ihrer Verfolger, dafür schien der Nebel noch einmal dichter zu werden, während er über die querliegenden Stämme kroch und ein eisiges Gefühl auf ihrer Haut hinterließ.
Zugleich drang ein leises, böses Lachen an ihre Ohren. Die Gestalten mit den Sensen hielten sich zwar zurück, doch aufgegeben hatten sie nicht. Sie lauerten irgendwo in den finstersten Winkeln des Waldes, und sie taten nichts mehr, um ihren Häschern zu entkommen.
»Annelene ...«
Die Angesprochene schüttelte nur den Kopf. Sie hatten ihre letzte Chance verspielt, das spürte sie genau. Wären sie weitergelaufen, hätte es noch anders ausgehen können, aber so war ihren Verfolgern Zeit genug geblieben, sie einzukreisen. Jetzt schienen sie nur noch auf einen besonders günstigen Moment zu lauern, um über sie herzufallen.
Der Angriff erfolgte wie aus dem Nichts, und irgendwie war Annelene nicht einmal wirklich überrascht. Ein gewaltiger Schatten jagte über die Stämme hinweg und verformte sich innerhalb von Sekundenbruchteilen in ein Pferd mit einem düsteren Reiter, der seine Sense in einem weiten Bogen schwang.
Annelene sprang noch zur Seite und bemerkte schnell, dass die Attacke nicht ihr galt, sondern Jessica. Ihre Gefährtin reagierte viel zu langsam, und als das Sensenblatt sie zwischen Brust und Hüfte traf, war es mit ihrer Flucht endgültig vorbei. Jessica stieß einen entsetzlichen Schrei aus, während ihr Blut durch die Luft wirbelte. Wie vom Blitz getroffen brach sie zusammen und blieb wimmernd liegen.
Was dann geschah, konnte Annelene kaum begreifen. Der zweite Reiter tauchte nun ebenfalls aus dem Nebel auf, sprang vom Rücken seines Pferdes und näherte sich gemeinsam mit seinem Kumpan der am Boden liegenden Jessica.
Stumm und geschockt verfolgte sie mit, wie die Gestalten auf die blonde Frau zu huschten, sie an den Schultern packten und in die Höhe rissen. Sie hörte Laute, die sie nicht einordnen konnte, die aber irgendwie animalisch klangen. Dann zuckten die Köpfe der Fremden vor, und es schien, dass sich ihre Zähne zugleich in den Hals der Verletzten gruben. Jessicas Wimmern verklang, dafür starrte sie sie mit einem entsetzten Ausdruck an, der sich Annelene förmlich ins Gehirn brannte.
»Weg«, flüsterte sie vor sich hin. »Lauf weg! Jetzt!«
Sie konnte einfach nicht mehr hinsehen, obwohl das Schauspiel trotz allem eine grausige Faszination bot. Irgendwie gelang es ihr, sich wieder zusammenzureißen und loszulaufen. In diesem Moment hallte ein Schuss durch die Nacht. Annelene zuckte zusammen und schrie auf, als sich ein Geschoss direkt neben ihr in den Stamm einer Fichte bohrte.
Jetzt wusste sie, dass auch der junge Mann mit dem Gewehr in der Nähe lauerte. Ob er absichtlich danebengeschossen hatte, um ihr noch einige Sekunden Hoffnung zu geben, wusste sie nicht. Sie nahm den Schuss einfach hin und rannte wieder los, tiefer in den Wald hinein.
Schon bald gaben ihre Knie nach. Nicht allein wegen der Anstrengung, sondern auch wegen der Gedanken an das, was mit Jessica geschehen war und ihr wohl auch bald blühen würde. Ein Schuss war da noch das Gnädigste, was sie erwarten durfte.
Wieder erklang ein Schuss. Der Knall zerriss ihre Gedanken, aber wo die Kugel einschlug, wusste sie nicht. Getroffen war sie jedenfalls nicht, und das sah sie zumindest als kleinen Erfolg an.
Immer wieder gaben ihre Beine nach, sodass sie mehr durch den Wald taumelte, als wirklich zu laufen. Nicht zum ersten Mal prallte sie dabei gegen einen Baum, stieß sich wieder ab und versuchte, irgendwie den nächsten Stamm zu erreichen. Lange würde das nicht mehr gut gehen, das wusste wie, aber was blieb ihr anderes übrig?
Plötzlich änderte sich vor ihr radikal die Szenerie. Es war nicht das Mondlicht, das eine Öffnung in dem dichten Wolkenband fand, sondern zwei Scheinwerfer, die wie grelle Explosionen den Wald in ein völlig anderes Licht tauchten.
Erst glaubte sie an einen vierten Verfolger, bis sie einen überraschten Schrei hörte und ihr klar wurde, dass der Mann in dem mitten im Wald stehenden Auto wohl überhaupt nichts davon ahnte, was sich in seiner unmittelbaren Umgebung abspielte.
In diesem Moment fiel ihr auf, dass sie über einen ausgefahrenen Waldweg lief. Was der Fremde in seinem Wagen mitten in der Nacht hier zu suchen hatte, war ihr zunächst einmal egal. Sie holte noch einmal alles aus sich heraus, um irgendwie den Wagen zu erreichen, und schließlich gelang es ihr auch.
Erneut krachte ein Schuss, und diesmal bohrte sich die Kugel in die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, bei dem es sich augenscheinlich um einen VW Polo handelte. Annelene riss trotzdem die Seitentür auf und warf sich hechelnd auf den Beifahrersitz.
»Was ist denn hier los?«, fragte sie eine junge Männerstimme. »Wer sind Sie? Was ...«
»Fahr!«
»Hat da einer geschossen? Verdammt, ich wollte doch nur etwas allein sein und ...«
»Fahr schon, verdammt!«
Annelene sah, wie sich die Gestalt des bleichen Mannes mit dem weißen Hemd und dem langen, dunklen Mantel im Licht des Scheinwerferpaars hervorschälte. Sein Gesichtsausdruck blieb eiskalt, während er sein Gewehr durchlud und erneut auf sie anlegte.
Endlich riss sich der Mann hinter dem Steuer zusammen. Dass er dunkle, kurze Haare hatte und sicher kaum älter war als sie selbst, nahm sie nur am Rande wahr. Das Krachen des Schusses ging im Heulen des Motors unter, und hätte sich der Fahrer nicht instinktiv geduckt, wäre die Kugel nicht in die Rückenlehne, sondern in seinen Kopf gedrungen.
»Scheiße«, fluchte er, riss das Lenkrad herum und sorgte so dafür, dass sich sein Wagen auf dem schmalen Waldweg um 180 Grad drehte. Dass der Polo dabei einen Baumstamm streifte, spielte kaum eine Rolle.
»Gib Gas!«, feuerte Annelene ihn noch einmal an.
»Ja!«, schrie der Mann ihr zu und drückte das Gaspedal herunter. Der Wagen machte einen Satz nach vorne und raste über die trockene Erde hinweg, bis das Scheinwerferlicht nach wenigen Sekunden den Asphalt einer Landstraße erfasste.
Was sie sah, als sie noch einmal zurückblickte, erschien ihr jetzt wie ein Zerrbild aus einer Albtraumwelt. Die beiden düsteren Reiter mit ihren Sensen waren zurückgekehrt und galoppierten direkt auf sie zu. Doch gegen die Geschwindigkeit eines Autos hatten auch sie keine Chance. Der Fahrer riss sich erneut zusammen, lenkte seinen Wagen auf die Landstraße und jagte in die Dunkelheit hinein. Schon bald war von ihren Verfolgern nichts zu sehen.
»Oh Mann, oh Mann«, murmelte ihr Retter, dem sie fassungslos auf die Schulter schlug. »Dabei wollte ich nur mal einen Nachtspaziergang machen. Und dann so was ...«
»Du hast mir das Leben gerettet.«
Der junge Mann sah sie kopfschüttelnd an, musste sich dann aber wieder auf die Fahrt konzentrieren. »Verrätst du mir auch, was das gerade war?«
Annelene seufzte und sank in ihrem Sitz zusammen. »Wenn ich das nur selbst wüsste ...«
✰
»Ich hasse es!«
»Wieso? Ist doch nichts dabei.«
Olaf lachte. »Ist das dein Ernst? Für mich ist das der blanke Horror. Sonst sage ich ja nichts gegen einen Job. Ich meine, Leute zusammenschlagen, Schulden eintreiben und meinetwegen auch ein Haus anzünden, damit kann ich leben, aber eine Leiche ausgraben – da hört es bei mir auf.«
»Ach, das ist nur Müll«, erwiderte Ferdinand Will, der von allen nur Freddy genannt wurde. »Seelenlose Biomasse.«
Olaf Merschel schüttelte den Kopf. »Dir ist schon klar, dass uns das auch mal bevorsteht? Allein bei der Vorstellung, einmal so zu enden, läuft es mir kalt den Rücken herunter.«
»Warum hast du den Job dann angenommen?«
»Aus demselben Grund wie immer – Geldmangel.«
»Dann beschwer dich nicht.«
Olaf seufzte, setzte aber seine Arbeit fort. So tief er konnte trieb er das Schaufelblatt in den trockenen Untergrund, winkelte es an und schippte die Erde auf den Haufen neben ihm. Sein Partner tat es ihm gleich, weshalb sie quasi schon fast an ihrem Ziel angelangt waren – dem Sarg.
Er mochte keine vermoderten Leichen, und noch weniger vertrug er es, mitten in der Nacht auf einen Totenacker zu gehen, um dort ungesehen einen Toten auszugraben. Dass er schon einige Geschichten über diesen Ort gehört hatte, verschwieg er Freddy. Sein Partner würde ihn nur auslachen, wenn er von irgendwelchen Hexengeistern berichtete, die hier einmal umgegangen sein und Kinder entführt haben sollten. Zumindest hatte ihm das ein ehemaliger Polizist mal berichtet, und selbst wenn es nicht stimmte, sorgte die Geschichte dafür, dass er sich hier noch unwohler fühlte.
Um diese Uhrzeit war der Kölner Melaten-Friedhof glücklicherweise menschenleer. Tagsüber sah das ganz anders aus. Längst war die riesige, parkähnliche Anlage nicht nur von Einheimischen als Ort der Ruhe und Erholung entdeckt worden, sondern auch von der Tourismusbranche. Tagsüber spazierten tausende Besucher an den endlosen Grabreihen vorbei, da wäre eine Aktion wie diese natürlich völlig unmöglich gewesen.
Hin und wieder zogen Eulen oder Fledermäuse über den wolkenverhangenen Himmel ihre Bahnen, während dünne, graue Nebelschleier über den Boden trieben. Dem nicht ganz vollen Mond gelang es nur selten, sein Licht bis auf die Erde dringen zu lassen, sodass der Friedhof meist in Düsternis gehüllt war. Lediglich eine abgelegte Taschenlampe erleuchtete die friedlich daliegende Gräberstätte.
Das Grab, an dem Freddy und er standen, befand sich im Schatten einer der alten, monumentalen Familiengruften, die den Melaten-Friedhof so auszeichneten. Wer hier wirklich begraben lag, war anhand des völlig verwitterten und teilweise überwachsenen Grabsteins nicht mehr auszumachen. Ohne die genaue Beschreibung ihres Auftraggebers, der außerhalb des Friedhofs im Wagen wartete, hätten sie das Grab wahrscheinlich übersehen.
Irgendwie war ihm die Sache von Anfang an nicht geheuer gewesen. Freddy und er waren in gewissen Kreisen bekannt dafür, keinen Auftrag – selbst wenn es sich um die größte Drecksarbeit handelte – abzulehnen. Da sie beide hochgewachsen und durchtrainiert waren und zudem mit Messern und Pistolen umzugehen wussten, machte ihnen dabei so leicht keiner etwas vor. Einmal hatte er sogar einem Typen das beste Stück abschneiden sollen, aber eine Leiche auszugraben und von Köln in den Taunus zu transportieren, das war mal etwas Neues.
Wieder rammte er die Schaufel tief ins Erdreich hinein, und diesmal traf er auf Widerstand. »Endlich«, rief er seinem Partner leise zu.
Freddy, der seinen Spitznamen vor allem seiner Vorliebe für rot-schwarze Streifenpullis verdankte, stieß einen lauten Pfiff aus und schleuderte die Zigarette weg, die bisher zwischen seinen Lippen geklemmt hatte. »Dann geht es jetzt ans Eingemachte.«
»Wenn wir wenigstens nur den Sarg ausgraben müssten ...«, murmelte Olaf.
»Was habe ich über deine Beschwerden gesagt?«
»Ach, vergiss es ...«
Olaf konnte trotzdem an nichts anderes denken, als daran, dass sie den Sarg öffnen mussten. Ihr Auftraggeber, ein zwielichtiger Privatdetektiv aus den Staaten, verlangte, dass sie den Toten in einen Plastiksarg hievten, statt einfach die hier vergrabene Totenkiste mitzunehmen. Warum, war ihm bisher ein Rätsel geblieben, und seine innere Stimme sagte ihm, dass er das auch gar nicht wissen wollte.
Gemeinsam schippten sie die letzten Erdbrocken zur Seite, bis der Deckel komplett freigelegt war. An beiden Seiten befanden sich eiserne Griffe, die wohl für die Sargträger gedacht waren. Zudem waren an diesen Griffen auch zwei verrostete Vorhängeschlösser angebracht, deren Funktion ihm ein Rätsel waren.
»Als ob man verhindern wollte, dass jemand den Sarg öffnet ...«, murmelte Olaf und schüttelte den Kopf. »Oder sich daraus befreit.«
Sein Partner lachte. »Ach, so ein Quatsch.«
Olaf sagte nichts mehr und griff stattdessen nach seinem Rucksack, in dem auch ein Brecheisen steckte. So verrostet, wie die Schlösser waren, würde es ihn keine Mühe kosten, sie zu knacken.
Er nahm das eiserne Werkzeug, das ihm in der Vergangenheit schon viele gute Dienste erwiesen hatte, in beide Hände und trat wieder an den Sarg zurück. Wortlos holte er aus und ließ das Brecheisen auf das linke Schloss niedersausen. Ein leises Knacken erklang, dann brach es auseinander. Noch einmal schlug er zu, diesmal auf der rechten Seite. Wieder genügte ein gezielter Hieb, um das Schloss zu zerschmettern.
Noch einmal atmete er tief durch, dann setzte er die Spitze des Brecheisens an den Rand des Deckels an. »Es hilft ja nichts, ziehen wir es durch«, flüsterte er, wobei er sein Werkzeug anwinkelte. Das alte Holz knirschte laut, kurz darauf zersplitterte es. Jetzt musste er den pechschwarzen Deckel nur noch zur Seite wuchten.
Sein Herz schlug automatisch schneller, als sich der Sarg endgültig öffnete. Noch sah er nicht die Leiche, sondern nur die Innenseite des Deckels, aber allein schon dieser Anblick ließ ihm einen Schauer über den Rücken rinnen. Das beige Polster war nicht einfach nur zerstört, es war mit irrsinniger Kraft zerkratzt worden, sodass sich sogar Spuren auf dem blanken Holz abzeichneten.
»Scheiße«, hörte er Freddy rufen, und im nächsten Augenblick sah er, was seinen Partner so aufregte.
Die Hände des Leichnams, der zwar vollkommen ausgetrocknet, aber nicht zerfallen war, waren derart angewinkelt, dass es dafür nur eine Erklärung gab.
Der Tote war lebendig begraben worden!
✰