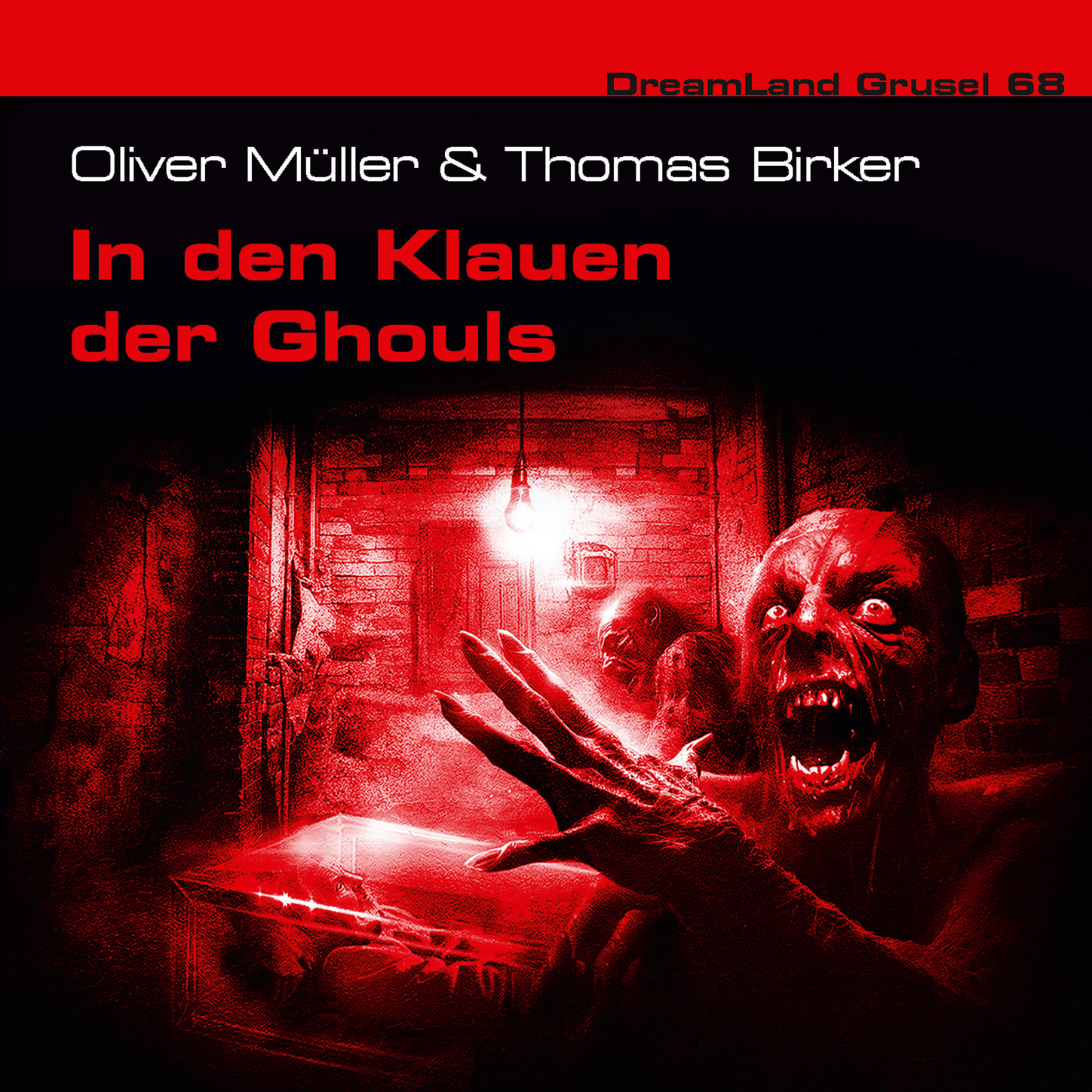1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Zeit war vergangen. Das Wesen wusste nicht, wie lange es reglos in dieser Höhle gewartet hatte, doch nun spürte es, dass es bald so weit war. Die Zeit der Reife ging ihrem Ende entgegen. Noch lag der Boden der Höhle über dem Wasserspiegel, aber das würde sich bald ändern. Die Wellen schleuderten bereits gegen den Rand des Eingangs und warfen ihr salziges Wasser ins Innere. Innerhalb kurzer Zeit würde es den Platz, auf dem das uralte Wesen saß, erreicht haben und bald darauf auch den gesamten Innenraum ausfüllen. Dann würde die Flut mit sich nehmen, was noch in dem Untier steckte und darauf lauerte, endlich das Licht der Welt zu erblicken. Unter der feuchten Haut zuckte und pulsierte es bereits.
Das Meerwasser berührte die Kreatur. Mit einem Laut, der einem Menschen eine Gänsehaut beschert hätte, erhob sich das Wesen auf die starken Beine. Eine Welle klatschte heran und erfasste das, was es in diesem Moment aus dem Hinterleib presste.
Alles, was in dem Wesen gereift und herangewachsen war, drängte heraus. Als die Welle sich ins Meer zurückzog, nahm sie die Eier mit sich. Es war die Geburtsstunde des Grauens - und eines neuen Königs ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Rückkehr der Königin
Epilog
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Die Rückkehr der Königin
von Oliver Müller
Zeit war vergangen. Das Wesen wusste nicht, wie lange es hier reglos in der Höhle gewartet hatte, doch nun spürte es, dass es bald so weit war. Die Zeit der Reife ging ihrem Ende entgegen.
Noch lag der Boden der Höhle über dem Wasserspiegel, aber das würde sich bald ändern. Die Wellen schleuderten bereits gegen den Rand des Eingangs und warfen ihr salziges Wasser ins Innere. Innerhalb kurzer Zeit würde es den Platz, auf dem das uralte Wesen saß, erreicht haben und bald darauf auch den gesamten Innenraum ausfüllen. Dann würde die Flut mit sich nehmen, was noch in dem Untier steckte und darauf lauerte, endlich das Licht der Welt zu erblicken.
Unter der feuchten Haut zuckte und pulsierte es bereits. Der Körper schien sich zu verformen, fiel aber immer wieder in die Ursprungsform zurück.
Das Meerwasser berührte die Kreatur. Mit einem Laut, der einem Menschen eine Gänsehaut beschert hätte, erhob sich das Wesen auf die starken Beine. Eine Welle klatschte heran und erfasste das, was es aus dem Hinterleib presste.
Alles, was in dem Wesen gereift und herangewachsen war, drängte heraus. Als die Welle sich ins Meer zurückzog, nahm sie die Eier mit sich. Es war die Geburtsstunde des Grauens – und eines neuen Königs ...
»Hättest du gedacht, dass wir jemals hierher zurückkehren?«
Die Stimme ihres Freundes riss Jennifer Wilson aus ihren Gedanken. Je näher sie St. Theodor gekommen waren, desto schweigsamer war sie geworden. Sie hatte aus dem Fenster geblickt und das Bild der Umgebung, in der sie aufgewachsen war, in sich aufgesogen wie ein trockener Schwamm das Wasser.
Erst jetzt, als sie nach St. Theodor zurückkehrte, merkte sie, wie sehr sie an ihrer Heimat hing. Auch jetzt noch, nach all dem Grauen, das sie hier erlebt hatte.
Was hatte sie den kleinen Ort verflucht, als sie hier gesessen und kein Wort zu Papier gebracht hatte. Da hatte sie sich nach London, New York oder sonst wohin gewünscht. Doch nun, nach Monaten der Trennung von ihrer Heimat an der Küste, merkte sie umso mehr, dass sie genau hierhin gehörte und an keinen anderen Ort der Welt.
Daher hatte es sie auch so sehr geschmerzt, als sie das ehemals von gut sechshundert Menschen bewohnte Dorf angesteuert und nur noch Ruinen gesehen hatte, wo früher Häuser gestanden und Menschen gelebt hatten. Menschen, die sie kannte und von denen heute viele tot waren. Sie hatten nicht einmal hier beerdigt werden können, wo sie ihr Leben gelebt hatten, da das Dorf erst seit Kurzem wieder von den Behörden freigegeben worden war.
»Jenny?«
Als ihr Freund Paddy sie erneut ansprach, wandte sie ihm den Kopf zu. Er sah ihr kurz tief in die Augen, dann richtete er den Blick wieder auf die Straße, denn er saß am Steuer, und der Untergrund verlangte ihm als Fahrer einiges ab.
»Entschuldige, ich war in Gedanken«, sagte sie.
»Das habe ich gemerkt. Alles in Ordnung mit dir?«
Sie nickte und zuckte gleichzeitig mit den Schultern. »Ich weiß noch nicht. Einerseits fühlt es sich gut an, wieder nach Hause zu kommen. Andererseits ...«
Sie sprach nicht weiter, daher beendete er ihren Satz. »Andererseits ist von Zuhause eben auch nicht mehr viel übrig.«
Sie nickte. »Es ist alles noch so unwirklich. Auch die Zeit, die vergangen ist, hat das nicht geändert.«
Paddy erwiderte nichts, aber sie wusste, dass er ähnlich dachte. In der zurückliegenden Zeit, die sie gemeinsam in der Wohnung eines Freundes, der sich beruflich im Ausland aufhielt, verbracht hatten, hatten sie oft über die Erlebnisse in St. Theodor gesprochen. Die Gespräche hatten ihnen beiden gutgetan, und Jenny hatte geglaubt, über alles hinweg zu sein. Doch der Anblick ihres Heimatdorfs riss die alten Wunden wieder auf.
»Vielleicht ist es ja keine Rückkehr für immer«, sagte Paddy, als er den Wagen über die einzige befahrbare Straße dorthin steuerte, wo sich früher der Marktplatz befand.
Jetzt nahm ein provisorischer Bau, der schon fast mehr an ein Zelt erinnerte, den größten Teil des Platzes ein. In dieser Unterkunft sollte heute die Bürgerversammlung stattfinden, in der die Behörden über den Stand der Dinge informieren wollten. Es ging um nicht weniger als das Fortbestehen oder die Aufgabe von St. Theodor.
Jenny warf einen Blick auf die Zeitanzeige. In weniger als zwei Stunden sollte sie beginnen.
Jenny war gespannt darauf, was man berichten würde. Und ob man über das Grauen, das für alles verantwortlich war, überhaupt ein Wort verlor. Sie konnte es sich kaum vorstellen. Zu unglaublich war die Geschichte, als dass die Behörden sie akzeptieren würden.
Paddy fand einen Parkplatz an der Rückseite des Leichtbaus und parkte den Rover. Als Jenny ausstieg, atmete sie tief durch. Es roch immer noch wie früher. Die Luft war frisch, und das nahe liegende Meer mischte eine ganz eigene Note hinein. So roch es nur hier. Und trotzdem war es nicht mehr wie früher. Die Unbeschwertheit fehlte. Es war, als würde etwas über dem Dorf liegen. Etwas, was sie nicht richtig benennen konnte.
Menschen, die sie von früher kannte, kamen zu ihnen herüber und begrüßten sie. Es tat gut, diese Gesichter zu sehen. Man erkundigte sich untereinander, wie es einem nach der Katastrophe ergangen und wo man untergekommen war. Es war ein gutes Gefühl, mit Menschen zu sprechen, die einen verstanden und denen man nichts erklären musste.
Die Zeit verging wie im Flug. Nach und nach betraten die Menschen die Versammlungshalle und suchten sich ihre Plätze. Im hinteren Teil war eine kleine Bühne errichtet worden. Dort saßen Behördenmitarbeiter. Namensschilder wiesen sie aus und benannten auch die Behörde, für die sie arbeiteten. Allerdings war die Schrift so klein, dass Jenny sie aus der Reihe, in der sie neben Paddy einen Platz gefunden hatte, kaum lesen konnte.
Früher hätte dort Benjamin Nattie, der Bürgermeister von St. Theodor gesessen, doch er war das erste Opfer der Frösche geworden. Schnell verdrängte Jenny den Gedanken an ihn, damit sich das Bild seiner schrecklich zugerichteten Leiche nicht in ihr festsetzen konnte.
Um sie herum hörte sie das Getuschel der Menschen, das verstummte, als sich auf der Bühne eine Frau mittleren Alters im Hosenanzug erhob. Sie wartete einen Augenblick, bis Ruhe eingekehrt war, dann stellte sie sich als Anne Bancroft von der überregionalen Baubehörde vor. Im Anschluss nannte sie auch die Namen der drei Männer und der weiteren Frau auf der Bühne, die Jenny sich nicht merkte. Das Einzige, was sie behielt, war, dass einer der Herren von der Umweltbehörde war und einer beim Katastrophenschutz arbeitete.
»Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind«, eröffnete Anne Bancroft ihren Vortrag. Sie sprach über das Geschehene, wobei sie es nur die Katastrophe nannte. »Trotz der exorbitanten Zerstörungen besteht eine Möglichkeit, den Ort zu erhalten, auch wenn es einen hohen bautechnischen Aufwand bedeutet«, führte sie weiter aus.
Ihre Aussage ließ ein Raunen durch das Publikum gehen. Paddy wandte Jenny den Kopf zu und schenkte ihr ein Lächeln. Jenny merkte jedoch schnell, dass es nicht seine Augen erreichte.
»Sollte sich eine Mehrheit für den Verbleib finden, sind die Behörden bereit, den Wiederaufbau mit Hochdruck voranzutreiben«, waren die letzten Worte der Bancroft.
»Wie lang soll das denn dauern?«
»Das ist doch utopisch!«
Zustimmende und ablehnende Rufe wurden laut, die Stimmung kochte hoch. Die angestauten Emotionen drohten sich bei vielen Bahn zu brechen. Vielleicht hatten die Menschen eher auf eine Entschädigung gehofft, mit der sie an anderer Stelle ein neues Leben beginnen konnten.
Anne Bancroft erhob sich erneut und bat um Ruhe. »Meine Damen und Herren, ich bitte Sie alle, die weiteren Vorträge abzuwarten. Danach können sie auf Grundlage aller Fakten eine Entscheidung treffen.«
Als Nächstes kam einer der Herren zu Wort. Er sprach über die Wiederherstellung der Infrastruktur. Im Rahmen der Sicherungsarbeiten, bei denen viele Häuser, die nicht mehr zu retten waren und ein Sicherheitsrisiko darstellten, bereits abgerissen worden waren, hatte man zumindest eine provisorische Versorgung mit Elektrizität sicherstellen können.
»Schwieriger sieht es mit der Wasserversorgung aus. Wichtige Knotenpunkte der Versorgung wurden zerstört und müssten überbrückt werden. Bis zur Wiederherstellung könnte allerdings eine Versorgung der Personen, die bereits heute in die Häuser, die als sicher markiert wurden, zurückgekehrt sind, über Wasserlieferungen per Tanklaster sichergestellt werden.«
»Welche Häuser sind das?«, rief jemand.
»Wir haben eine Liste mit den entsprechenden Adressen vorbereitet«, gab Mrs. Bancroft Auskunft. »Sie wird gleich ausgehändigt werden.«
»Was meinst du?«, fragte Paddy, der sich zu Jenny hinüberlehnte.
Jenny zuckte mit den Schultern. Das klang zwar alles ganz gut, aber nicht für sie. In den Tagen nach der Katastrophe, bis die Behörden St. Theodor endgültig geräumt hatten, waren sie auf dem Bauernhof von Lenny, dem verstorbenen Wirt des Dorfpubs, untergekommen. Auch heute würden sie dort übernachten und nicht zurückfahren.
Jenny sah ihren Freund nur traurig an. Er erwiderte ihren Blick und nickte dann. Sie war dankbar dafür, dass er sie auch ohne Worte verstand. Und das, obwohl sie erst kurz vor dem Unglück nach Jahren der Trennung wieder zusammengefunden hatten.
»Dürfte ich um Aufmerksamkeit bitten?«
Die Stimme war nicht von der Bühne gekommen, wie Jenny bemerkte, sondern hinter ihr aufgeklungen. Sie kam ihr bekannt vor, auch wenn sie sie nicht auf Anhieb zuordnen konnte. Als sie sich jetzt wie so viele andere auch umwandte, erblickte sie Nathaniel Conlon, den Dorfpfarrer.
Es war ein Wunder, dass er die Attacke des Riesenfroschs überlebt hatte. König Raana hatte die Kirche dem Erdboden gleichgemacht. Nichts war von dem massiven Bau übrig geblieben. Damals hätte Jenny keinen Penny mehr auf das Überleben Conlons gewettet, als sie gesehen hatte, wie Raana wie eine überdimensionierte Kanonenkugel in das Gotteshaus einschlug.
Hinterher hatte sie gehört, dass Conlon sich in der Krypta versteckt gehalten hatte. Sein Glück, die alten Säulen hatten ihm das Leben gerettet. Sie war gespannt, was er jetzt sagen wollte.
»Wir dürfen neben der Wiederherstellung der Infrastruktur nicht vergessen, dass auch das Gotteshaus neu errichtet werden muss. Immerhin war es der Schutz des Herrn, der uns ...«
Seine weiteren Worte gingen im Johlen der Menschen unter. Wenn Conlon gehofft hatte, Verständnis zu bekommen, dann wurde er bitter enttäuscht. Die Anwesenden machten ihm unmissverständlich klar, dass sie im Augenblick andere Prioritäten sahen als den Wiederaufbau der Kirche.
Schließlich gab Conlon klein bei und setzte sich wieder. Nicht, ohne noch anzukündigen, selbstverständlich für einen Verbleib in St. Theodor zu stimmen und in den nächsten Tagen in der Kirchenruine einen provisorischen Gottesdienst abzuhalten, der das Böse endgültig aus dem Ort vertreiben sollte.
»Wie lange dauert denn die Wiederherstellung der Wasserversorgung?«, rief jemand und lenkte das Thema wieder auf den zuvor verlassenen Punkt.
»Mehrere Wochen«, gestand der Mann von den technischen Diensten.
»Und solange können sie uns mit Frischwasser versorgen? Zum Trinken, Kochen, Waschen und allem anderen?«, fragte eine Frau skeptisch.
»Nun, sicher muss man mit den zur Verfügung gestellten Rationen sparsam umgehen, aber prinzipiell ...«
Er ließ den Satz ausklingen, was nicht sehr souverän wirkte, wie Jenny fand. Auch bei ihren Mithörern kam die Aussage nicht gut an. Fragen wurden nach vorne gerufen, die Menschen sprachen durcheinander, sodass man nicht alles verstand. Doch ein lauter Ruf übertönte die anderen.
»Das alte Wasserwerk!«
Sofort wandten sich alle Augen dem Sprecher zu. Jenny kannte den Mann, der aufgestanden war, vom Sehen. Der Name fiel ihr nicht ein, aber das war auch nicht wichtig.
»Das könnte die Lösung sein«, sprach der Mann, den Jenny auf Ende fünfzig schätzte, weiter. »Es wurde bis vor wenigen Jahren noch gewartet, obwohl es nicht mehr genutzt wurde. Es dürfte also mit relativ wenig Aufwand wieder in Betrieb genommen werden können.«
Zustimmende Rufe wurden laut. Jenny sah, wie die Menschen auf der Bühne die Köpfe zusammensteckten. Die Männer und Frauen nickten schließlich, und Anne Bancroft stand auf.
»Vielen Dank für ihren Vorschlag, Mister ...«
»Croydon.«
»Mister Croydon. Wir halten das für eine gute Idee. Mein Kollege Mister Johnson schätzt, dass es nur wenige Tage dauern wird, bis das Wasserwerk wieder läuft. Wenn es denn überhaupt möglich ist«, schränkte sie noch ein.
»Ich denke, es sollte klappen«, zeigte Johnson sich optimistischer. »Wir werden es morgen gleich angehen und Sie über Erfolg oder Misserfolg so zeitnah wie möglich informieren.«
Ob dies den Ausschlag für den am Ende des Abends per Handzeichen eingeholten Stimmungstest gab, konnte Jenny nicht sagen. Zumindest gab die Mehrheit der Anwesenden zu verstehen, dass sie St. Theodor nicht aufgeben wollten. Vor allem die Bewohner, deren Häuser zu retten waren, stimmten für den Verbleib.
Nur eine kleine Minderheit wollte ihren Lebensmittelpunkt verlagern. Jenny und Paddy enthielten sich der Stimme, ihre Arme blieben unten.
Schweigend verließen sie nach der Verabschiedung die Halle und gingen zu ihrem Auto.
»Und?«, fragte Paddy, der wieder hinter dem Steuer Platz nahm.
Jenny stieß schnaufend die Luft aus. »Ich weiß es nicht, Paddy. Wirklich nicht. Ich meine, das ist unsere Heimat. Ich verbinde viele schöne Erinnerungen mit ihr. Aber eben auch, was hier passiert ist. Die vielen Toten. Das kann ich nicht einfach wegwischen. Und unsere Wohnungen ...«
»Wir haben den Bauernhof.«
Jenny lachte auf. »Der uns nicht gehört. Es kann sich jederzeit ein Erbe melden, der uns rauswirft.«
Paddy zuckte mit den Schultern. »Mir ist kein Verwandter von Lenny bekannt. Dir?«
Jenny schüttelte den Kopf. »Nein, aber das heißt nichts. Dann fällt das Gelände eben an den Staat. Auch die werden uns den Hof nicht schenken.« Sie fuhr sich mit der Hand über die Augen. Auf einmal war sie schrecklich müde. »Lass uns erstmal schlafen gehen. Heute kann ich nicht mehr klar denken.«
»Du hast recht«, stimmte ihr Freund zu. »Eine Entscheidung können wir auch morgen noch fällen.«
»Oder übermorgen.«
»Hey, ganz so schnell willst du also doch nicht wieder weg.«
Die junge Frau zuckte mit den Schultern. »Themenwechsel. Ich habe Hunger.«
»Dann ab nach ...«
»Fahr einfach«, unterbrach Jenny ihn. Der Hof war nicht ihr Zuhause. Und im Moment glaubte sie auch nicht, dass er es werden würde. Aber trotzdem musste sie sich darüber erst noch endgültig klar werden.
Am nächsten Tag, später Abend
Matthew Hodgson schob sich den Helm in den Nacken und wischte sich mit der schwieligen Hand den Schweiß von der Stirn. Er hatte sie kaum gesenkt, als der etwas zu große Helm ihm wieder vor die Augen rutschte. Fluchend nahm er ihn ab und legte ihn zur Seite. Solange sein Vorarbeiter nicht da war, konnte der das schlecht sitzende Dinge ja wohl mal ein paar Minuten abnehmen.
Was sollte er überhaupt mit einem Helm? Sie arbeiteten in einem Gebäude, das noch gut in Schuss war. Auch wenn das Wasserwerk schon ein paar Jahre nicht mehr in Betrieb war und einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatte, die Gefahr herabstürzender Bauteile war hier sicher nicht gegeben. Ganz im Gegenteil zu den anderen Gebäuden, die Matt auf dem Weg zu seiner aktuellen Arbeitsstelle gesehen hatte.
Was war nur in St. Theodor passiert? Egal, wen er fragte, niemand aus seinem Team wusste es. Und sein Chef schwieg sich darüber aus. Entweder wusste auch er nichts, oder man hatte ihn von oben zum Schweigen verdonnert. Na ja, war ja auch egal.
Wichtig war nur, dass sie hier Tag und Nacht arbeiteten, damit das alte Wasserwerk wieder in Betrieb genommen werden konnte. Matt hatte sich freiwillig für die Nachtschicht gemeldet, die Zuschläge konnte er gut gebrauchen.
»Hey, Matt!«
Der Angesprochene zuckte zusammen und griff hektisch nach seinem Helm.
»Lass liegen, ich bin es nur.«
Diesmal war die Stimme näher aufgeklungen. Matt blickte aus seiner knieenden Haltung über die Schulter. Es war sein Kollege David Rush.
Matt grinste. »Für einen Moment hab ich gedacht, du wärst der Alte.«
David erwiderte das Grinsen. »Wenn ich recht informiert bin, bist du von uns beiden der Ältere. Zumindest siehst du so aus.«
»Scherzkeks! Was willst du, David?«
»Nachsehen, wie weit du bist. Es geht wohl deutlich schneller, das Werk wieder an die Leitung zu bringen.«
Matt blickte auf sein Werk. »Ich bin auch bald so weit. Hier und da musste ich zwar improvisieren, da es keine originalen Ersatzteile mehr gab. Aber für den Anfang sollte es reichen. Wenn es noch passende Ersatzteile gibt, dann kann man auch später noch austauschen.«
»Hast du wieder was gebastelt? So, wie ich dich kenne, kommt dann kein Wasser, sondern Bier aus dem Hahn.«
»Du hast wohl mal wieder auf dem Witzekissen gepennt heute Nacht.«