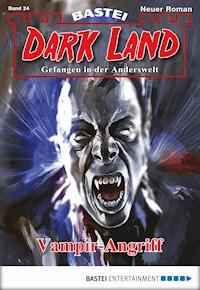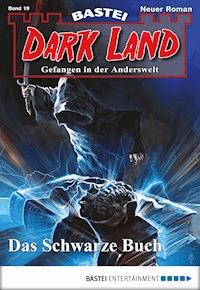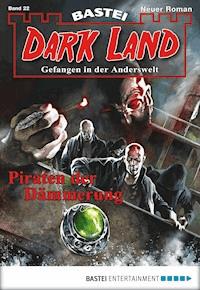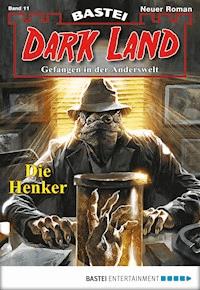1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Geistesabwesend blickte der Mann auf die ruhige See hinaus. Hier oben, von den steilen, weißen Klippen aus betrachtet, wirkte sie geradezu friedlich, ebenso wie das Land, auf dem er stand. Nur selten in der Historie war es an diesem Ort derartig zugegangen, insbesondere nicht zur Zeit der Kreuzzüge. Gottesfürchtige Männer, Ritter und Adlige wie auch einfache Leute waren im Namen der Kirche hierhergezogen, um das Heilige Land von seinen angeblichen Besatzern, den Moslems, zu befreien.
Was davon in der Erinnerung der Menschen zurückblieb, wurde oft verklärt oder romantisiert. Es war eine blutige, brutale und dunkle Zeit gewesen, in der sich beide Seiten in Gräueltaten in nichts nachstanden. Was während der Kreuzzüge geschehen war, war ein Produkt aus Verblendung und Machthunger gewesen, und letztendlich blieben von den Eroberungszügen der Europäer nur Ruinen zurück ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Godwins Höllentrip
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Godwins Höllentrip
von Rafael Marques
Geistesabwesend blickte der Mann auf die ruhige See hinaus. Hier oben, von den steilen, weißen Klippen aus betrachtet, wirkte sie geradezu friedlich, ebenso wie das Land, auf dem er stand. Nur selten in der Historie war es an diesem Ort derartig zugegangen, insbesondere nicht zur Zeit der Kreuzzüge. Gottesfürchtige Männer, Ritter und Adlige wie auch einfache Leute waren im Namen der Kirche hierhergezogen, um das Heilige Land von seinen angeblichen Besatzern, den Moslems, zu befreien.
Was davon in der Erinnerung der Menschen zurückblieb, wurde oft verklärt oder romantisiert. Es war eine blutige, brutale und dunkle Zeit gewesen, in der sich beide Seiten in Gräueltaten in nichts nachstanden. Was während der Kreuzzüge geschehen war, war ein Produkt aus Verblendung und Machthunger gewesen, und letztendlich blieben von den Eroberungszügen der Europäer nur Ruinen zurück ...
Armand de Maurisse ließ seinen Blick nach Norden wandern, in Richtung Aschdod, der historisch bedeutsamen israelischen Hafenstadt. Erst vor etwas mehr als sechzig Jahren war hier der alte, blutige Konflikt zwischen Juden und Moslems ausgetragen worden, als die Truppen des arabischen Bündnisses bis dorthin vorgedrungen waren. Gewaltige Zerstörungen waren die Folge gewesen, aber auch davon merkte man heute nichts mehr. Nichts war geblieben, außer der Erinnerung und wenigen sichtbaren Zeugnissen – ebenso wie an dem Ort, an dem er sich gerade befand.
Die Ausgrabungen der etwa zehn von ihm angeheuerten Archäologen und deren Helfern waren im vollen Gange. Die Männer und Frauen ließen sich auch nicht von seinen bewaffneten Söldnern stören, die die Anlage überwachten und dafür sorgten, dass sie keinen ungebetenen Besuch bekamen. Es hatte ihn einige Mühen und viel Geld gekostet, alle Vorbereitungen für das nur wenige Tage andauernde Projekt zu treffen. Legal war es natürlich nicht, und um den archäologischen Wert der Anlage ging es ihm ebenfalls nicht, deshalb waren auch einige Bestechungszahlungen und Einschüchterungen nötig gewesen.
Immer mal wieder dachte er an den Mann zurück, der ihm den Spiegel überreicht hatte, der sein Leben von Grund auf verändern sollte. Er kannte nicht einmal sein Gesicht, nur die raue Stimme, die aus der über den Kopf geschlagenen Kutte hervorgedrungen war.
All das kam ihm wie ein Wink des Schicksals vor, denn nur kurze Zeit zuvor hatte er damit begonnen, seine eigene Existenz und die Geschichte seiner Familie zu hinterfragen. Schließlich war er ein Lebemann, der Leiter eines weltweit tätigen Unternehmens, der schon mit Mitte vierzig kein Ziel mehr sah, das er noch erreichen konnte. Selbst
eine Familie zu gründen, hatte ihn nie interessiert, und so trat er eine Reise zu sich selbst und seinen Wurzeln an. Es war, als hätte eine andere Kraft genau auf diesen Entschluss gewartet, denn durch sie war er erst an diesen Ort gelangt.
Armand de Maurisse – dieser Name existierte in seinem Familienstammbaum noch ein zweites Mal. Damals, zu Zeiten der Kreuzzüge, war sein Ahn ein wichtiges Mitglied der französischen Adelshäuser gewesen und hatte einen ganzen Soldatenzug in den Krieg gegen die Muselmanen geleitet.
Später war sein Vorfahre auf dunklen Pfaden gewandelt, bis seine Lebenslinie an diesem Ort ihr Ende gefunden hatte. So zumindest stand es in den Annalen seiner Familie, und jetzt wollte er herausfinden, ob das wirklich stimmte. Eine innere Stimme sagte ihm nämlich, dass in einer Welt wie dieser nichts wirklich starb.
Dass sich hier einst eine Festung befunden hatte, war erst durch die Ausgrabungen der letzten Tage bewiesen worden. Einige Kilometer weiter Richtung Aschdod fanden sich die Überreste des Chastel Béroard, einer alten Araber- und Kreuzfahrerfestung, die wesentlich besser erhalten war. Die für ihn namenlose zweite Burg war nur aus wenigen vorchristlichen Berichten bekannt, und nirgendwo stand geschrieben, dass sie bis in die Zeit seines Vorfahren überdauert hatte. Und doch sollte dieser hier gestorben sein.
»Commandant«, rief ihm Jurij zu, der Anführer der ihn begleitenden Söldnertruppe.
Armand war nie beim Militär gewesen, deshalb war die Bezeichnung seines Helfers lediglich aus der Luft gegriffen. Jurij Stepanov war ein hartgesottener Kämpfer, wahrscheinlich der beste, den man für Geld kaufen konnte.
Vor allem durch sein Wirken im Jugoslawien-Krieg war der grauhaarige, etwa sechzig Jahre alte Mann in dem graubraunen Militäranzug in gewissen Kreisen sehr bekannt geworden, wie er inzwischen wusste. Jurij war kurz nach dem Mann mit dem Spiegel bei ihm aufgetaucht, weshalb er davon ausging, dass beide voneinander wussten.
»Was gibt es?«, rief Armand von den Klippen herab.
Der Söldner und einige Ausgrabungsteilnehmer hielten sich am tiefsten Punkt der nur noch aus wenigen Grundmauern bestehenden Anlage auf, wahrscheinlich im Bereich der Überreste einer Steinkammer.
»Das sollten Sie sich selbst ansehen.«
Armand de Maurisse seufzte, wandte sich von dem Anblick der stillen See ab und eilte den Hang hinab. Hier unten wurden seine dunklen, von hellen Strähnen durchzogenen, schulterlangen Haare nicht von dem herrlich frischen Wind aufgewirbelt.
Die allgegenwärtige Sonne brannte auf die Erde herab, heizte sie auf und schuf innerhalb der Grube einen wahren Glutofen. Obwohl er sich erst wenige Sekunden hier unten aufhielt, bildete sich auf seiner Haut bereits eine Schweißschicht.
Ein etwa dreißig Jahre alter Archäologe scheuchte seine lokalen Helfer mit lauten Rufen zur Seite. Jetzt sah Armand, dass seine Leute mehrere Steinblöcke abgetragen und so einen größeren Hohlraum freigelegt hatten, aus der die abgestandene Luft längst vergangener Zeiten strömte.
Ein Schauer lief über seinen gesamten Rücken, als er einen ersten Blick in die Tiefe warf. Einige Meter unter ihm lag die völlig verrostete und mit einer dicken Staubschicht bedeckte Rüstung eines Ritters, dessen skelettierter Schädel ebenfalls noch existierte. Allein war er in der Kammer nicht gestorben, denn um ihn herum lagen Dutzende mumifizierte und teils skelettierte Geschöpfe. Sogar in seinen Augenhöhlen steckten Überreste der Ratten, mit denen er hier ganz offensichtlich bei lebendigem Leibe eingemauert worden war. Kratzspuren an den Wänden deuteten jedenfalls klar darauf hin.
»Der Koffer, schnell«, wies er Jurij an, der als Einziger von dem unschätzbar wertvollen Kleinod wusste, mit dem Armand nach Israel gereist war. »Sofort.«
Armand de Maurisse sah sich endlich am Ziel seiner Träume. Er fühlte es einfach, dass das sein namensgleicher Vorfahre war, der hier ein furchtbares Ende gefunden hatte.
Und noch etwas nahm er wahr – die Kälte, die aus der Kammer strömte. Es war nicht nur der Hauch des Todes, sondern die feinstofflichen, für das menschliche Auge nicht sichtbaren Überreste einer unheilvollen Kraft, der sich der andere Armand de Maurisse einst verschrieben hatte.
Jurij trat wieder an ihn heran und reichte ihm den Koffer. Eilig riss er ihn an sich, öffnete ihn und zog den etwa zwanzig Zentimeter breiten, eiförmigen Spiegel hervor. Die von aus Holz geschnitzten, seltsamen Fratzen umrahmte Fläche bestand nicht aus normalem Glas, denn sie warf kein Spiegelbild. Den Aussagen des Vorbesitzers nach war er in der Lage, die Seele bestimmter, besonderer Menschen einzufangen und abzubilden.
Komm.
Augenblicklich zuckte Armand de Maurisse zusammen. Er sah sich um und erkannte, dass ihn seine Leute neugierig und verwirrt anstarrten. Alle warteten sie auf seine Reaktion, während die leise Botschaft nur für ihn bestimmt gewesen war.
Komm zu mir.
»Ja, ja«, murmelte Armand. »Eine Leiter, sofort.«
Ein anderer Söldner brachte ihm eine einfache Holzleiter, die er neben der Rüstung in die Tiefe sinken ließ. Er war so aufgeregt, dass er aufpassen musste, nicht an den Sprossen abzurutschen.
Stück für Stück schob er sich tiefer in die Kammer, und bald überkam ihn das Gefühl, als würde ihn die Kälte wie ein Krake umschließen und nie mehr loslassen wollen.
Endlich erreichte er das Ende der Leiter, baute sich neben den Überresten des Ritters auf und blickte auf die glatte, konturenlose Spiegelfläche. Ein leises Stöhnen drang an seine Ohren, und für einen Moment erwartete er, dass sich die Rüstung in die Höhe schieben und er in die Skelettfratze seines Vorfahren blicken würde.
Das geschah jedoch nicht, stattdessen bildeten sich auf der Metalloberfläche des Spiegels graue, nebelgleiche Schlieren, die sich nach und nach zu einem Gesicht zusammensetzten. Es war kantig, von den Narben des Krieges durchzogen und durch die Sonne braun gebrannt – und es kam ihm unheimlich bekannt vor, denn die Ähnlichkeit zu ihm selbst war unverkennbar. Selbst nach all den Jahrhunderten war das Erbe des ursprünglichen Armand de Maurisse offenbar noch in ihm wiedergeboren worden.
So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, sprach ihn die Seele des Toten aus dem Spiegel heraus an. Ich – und meine Freunde ...
»Deine Freunde?«
Entsetzt beobachtete Armand, dass in die Rüstung nun doch Bewegung kam, nur ganz anders, als er es vermutet hatte. Nicht der Ritter erwachte zu neuem Leben, sondern die Ratten. Kleine, rot leuchtende Augen entstanden, und innerhalb weniger Sekunden regenerierten sich die kleinen Nagetiere so weit, dass ihre fellbewährten Körper wieder über die Rüstung kriechen konnten.
Es wirkte schon sehr bedrohlich, wie sich die kleinen Tiere mit ihren leuchtenden Augen um ihn herum versammelten. Angst verspürte er allerdings nicht, im Gegenteil: Er wusste, dass sie ihm dabei helfen würden, die nächsten Schritte seines Plans einzuleiten ...
Wieder einmal stand ein Jahrestag an, den Godwin de Salier stets auf spezielle Weise beging. Nicht, indem er eine große Rede hielt, in Erinnerungen schwelgte oder ein Bild des Toten aufstellen ließ, um seine Trauer ihm gegenüber zu bekunden.
Er versammelte alle Templer in der kleinen Kapelle auf dem Gelände, in der auch die Gebeine der Maria Magdalena begraben lagen, und bat sie um ein stilles Gebet.
Allein eine große, brennende Kerze erinnerte an den Verstorbenen, seinen Vorgänger Abbé Bloch, der sich so sehr um die Bruderschaft der Templer verdient gemacht hatte.
Der Abbé war nie jemand gewesen, dem es darum gegangen war, sich oder seine Taten in den Vordergrund zu rücken. Er hatte stets aus Überzeugung gehandelt, in dem Glauben, das Richtige zu tun, wenn es darum ging, sich dem Bösen entgegenzustellen und seinem Orden zu neuer Blüte zu verhelfen.
Dass er letztlich den Mächten der Finsternis zum Opfer gefallen und getötet worden war, änderte nichts daran, dass er ein großer Mensch und Templer gewesen war. Die Erinnerung an ihn und sein Wirken sollte weiterleben, in jedem einzelnen Templer.
Viele Mitbrüder waren es nicht mehr, die schon im Kloster gewesen waren, als der Abbé noch gelebt hatte. In der Zwischenzeit war viel geschehen, einige Templer waren gestorben, und das nicht nur an Altersschwäche. Selbst ein Bombenanschlag hatte die Templer nicht von ihrem Wirken abgehalten, und schon gar nicht ihr ewiger Erzfeind, der dämonische Götze Baphomet.
An ihn wollte Godwin nicht denken. Nicht während des Gebets und auch nicht am Abend, nach dem Sonnenuntergang, während er das schlichte, unscheinbare Grab im Klostergarten besuchte, das sich im Bereich der Mauer befand.
Längst war er selbst ein erfahrener und kampferprobter Templerführer, was sicher auch an seiner eigenen Vergangenheit lag. Er war zur Zeit der Kreuzzüge geboren worden und hätte fast im Kampf sein Leben verloren, wenn er nicht von John Sinclair gerettet und in die Gegenwart gebracht worden wäre.
Der Abbé hatte ihm nicht nur eine Zuflucht geboten, sondern auch eine neue Lebensaufgabe gegeben, und er war der Meinung, dass er sein Erbe mit Würde ausfüllte.
Trotzdem war da diese seltsame Stimmung, die nicht von ihm weichen wollte. Es war ein Druck auf dem Herzen, ein ungutes Gefühl, das er nicht so recht in Worte fassen konnte.
Nicht einmal seiner Frau Sophie hatte er davon erzählt, und sicherlich fragte sie sich längst, warum er so viel Zeit im Klostergarten verbrachte. Auch die anderen Templer sprachen ihn nicht darauf an und ließen ihn einfach gewähren, während sie sich langsam in ihre Gemächer zurückzogen. Nur ein Wachtposten auf dem Dach und zwei Mönche in der technischen Zentrale würden weiter jeden Winkel des Klosters überwachen, denn ihre Feinde schliefen nie.
Was erwartete er, hier zu finden? Dass sich der Geist des Abbés bei ihm meldete und ihm sagte, was mit ihm nicht stimmte? Es wäre nicht das erste Mal gewesen, wenngleich das Jahre zurücklag und der Abbé sicher längst seinen endgültigen Frieden gefunden hatte.
Zumindest hoffte er das, denn sicher war in diesem Leben nichts, was er schon an seiner Frau Sophie erlebte. Sie war eine Wiedergeburt der Maria Magdalena, und manchmal ergriff ihr Geist immer noch Besitz von ihr.
Etwas Vergleichbares würde hier sicher nicht passieren. »Danke, Abbé«, sagte er trotzdem, während er sich langsam von der Grabstätte zurückzog. »Danke für alles.«
Gedankenverloren spazierte er durch die Gärten, an dem Brunnen vorbei und den Kreuzgang entlang, bevor er die Treppe in den ersten Stock hinaufstieg. Dort lagen unter anderem sein Schlaf- und Arbeitszimmer.
Sophie würde ihn sicherlich schon erwarten, nur bezweifelte er, dass er so schnell Schlaf finden würde. Dazu war seine innere Unruhe einfach viel zu stark.
In früheren Zeiten hätte er nicht nur den Abbé um Rat fragen können, sondern auch einen gewissen Hector de Valois. Der einstige Templerführer hatte als silbernes Skelett viele Jahre in der nahen Kathedrale der Angst gelegen und den Würfel des Heils gehütet, bis er an der Bundeslade vernichtet worden war, in dem Versuch, John Sinclairs Leben zu retten. Der Würfel war schließlich in Godwins Besitz übergegangen, und jetzt beschäftigte er sich mit dem Gedanken, ihn einzusetzen.
Ein unheilvolles Grummeln hallte durch die Mauern des Klosters. Draußen hatte er nicht auf das Wetter geachtet, und jetzt schien langsam ein Gewitter aufzuziehen. Als er in das Arbeitszimmer trat, war es hinter den Fenstern bereits sehr dunkel geworden. Wahrscheinlich würde es bald zu regnen beginnen, was in gewisser Weise auch zu seiner Stimmung passte. Etwas lag in der Luft, eine nicht fassbare Bedrohung, die etwas mit seinem Leben als Templer zu tun hatte. Das sagte ihm einfach sein Instinkt.
Trotz der Dunkelheit schaltete er das Licht nicht ein. Er kannte sich in dem Raum blind aus und wusste genau, wo sich der Gegenstand befand, nach dem er suchte. In einem schlichten Holzschrank lagerte nicht nur der Würfel des Heils, sondern auch die Bibel des Baphomet und die Ketzerbibel. Wenn er daran dachte, wie viele blutige Kämpfe es in der Vergangenheit um diese magischen Artefakte gegeben hatte, wunderte es ihn, warum seine Feinde nicht immer wieder versuchten, in ihren Besitz zu gelangen.
Der etwa handtellergroße Würfel hatte eine violette Oberfläche, die in Bewegung geriet, sobald man ihn aktivierte. Mit ihm konnte er Botschaften und Visionen empfangen, aber auch den schrecklichen Todesnebel heraufbeschwören, ebenso wie es mit seinem Gegenstück möglich war. Der Würfel des Unheils befand sich inzwischen seit langer Zeit im Besitz des Spuks.
Es war nicht nötig, den Würfel mit einem Zauberspruch zu aktivieren. Man musste sich einfach konzentrieren und von ihm als würdiger Träger akzeptiert werden.
Von der Idee, sich zusätzlich auf den Knochensessel zu setzen, nahm er schnell Abstand. Er wollte mit seiner fixen Idee nicht zu viel heraufbeschwören, zumal der Sessel ein gewisses Eigenleben hatte und nicht unbedingt immer das tat, was man von ihm erwartete.
Deshalb ließ er sich hinter seinem Arbeitstisch nieder, drehte den Stuhl herum und blickte aus dem Fenster. Über das Kloster ging ein wahrer Landregen nieder, der den Garten in einen dunkelgrauen, nassen Schleier hüllte. Dicke Tropfen klatschten gegen die Scheibe, doch trotz der äußeren und auch der inneren Unruhe fielen ihm bald die Augen zu.
Mit letzter Kraft sah er noch, dass die violetten Schlieren innerhalb des Würfels längst in Bewegung geraten waren, dann fiel er in einen tiefen Schlaf – und erwachte in einer anderen Zeit.
Godwin de Salier schritt durch eine Geisterstadt!
Es war beängstigend, zu erleben, zu was Templer in der Lage waren. Gottesfürchtige Männer, die in den Heiligen Krieg gezogen waren, um das biblische Israel aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Ob das wirklich nötig und möglich war, daran hegte Godwin schon länger große Zweifel, und noch viel mehr beschäftigte ihn, wie aus den Kämpfern des Herrn derartige Monster werden konnten.
Überall, wo er hinsah, sah er Leichen. Männer, Frauen und Kinder waren gleichermaßen niedergemetzelt und ihre Häuser in Brand gesteckt worden. In der Luft hing der widerliche Geruch von verbranntem Fleisch.
Die Männer, auf die man ihn angesetzt hatte, kannten wirklich keinerlei Gnade. Auch die Araber waren nur Menschen, und unschuldige Zivilisten konnten nun wirklich nichts dafür, dass es sehr hart war, die Heiligtümer dieses Landes vor seinen Feinden zu verteidigen. Was hier geschehen war, war schlicht Mord. Massenmord. Und das nicht zum ersten Mal.
Richard Löwenherz persönlich hatte die Verfügung erlassen, der marodierenden Bande Herr zu werden, die für dieses und zahlreiche weitere Massaker verantwortlich war. Den Abtrünnigen ging es nur darum, Reichtümer zu rauben und anzusammeln und dabei keine Zeugen zu hinterlassen. So war nur aus wenigen Berichten von Überlebenden ersichtlich gewesen, dass tatsächlich Tempelritter für die Bluttaten verantwortlich waren.
Während seine Helfer in anderen Orten nach den Marodeuren suchten, war er nach Ra'ham gezogen, nachdem ein anonymer Hinweisgeber ihm berichtet hatte, dass die Templer hier erneut zuschlagen würden. Leider war er viel zu spät gekommen.
Er wollte sein Pferd bereits dazu animieren, kehrtzumachen und diesen Ort des Grauens zu verlassen, als er doch etwas Leben innerhalb dieser Geisterstadt entdeckte. Auf einem völlig zerstörten Marktplatz löste sich eine Gestalt aus den Trümmern eines Pferdewagens. Selbst aus dieser Entfernung erkannte er, dass es sich um eine junge, in einen schwarzen Umhang gehüllte Frau handelte.