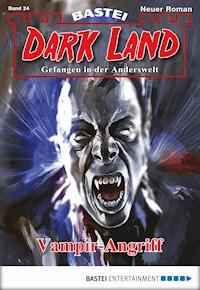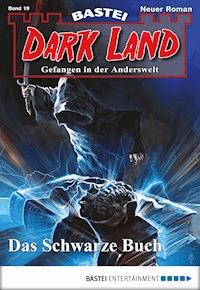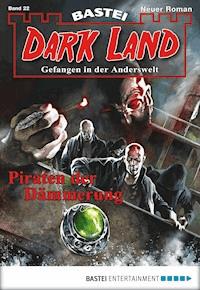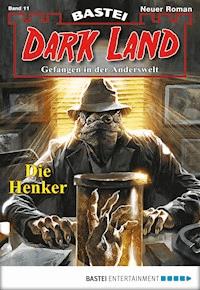1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Als düsteres Fanal erschien das Schiff am Horizont. Im morgendlichen Dunst wirkte es mit seinen zerrissenen Segeln, die sich leicht im Licht bewegten, wie ein Bote aus der Geisterwelt. Als hätte das Jenseits seine Pforte geöffnet und diesen unheimlichen Segler entlassen.
Jean-Paul bekreuzigte sich, als er den Zweimaster erblickte. Selbst aus dieser Entfernung nahm er die Kälte wahr, die von dem Segler ausging. Sie war anders als die morgendliche Frische, die der Seewind und der Nebel mit sich brachten. Eher so, als würde etwas Böses nach seiner Seele greifen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Baphomets Jäger
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Baphomets Jäger
von Rafael Marques
Als düsteres Fanal erschien das Schiff am Horizont. Im morgendlichen Dunst wirkte es mit seinen zerrissenen Segeln, die sich leicht im Licht bewegten, wie ein Bote aus der Geisterwelt. Als hätte das Jenseits seine Pforte geöffnet und diesen unheimlichen Segler entlassen.
Jean-Paul bekreuzigte sich, als er den Zweimaster erblickte. Selbst aus dieser Entfernung nahm er die Kälte wahr, die von dem Segler ausging. Sie war anders als die morgendliche Frische, die der Seewind und der Nebel mit sich brachten. Eher so, als würde etwas Böses nach seiner Seele greifen ...
»Pierre, Fabrice!«, alarmierte er die beiden anderen Männer, die mit ihm auf die See hinausgerudert waren zu den reichen Fischgründen vor der Küste.
In unruhigen Zeiten wie diesen, in denen es viele Männer in das Heilige Land zog, um dort die Ursprünge des Christentums vor den Moslems zu verteidigen, kam ihrer Arbeit eine umso größere Bedeutung zu.
Jean-Paul dachte auch nicht daran, seine Frau und die beiden Kinder zurückzulassen. Nicht, weil der Zweiunddreißigjährige der Meinung war, dass das ein sinnloses, gefährliches Unterfangen war. Er trug schlichtweg eine große Verantwortung, dafür zu sorgen, dass seine Familie und Freunde nicht hungerten. Gefragt worden war er schon, ob er mit auf den nahenden nächsten Zug nach Judäa ziehen würde, aber jedes Mal hatte er ablehnen müssen.
»Was ist denn?«, fragte Fabrice, sein drei Jahre älterer Cousin, während Pierre wie so oft stumm blieb.
Fabrice war ein Bär von einem Mann, gestählt durch unzählige Kriege, und es war nur eine Frage der Zeit, bis der Mann mit dem dichten, dunklen Vollbart dem Ruf der Kirchenmänner folgen würde.
»Sieh!«
Fabrice blickte in Richtung der von den dunklen Wolken verdeckten Sonne, wo der führerlose Segler langsam in ihre Richtung trieb. Noch immer zeigte sich niemand an Deck, ein starker Hinweis darauf, dass an Bord niemand mehr lebte oder die Besatzung das Schiff längst verlassen hatte. Manche Seefahrer berichteten, sie hätten auf ihren Fahrten Geisterschiffe erlebt, bei denen die gesamte Mannschaft als lebende Tote an Deck gestanden hätten, aber daran wollte Jean-Pierre nicht glauben.
»Das gefällt mir nicht«, murmelte Fabrice. »Andererseits können wir das Schiff auch nicht einfach seinem Schicksal überlassen.«
»Willst du an Bord?«
»Du nicht?«
»Ich habe kein gutes Gefühl dabei ...«
Wieder blickte Fabrice aufs Meer hinaus und beobachtete den verlassenen Kahn, der träge in ihre Richtung trieb. Am Bug hafteten einzelne Muscheln, was darauf hinwies, dass er schon eine ganze Weile über das offene Meer trieb. Während sein Cousin selbst zu überlegen schien, ob Jean-Pauls Eindruck mehr als nur eine Täuschung sein könnte, lief ihm erneut ein Schauer über den Rücken. Er blickte zu Pierre hinüber, ihrem erst zwanzig Jahre alten, wortkargen Helfer, der das Netz eingeholt hatte und sich jetzt neben ihnen aufbaute. Unbewusst spielte er dabei mit dem kleinen Kreuz, das er stets um den Hals trug.
»Ich glaube, ich weiß, was du meinst«, bestätigte ihn Fabrice. »Andererseits ist es auch unsere Pflicht, der Besatzung zu helfen. Selbst wenn dort niemand mehr leben sollte, haben die Angehörigen das Recht, ihre verstorbenen Verwandten zu beerdigen.«
Jean-Paul war nicht glücklich über die Entscheidung seines Cousins, aber er akzeptierte sie. Fabrice und er setzten sich bereits an die Ruder, während er das Schiff nicht aus den Augen ließ. Jetzt fiel ihm auch die zerfetzte, an der Spitze des Mastes im Wind flatternde Fahne auf, deren Farben ihm völlig unbekannt waren. Möglicherweise stammte der Segler aus Arabien oder einem der nordafrikanischen Reiche, gegen die seit Jahrhunderten ein blutiger Kampf um die Herrschaft der Iberischen Halbinsel geführt wurde.
Das Schiff rückte immer näher, und mit ihm auch die unbändige Kälte, die von ihm ausging. Ihm war, als würden die Kräfte der Hölle nach seiner Seele greifen, und es kostete ihn viel Überzeugung, nicht einfach wegzusehen.
Über die Reling baumelte eine einfache, von Wind und Wasser teils aufgeriebene Strickleiter. Es schien so, als hätte die Besatzung versucht, über sie in ein Beiboot zu fliehen, denn ansonsten gab es für ihr Vorhandensein keine andere Erklärung. Wenn dem so war, erklärte das auch, warum der Segler führerlos dahintrieb, jedoch nicht, wovor die Männer geflohen waren. Vor einem Angriff, einem Schaden – oder vor etwas, das noch immer auf dem Schiff lauerte?
»Schläfst du, Jean-Paul?«
Die Stimme seines Cousins riss ihn aus seiner düsteren Gedankenwelt. Ihr Ruderboot hatte inzwischen den verlassenen Segler fast erreicht. Als die Strickleiter zum ersten Mal in Griffweite geriet, streckte er seine Arme nach ihr aus und bekam sie auch zu fassen. Zu seiner Überraschung waren die Seile noch so reißfest, dass er das Boot durch sie an den Bug heranziehen konnte.
»Ich gehe zuerst«, sagte Jean-Paul, auch, um seine Ängste zu überwinden und sich der Bedrohung zu stellen.
»Warte.«
Nicht Fabrice hielt ihn mit seinem Ruf davon ab, sondern Pierre. Der junge Mann war als Waise in ihr Dorf gekommen, und da er nie über seine Vergangenheit – oder überhaupt – ein Wort verlor, munkelte man, dass seiner Familie und ihm etwas Schreckliches widerfahren sein musste. So wie jetzt hatte Jean-Paul ihn selten erlebt – mit starrem Blick, in dem eine wilde Entschlossenheit funkelte. Er hielt ihm das lange Messer entgegen, das sie normalerweise benutzten, um die Netze im Notfall abzuschneiden.
Jean-Paul fasste nach dem Griff und nickte dem jungen Mann zu. »Danke.«
Er steckte das Messer in seinen Hosenbund, denn er benötigte beide Hände, um sich an der nicht mehr ganz intakten Strickleiter in die Höhe zu ziehen. Nachdem es ihm gelungen war, die Reling zu übersteigen und sich auf die Planken zu werfen, richtete er sich blitzschnell wieder auf und riss das Messer hervor.
Direkt vor ihm lag ein blanker Totenschädel, der durch den Wellengang langsam über Deck rollte. In einiger Entfernung entdeckte er weitere Knochen, die möglicherweise von Seevögeln dort verstreut worden waren.
»Was siehst du?«, rief ihm Fabrice vom Boot aus zu.
»Den Tod ...«
Nur wenig später begannen Fabrice, Pierre und er gemeinsam, das Deck abzusuchen. Nicht weit vom verwaisten Steuerrad entfernt entdeckte er einen teils von Algen bedeckten Beckenknochen, der wahrscheinlich zu dem im Bereich der Strickleiter umherrollenden Totenkopf gehörte. Auch einige verstreute Kleidungsreste fielen ihm auf, die ihn aber auch nicht weiterbrachten.
Was war hier nur geschehen? War der größte Teil der Besatzung geflohen und hatte einen Matrosen zurückgelassen? Nur, was war dann der Grund für eine derart überstürzte Flucht gewesen? Gut, die Segel waren nicht mehr funktionsfähig, aber auf einem Schiff wie diesem waren die Überlebenschancen um ein Vielfaches höher als auf einem kleinen Beiboot.
Ein dumpfer, wenngleich schriller Schrei riss ihn ein weiteres Mal aus den Gedanken. Jean-Paul fuhr zusammen, als hätte der Teufel persönlich seinen Namen gerufen. Er riss das Messer hoch, ohne einen Feind zu entdecken dem er die Klinge in den Leib rammen konnte.
»Fabrice? Pierre?«
Eine Antwort erhielt er nicht, und das genügte schon, um den kalten Angstschweiß aus allen Poren ausbrechen zu lassen. Seine Finger zitterten, und alles in ihm schrie danach, dieses unselige Schiff sofort zu verlassen, doch er wollte seine Begleiter nicht einfach im Stich lassen.
Der Schrei war irgendwo unter Deck aufgeklungen. Eine dunkle Öffnung führte etwas abseits des Steuerrads in die Finsternis. Ohne Licht endete sein Sichtfeld schon nach wenigen Metern, weshalb er lediglich einige der schmalen, in die Tiefe führenden Stufen erkennen konnte.
»Was ist da unten los?«, rief er in die Dunkelheit hinein, und wieder blieb eine Reaktion aus.
Im Prinzip war ihm das schon Antwort genug, und die Ahnung, dass Fabrice und Pierre nicht mehr lebten, ließ ihn fast auf der Stelle erstarren. Was hätte er seiner Familie und seinen Freunden sagen sollen, wenn er ohne die beiden zurückkehrte? Schon allein deshalb musste er herausfinden, was mit ihnen geschehen war.
Er kam an einer halb geöffneten Tür vorbei, die er nur erkennen konnte, weil ein Lichtschein durch den Spalt fiel. Jean-Paul stieß sie auf und blickte in eine recht geräumige Koje mit einem Schlafplatz, einem Schreibtisch und einigen darauf ausgebreiteten Schriftstücken. Das Licht sickerte aus einem kleinen, völlig verschmutzten Fenster in die Kabine, die wahrscheinlich dem Kapitän gehört hatte.
Ohne eine Spur zu seinen Begleitern gefunden zu haben, setzte er seinen Abstieg fort. Zumindest erleuchtete das fahle Licht einen weiteren Teil der Treppe, die nun nach rechts in einen schmalen Gang abknickte und an zahlreichen weiteren, geschlossenen Türen vorbeiführte. Wieder konnte er das nur anhand einer schwachen, grauen, leicht pulsierenden Lichtquelle erkennen, die am Ende des Gangs aus dem mutmaßlichen Laderaum drang.
Es war so still, dass er jeden einzelnen seiner unzähligen Herzschläge hören konnte. Er war kein ängstlicher Mensch, doch jetzt war es ihm, als würden die Wände langsam auf ihn zu fahren, um ihn zu zerquetschen. Irgendwo dort vorne lauerte das Böse vor ihm, der Teufel oder ein Tor zur Hölle. Was es auch war, es sorgte dafür, dass er das Messer kaum mehr halten konnte, so sehr zitterte er.
Die unsagbare Kälte potenzierte sich noch einmal, als er zum ersten Mal in den unheilvollen Schein trat. Sehr langsam trat er vor die offene Doppeltür, hinter der sich der Laderaum befinden musste.
Die Ladung schien nur aus einer einzigen, etwa zwei Meter breiten und halb so hohen Truhe zu bestehen, deren Klappe geöffnet war und aus deren Inneren das unheimliche, pulsierende Licht strömte. Direkt vor ihr sah er Fabrice und Pierre wieder – oder das, was von ihnen übrig war. Er sah blanke Knochen, die in den Kleidungsstücken seiner Freunde lagen, und auch um sie herum entdeckte er zahlreiche Skelette.
»Herr im Himmel«, flüsterte er und bekreuzigte sich.
Wieder schrie ihm eine innere Stimme zu, sofort kehrtzumachen und auf der Stelle von hier zu verschwinden, und erneut tat er genau das Gegenteil. Diesmal war es die Kälte, die aus der Truhe hervorströmte, welche ihn nun magisch anzog. Er war nicht in der Lage, sich gegen diesen immensen Sog zu wehren, und doch gelang es ihm, seine Hände nach dem gewölbten Deckel auszustrecken.
Er blickte starr in die Truhe und sah den hässlichen, übergroßen und zugleich seltsam geformten Skelettschädel, der im Sekundentakt pulsierte. Ein gewaltiges Feuer wühlte sich durch seine Eingeweide, während es ihm mit letzter Kraft gelang, den Deckel nach unten zu drücken.
Dunkelheit legte sich über Jean-Paul Luc, der nun nicht mehr mitansehen musste, wie er nach und nach zu Staub zerfiel ...
»Das ist die Truhe, mein Herr. Man sagt, der Teufel persönlich würde in ihr wohnen. Eine Patrouille der königlichen Marine hat sie auf offener See auf einem verlassenen Schiff gefunden. Die Besatzung des arabischen Zweimasters und drei Fischer sollen bei dem Anblick des Inhalts gestorben sein, also seid vorsichtig.«
Armand de Maurisse, der grauhaarige Adlige, der sich dem jungen, unwissenden Diener in einem dunkelbraunen Mantel zeigte, lächelte schmal. »Keine Sorge, ich weiß schon, was ich tue«, entgegnete er mit ruhiger Stimme. »Du kannst jetzt gehen.«
»Ja, Herr.«
Nicht nur Armand sah dem Jungen und seinen beiden Helfern hinterher, wie sie den prunkvollen Hauptraum der Burg verließen. Auch Philippe, sein Sohn, beäugte sie kritisch. Er war noch jung, recht zierlich gebaut, aber genauso verschlagen wie sein Vater. Armand war sehr froh darüber, dass ihm seine letzte Frau noch einen würdigen, männlichen Erben geschenkt hatte.
»Wir sollten sie nicht so einfach gehen lassen«, gab Philippe zu bedenken. »Sie wissen zu viel.«
»Kümmere du dich darum. Ich werde solange die Kiste öffnen. Bis ich es dir wieder erlaube, wirst du nicht mehr diesen Raum betreten, verstanden?«
»Ja, Vater.«
Armand de Maurisse wartete, bis die Tür hinter seinem Sohn zugefallen war, bevor er auf dem weichen Teppich in die Knie sank. Man hatte ihm die Truhe und deren Inhalt angekündigt, allerdings wollte er ihn auch mit eigenen Augen sehen. Dank des Segens, den er vor einigen Jahren erhalten hatte, würde er in der Lage sein, das mächtige Artefakt anzusehen, bei seinem Sohn sah das dagegen anders aus. Er gehörte zwar inzwischen zum engeren Zirkel, war aber noch nicht so weit, die Weihe zu empfangen.
Die Truhe war nur provisorisch mit einigen Tauen verschlossen worden, um zu verhindern, dass jemand sie unbeabsichtigt öffnete. Dass sich in ihr tatsächlich etwas Übernatürliches befand, war nur ein Gerücht, da den Anblick des Schädels niemand überlebt hätte. Aber da er nun einmal die einzige Fracht des Schiffs gewesen war, musste es einfach so sein.
Mit einem Lächeln im Gesicht zog der den Deckel in die Höhe. Sofort wurde er von einem grauen, pulsierenden Schein erfasst, und mit ihm nahm er die ungeheure Macht wahr, die von dem Schädel ausging. Von der Form her hätte er auch einem längst ausgestorbenen Tier gehören können, womöglich sogar einem Drachen, doch Armand wusste es besser.
Die so zerstörerischen Strahlen konnten ihn – anders als einen normalen Menschen – nicht vernichten. Deshalb nahm er auch den grauen Flaum wahr, der wie eine neue Haut auf den Knochen lag. Und auch die Schriftrolle neben dem Skelettkopf war bisher sicher noch niemandem aufgefallen.
Armand zog sie in die Höhe und erkannte schnell, dass sie mit afrikanischen Schriftzeichen beschrieben worden war. Zumindest ähnelte sie denen, die er schon auf anderen geraubten Gütern gesehen hatte. Was der Autor mit seinen Worten ausdrücken wollte, blieb sein Geheimnis, denn er war dieser Sprache nicht mächtig. Dass die Rolle trotz ihrer trockenen, rissigen Oberfläche nicht längst auseinandergefallen war, glich einem Wunder – oder lag in einer weiteren, uralten Magie begründet.
Dass der Schädel bei ihm auftauchen würde, überraschte ihn nicht. Er war ihm bereits in der vergangenen Nacht von einer aus der Dunkelheit dringenden Stimme angekündigt worden. Diese Stimme war ihm sehr gut bekannt, da sie schon mehrmals zu ihm und seinem Zirkel gesprochen hatte. Sie gehörte zu einem Wesen, dessen Abbild als kleine Götzenfigur in einem Nebenraum der Burg ruhte – und als gewaltige Statue in einer Höhle an der Küste, wo sie auch die Opferfeste abhielten. In unruhigen Zeiten wie diesen fiel kaum jemandem auf, wenn auf dem Land hin und wieder einige Jungfrauen spurlos verschwanden ...
Noch hütete er sich davor, den Schädel in die Hand zu nehmen. Grundlos, natürlich, schließlich stand er unter dem Schutze einer mächtigen Gestalt, zugleich spürte er auch die Macht jenes Wesens, dem der Kopf einmal gehört hatte – und verstand zugleich, warum sich sein Meister für dieses Geschöpf so sehr interessierte.
So beließ er es dabei, seine Hand nach dem seltsam geformten Totenkopf auszustrecken und durch das graue Licht zu fahren. Für einen Augenblick schien es, als würden die Strahlen seine Haut bis auf die Knochen zerfressen, bis eine andere Macht einen Widerstand gegen die uralte Magie aufbaute. Armand nickte, schloss die Truhe wieder und richtete sich auf.
Sein Sohn war noch nicht zurückgekehrt, deshalb entschied er sich dazu, in einen anderen Raum der Burg zu treten. Dieser war in früheren Zeiten eine kleine Kapelle gewesen, deren Mauern über die Jahrhunderte in die Feste eingearbeitet worden waren. Noch immer waren das Schiff, der Chor und die kleine Apsis zu erkennen, und genau dort, auf der ehemaligen Altarplatte des ehemaligen Gotteshauses, ruhte eine etwa fünfzig Zentimeter große Figur.
Mit ihrem wulstigen Schädel, den beiden Hörnern und dem nach vorne gewölbten Maul erinnerte die Statue an einen aufrecht stehenden Drachen. Der voluminöse Körper war mit dunklem Fell bedeckt, wobei sich unterhalb des Mauls zusätzlich noch weiße Haare abzeichneten, die wie der Ansatz eines Barts wirkten. Für das dämonische Geschöpf, das für ihn mehr war als nur ein Götze, gab es zahlreiche unterschiedliche Darstellungsformen. Diese Statue hatte er vor Jahren in den Gewölben der Burg gefunden und sofort gespürt, dass in ihr etwas Besonderes steckte, das sein Leben grundlegend verändern würde.
»Du hast den Schädel erhalten«, drang die monotone, blecherne Stimme des Höllendämons Baphomet aus der kleinen Statue hervor.
»Ja, Meister.«
Armand de Maurisse deutete eine Verbeugung an und ging halb in die Knie. Er war ein Führer, ein Kämpfer und jemand, der nichts fürchtete, nicht einmal mehr den Tod. Es existierte nur ein Wesen, dem er einen derartigen Respekt zollte – eben Baphomet.
»Dann weißt du jetzt, welche Macht in diesem Geschöpf steckt.«
»Ja.«
Aus den Karfunkelaugen der Statue drang ein düsterer, blutroter Schein. »Dann wirst du dich auch an meine Worte erinnern, Armand de Maurisse«, fuhr Baphomet fort. »Dieser Schädel ist nur einer der vier Teile, aus denen dieses Wesen besteht. Man hat sie vor langer Zeit in alle Winde verstreut, und selbst mir fällt es nicht leicht, ihre Spur zu verfolgen. Eine dieser Spuren führt dorthin, wo du bald mit deinen Anhängern hinziehen wirst – ins sogenannte Heilige Land. Dort wirst du dich auf die Suche nach den Augen des Bösen begeben, mächtige Kristalle, die einmal zu dem Schädel in der Truhe gehört haben. Den Kopf selbst wirst du bis zu deiner Rückkehr von deiner Reise zurücklassen müssen, an einem Ort, an dem er viele Jahre geschützt überdauern kann. Erst, wenn es darum geht, den gesamten Körper wieder zusammenzusetzen, wird er für uns wieder von Bedeutung sein.«
»Ich werde deinen Worten folgen, großer Baphomet.«
»Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Und nun geh, metzele die Muselmanen nieder, die euch angeblich eurer Heiligtümer beraubt haben. Jede Seele, die deinem Schwert zum Opfer fällt, soll zu mir in die Hölle fahren. Erst wenn es dir gelingt, auch die Augen des Bösen in deinen Besitz zu bringen, wirst du in deine Heimat zurückkehren können. Vergiss das nicht, Armand ...«
»Nein, das werde ich nicht«, sagte der Burgherr, wobei er nicht wusste, ob Baphomet ihn überhaupt noch hörte. Das Licht in den Karfunkelaugen hatte sich zu diesem Zeitpunkt längst wieder zurückgezogen.
Armand de Maurisse wandte sich von der Statue ab, wissend, dass seine große Aufgabe gerade erst begann. Für die Truhe würde er sicher bald einen guten Platz finden, wahrscheinlich im Kloster Saint-Michele südlich von Narbonne, nicht weit von der Küste entfernt.
Frankreich, Gegenwart
Wie so oft schlich Fraire Robert durch das nächtliche Kloster, genoss es, wie das Licht des Mondes und der Sterne in den Kreuzgang fiel und das immerwährend aus dem Steinbrunnen hervorquellende Wasser inmitten des reich bewachsenen Gartens schimmern ließ. Die alten Mauern, in denen sich wie so oft die frische, salzige Meeresluft sammelte, schienen in diesen Momenten zu ihm zu sprechen.
Der alte Mönch lächelte milde, als er daran dachte. Mit dem Alter wurde er langsam wunderlich, sagten ihm seine Ordensbrüder oft nach, aber in Wirklichkeit begann er nur, mehr auf die Zeichen des Lebens zu achten, die den Jüngeren oft nicht auffielen. So wie die Kerzen, die auch in dieser Nacht in den ehrwürdigen Hallen brannten und wie die Seelen Verstorbener wirkten, die auf diese Weise über ihre Nachfolger wachten.
Das Kloster Saint-Michele blickte tatsächlich auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück, die nicht nur von seinem Orden, den Benediktinern, geprägt worden war. Kriegen und Plünderungen hatte es in den vergangenen Jahrhunderten getrotzt, und anders als viele andere Stätten ihrer Art war es nie zerstört oder gebrandschatzt worden. So war es den Ordensmitgliedern auch gelungen, viele wertvolle Schätze wie Reliquien, Monstranzen, Altäre oder auch unschätzbar wertvolle Spenden einstiger Adelshäuser für die Nachwelt zu bewahren. Viele dieser Kulturgüter waren an Museen verliehen, andere in einem Tresor im Keller aufbewahrt.
Dass manche inzwischen auch ihren Weg auf den freien Markt gefunden hatten, gefiel Robert nicht, aber die Zeiten waren eben schwer. Ein Kloster wie dieses lebte von Spenden, von Hilfszahlungen, und wenn diese ausblieben, musste nach anderen Wegen gesucht werden, um es zu erhalten. Die Mönche wurden älter und älter, während nur wenige junge Novizen ihren Weg zu Gott auf jene Weise suchten wie er vor über fünfzig Jahren.