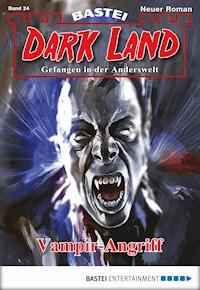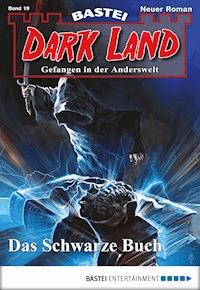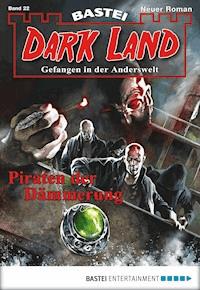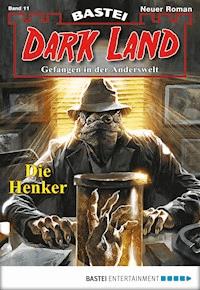1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Pfaffenwinkel ‒ eine herrliche Region in Oberbayern!
Aber hier gab es nicht nur Idylle und Natur! Da war auch ein See, der vor uralter Zeit "Totenmoor" genannt wurde. Und seit fast tausend Jahren lauerte in diesem abgelegenen Gewässer das Grauen! Nun kehrte es zurück in die Welt der Lebenden, um grausige Rache zu üben!
Meine Kollegin Dagmar Hansen vom deutschen BKA wurde mit diesem Grauen konfrontiert. Und sie rief mich, den Geisterjäger aus London, zu Hilfe. Zu zweit stellten wir uns mordenden Wiedergängern, einer uralten Hexe ‒ und der Macht aus der Druidenwelt Aibon!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Zurück aus dem Totenmoor
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Zurück ausdem Totenmoor
von Rafael Marques
Der alte Mann, der immer wieder die Ruder in das schwarze Gewässer gleiten ließ, sah fast nicht die Hand vor Augen. Der Nebel wallte als dichte, kühle, dunkelgraue Wand über dem Moor.
Seltsame Laute hallten durch die Düsternis. Eulen hockten auf den alten Eichen, als handelte es sich bei ihnen um gestaltgewordene Waldgeister. Sie schienen den Grauhaarigen dabei zu beobachteten, wie er das Boot in Richtung der Mitte des kleinen Moorsees paddelte.
Der umliegenden Bevölkerung war das Gewässer als Straußenlacke bekannt, ein friedliches Kleinod, eingebettet in eine von den Gletschern der letzten Eiszeit gebildeten Moor- und Hügellandschaft. Ein anderer, noch älterer Name lautete hingegen Totenmoor – und das wahrlich nicht ohne Grund ...
Der See lag einsam in der Nähe eines kleinen Waldstücks, umgeben von Borstgras- und Mähwiesen, und keiner der zahlreichen Rad- und Wanderwege des Pfaffenwinkels führte in seiner unmittelbaren Nähe entlang. So fristete der kleine See ein ruhiges Schattendasein, und manche seltene Tier- und Pflanzenart hatte hier einen Rückzugsort gefunden.
Zu diesen späten Stunden erweckte der See noch mehr als sonst den Eindruck, eine abgeschiedene eigene Welt zu sein, deren wahre Bedeutung den Menschen für immer verwehrt bleiben würde
Der Mann erschauderte. Hin und wieder glaubte er, in den dichten Nebelschwaden verzerrte Abbilder verlorener Seelen auszumachen, geisterhafte Erscheinungen, die ihn wie Irrwische umtanzten, nur um bald wieder in der Dunkelheit zu verschwinden. Sicher war das Einbildung, Halluzinationen, hervorgerufen von seinen überreizten Nerven, da ihm mehr als nur bewusst war, in was für einer gefährlichen Umgebung er sich befand. Zumindest zu einer Tageszeit wie dieser und mit der besonderen Fracht, die neben ihm im Holzboot lag.
Eine Leiche!
Eingewickelt in eine Decke. Nur Teile des bleichen Gesichts lagen frei. Der starre Blick der jungen Frau mit der bleichen Haut ließ dem Mann einen Schauer über den Rücken rieseln. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, was er hier eigentlich tat und ob es nicht besser wäre, die Dinge auf sich beruhen zu lassen, statt Kräfte heraufzubeschwören, die er nur ansatzweise verstand.
Doch jetzt, inmitten der Straußenlacke, gab es für ihn kein Zurück mehr. Mit jedem Atemzug nahm er die feucht-kühle, von Moosen und sich zersetzenden Pflanzen geschwängerte Luft in sich auf. Sie brachte zugleich einen Hauch dessen mit sich, was unter dem Wasser lauerte. Es war ein schwacher, dennoch vorhandener Verwesungsgeruch. Als der alte Mann in das Boot gestiegen war, hatte er ihn noch nicht wahrgenommen.
Er zog ein Blatt Papier aus seinem schwarzen Regenmantel und betrachtete die Worte darauf. Er hatte sie selbst niedergeschrieben, mit seinem eigenen Blut. Was dort stand, würde eine düstere Maschinerie in Gang setzen, die seit langer Zeit in dem feuchten Untergrund des Sees schlummerte.
Fast liebevoll strich er über das leblose Bündel hinweg und flüsterte dabei Worte in einer Sprache, die längst im Strudel des Vergessens versunken war. In seinen alten Knochen steckte noch genug Kraft, um den Körper der jungen Frau mit dem kurzen schwarzen Haar über Bord zu wuchten, was er auch tat, sodass die Leiche in das dunkle Wasser klatschte.
Einige Sekunden lang trieb sie an der Oberfläche des Sees. Was dann geschah, damit hatte der Mann gerechnet, trotzdem zuckte er geschockt zusammen, als die beiden Skelettarme aus dem Wasser hervorschossen.
Sie packten den in Decken gehüllten Leichnam und zogen ihn in die Tiefe.
Bald zeugten nur noch wenige kleine Wellen davon, was vor wenigen Sekunden noch hier geschehen war.
Mehrere Minuten tropften dahin, in denen der alte Mann lediglich in seinem Boot saß und dem leisen Klatschen der Wellen lauschte, die gegen den Unterboden des Boots schlugen.
Irgendwann nickte er, seufzte und ruderte zurück zum Ufer ...
Mit leerem Blick saß Vincent Hegl auf dem Traktor. Sekunden, Minuten, Stunden – wie viel Zeit verging, während er gedanklich zum hundertsten Mal in die Vergangenheit abtauchte, hätte er nicht zu sagen vermocht.
Jeglicher Antrieb, seine Motivation zu arbeiten, zu reden und zu lachen, alles war verloren. Sein ganzes Leben schien in einen finsteren Abgrund gerissen worden zu sein, aus dem es kein Entrinnen gab.
Vor einer Woche, als seine Welt noch in Ordnung gewesen war, hatte er mit Freunden auf der Kirchweih im nahen Obersöchering gefeiert. Ausgelassen und ohne Hintergedanken. Dabei gehörte er nicht eigentlich zu den geselligsten Menschen. An diesem Abend und in dieser Nacht aber ließ er sich gehen, sodass er nicht mehr in der Lage gewesen war, allein zum Hof seiner Familie zurückzukehren.
Um kurz nach Mitternacht war Marie gekommen, um ihn abzuholen. Was danach geschehen war, erschien vor seinem geistigen Auge von einem wabernden Nebel verhüllt, durch den entsetzliche Schreie hallten, ebenso das Bersten von Holz und das Kreischen von Metall. Der Wagen seiner großen Liebe war mit einer mächtigen Linde am Fahrbahnrand kollidiert. An die Geräusche erinnerte er sich noch, doch erst, als er im Krankenhaus aufgewacht war, wurden ihm deren Konsequenzen brutal vor Augen geführt.
Marie war offenbar sofort tot gewesen. Die Wucht des Aufpralls hatte ihr den Schädel gebrochen und mehrere Rippen gleich mit. Nur zu gut erinnerte er sich an seine verzweifelten Schreie, sein Jammern und sein Flehen danach, dass das alles nur ein schlimmer Albtraum war.
Seit dieser Nacht wünschte er sich, er wäre an Maries Stelle gestorben.
Dass er den Unfall wie durch ein Wunder quasi unverletzt überstanden hatte, betrachtete er als besondere Schande oder blanken Hohn des Schicksals. Nur wegen seines Rauschzustands war er überhaupt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Frau, die er schon kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag geheiratet hatte, war alles für ihn gewesen: die große Liebe, die beste Freundin, eine Seelenverwandte. Ihre gesamte Kindheit und Jugend hatten sie gemeinsam verbracht, weshalb ihren Eltern schon sehr früh bewusst geworden war, dass sie füreinander bestimmt waren.
Und nun war all das zerstört. All die Pläne, den Hof zu modernisieren, Ferienwohnungen einzurichten und Führungen anzubieten, waren ebenso an dem verfluchten Baum zerschellt wie ihr gemeinsamer Wunsch, baldmöglichst eine Familie zu gründen.
Angesichts dessen wollte ihm nicht in den Kopf, warum er so weitermachen sollte wie bisher. Der Gedanke, irgendwann wieder Fuß zu fassen, Marie zu vergessen und mit einer anderen Frau zusammenzukommen, kam ihm wie ein Verrat vor. Stattdessen dachte er insgeheim daran, ihr dorthin zu folgen, wo auch immer ihre Seele nun war.
Niemand wusste von diesen Plänen, natürlich auch nicht seine Eltern, obwohl die sich ohnehin schon große Sorgen um ihn machten.
»Vincent?«
Die Stimme war recht laut, trotzdem gelang es ihr nicht, zu ihm vorzudringen. Zu sehr haftete sein nur scheinbar leerer Blick auf dem Gesicht seiner geliebten Frau, ein Gesicht, das sich für alle anderen Menschen unsichtbar in Lebensgröße vor ihm manifestierte. Er bewegte sich so weit fernab der Realität, dass er sogar seinen Arm nach ihr ausstreckte.
Doch eine sanfte Berührung an seinem rechten Knie riss ihn in die Realität zurück. »Ich bin es, Vincent«, vernahm er endlich die Stimme seiner Mutter.
Er schaute zu ihr auf und sah ihre rot geränderten Augen. Zudem strich sie sich unbewusst über den Hals, als wollte sie sich von einer unsichtbaren Schlinge befreien.
»Hi, Mama«, sagte er wie ein kleines Kind, das gerade aus der Schule zurückgekehrt war. Er versuchte zu lächeln, brachte jedoch nur eine Grimasse zustande.
»Ich habe Angst, Schatz.«
Vincent schluckte. Zögerlich ergriff er die Hand der vierundsiebzigjährigen Frau mit dem dunkelbraunen Lockenhaar. Ebenso wie ihr Mann Friedrich opferte sie sich jeden Tag mit vollem Körpereinsatz für den Erhalt des Hofes auf. Sie litt genau so sehr wie er, vielleicht sogar noch mehr, da Marie nicht nur ihre Schwiegertochter gewesen war, sondern fast wie ein eigenes Kind.
»Wovor?«, fragte er, wobei sein Blick über sie hinweg zu dem zweistöckigen Wohngebäude glitt, in dem er sein gesamtes bisheriges Leben verbracht hatte. »Wovor sollten wir jetzt noch Angst haben?«
Seine Mutter drückte ihm die Hand noch fester, bevor sie antwortete. »Um dich«, stieß sie leise hervor. »Ich habe Angst, dich auch noch zu verlieren. Sieh dich nur an, wie du dasitzt und dich fragst, ob das Leben noch einen Sinn für dich hat. Du wünschst dir, bei Marie zu sein, doch das ist nicht mehr möglich. Nur der Herrgott ruft einen zu sich, wir selbst dürfen das nicht entscheiden.«
Ihr letzter Satz ließ darauf schließen, dass sie doch von seinen Selbstmordgedanken wusste oder sie zumindest erahnte.
»Bitte, Mama ...«
Miriam Hegl hob eine Hand und unterbrach ihn dadurch. »Nein, hör mir zu«, schnitt sie ihm das Wort ab. »Es ist eine harte Zeit für uns alle, und von jetzt auf gleich wird sich daran auch nichts ändern. Jeder von uns kämpft auf seine Weise darum, wieder zur Normalität zurückzufinden, was so kurz nach Maries Tod völlig absurd zu sein scheint. Nichts würde ich mir mehr wünschen, als dass sie plötzlich wieder vor unserer Tür steht und sagt, dass das alles nur ein böser Traum war. Aber das Schicksal müssen wir akzeptieren, so schmerzhaft das auch ist. Ich musste als junges Mädchen auch einsehen, dass meine Mutter nie wieder zurückkehren würde, als man sie eines Tages in ein Krankenhaus brachte. Daran, alles hinzuschmeißen und aufzugeben, habe ich nicht eine einzige Sekunde gedacht. Das war ich meinem Vater schuldig, und du bist das auch deiner Familie schuldig. Denk daran, dass du unser einziges Kind bist und wir uns darauf verlassen, dass du den Hof übernimmst.«
»Ja, ja, der Hof«, sagte Vincent nur, schüttelte den Kopf und wandte sich ab.
Er hörte seine Mutter scharf ein- und ausatmen. »Die Einladung von Pfarrer Huber hast du sicher vergessen, oder? In zwei Tagen ist die Beerdigung, er will noch einmal alles mit uns durchsprechen. Ich hatte gehofft, du würdest Friedrich und mich begleiten.«
Vincents Mundwinkel zuckten kurz, weil seine Mutter seinen Vater ihm gegenüber immer bei seinem Vornamen nannte. Sein wahrer Erzeuger war schon kurz nach seiner Geburt vom Hof verschwunden. Drei Jahre später hatte sie dann Friedrich Wimmer geheiratet, der auch ihren Namen angenommen hatte. Für Vincent war er der Vater, auch wenn das im Moment keine Rolle spielte.
Auch an die Beerdigung wollte er nicht denken, zumal er sie nicht einmal besuchen wollte. Nichts fürchtete er mehr, als – umgeben von zahllosen Freunden, Verwandten und Bekannten, die ihn sicher ununterbrochen nach seinem Gemütszustand ausfragen würden – auf den Sarg zu blicken, in dem Marie liegen würde, bis sich die Natur ihres Körpers annahm.
Nichts würde sie mehr lebendig machen, schon gar nicht eine sinnlose Trauerfeier. Die würde ihn nur noch einmal mit aller Härte mit der grausamen Realität und dem, was er angerichtet hatte, konfrontieren.
»Du kommst nicht mit, oder?«, fragte seine Mutter resigniert.
Erst jetzt sah er, dass sie nicht ihre übliche Latzhose trug, sondern ein schwarzes Kleid und Schuhe mit Absätzen, die so gar nicht zu ihr passen wollten.
»Nein«, sagte er nur und senkte den Blick.
»Bitte ...«
»Ich kann nicht!«
»Wir lieben dich, Vincent. Wir werden immer für dich da sein. Das weißt du doch hoffentlich, oder?«
Ein Nicken folgte, mehr brachte er nicht zustande.
Er sah seiner Mutter nach, wie sie zu ihrem Mann in den Wagen stieg und mit ihm vom Hof fuhr. Erst als der Wagen aus seinem Blickfeld verschwunden war, kam wieder so etwas wie Leben in seinen Körper.
Gedankenverloren schwang er sich von dem Traktor und begann, mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen über die Umgebung des Hofes zu spazieren.
Bis zu Maries Unfall hatten sie oft nach getaner Arbeit am Rand des Hofs gestanden und Arm in Arm melancholische Blicke über die sanfte Hügellandschaft des Pfaffenwinkels streifen lassen. Auch jetzt sah er die für diesen Landstrich so charakteristischen Kirchtürme, die weiten, von kleinen Waldstücken oder verstreuten Höfen und Weilern unterbrochenen Wiesen und auch die nicht allzu fernen Ausläufer der Alpen. Weit entfernt, am Ufer des Kochelsees, erhob sich der majestätische Herzogenstand, auf den sie beide oft gewandert waren, ebenso wie auf den deutlich einsameren, etwas weiter östlich gelegenen Rabenkopf.
Die Wanderungen hatten für ihn immer ein Stück Freiheit bedeutet und gezeigt, dass das Leben nicht nur daraus bestand, den Hof am Leben zu halten.
Die Gedanken sorgten dafür, dass sich die Eisenketten um sein Herz noch einen Deut enger spannten. Benommen wankte er zurück, bis er mit dem Rücken gegen die Außenwand des Stalls stieß, in den das Vieh längst zurückgetrieben worden war. Seine Eltern hatten diesen Job übernommen, immerhin war die Sonne bereits dabei, am Horizont zu versinken. Die Schatten der Nacht strichen schon über die Hügel und Drumlins, die Relikte der letzten Eiszeit, deren Spuren auch heute noch sehr präsent waren.
Nach und nach sank er an der Stallwand zu Boden, krampfte beide Arme um seine Brust und schloss die Augen.
Vincent merkte kaum, wie sein Körper versuchte, sich die Kräfte zurückzuholen, die er ihm in den vergangenen Tagen schuldig geblieben war. Obwohl er es gar nicht wollte, schlief er innerhalb kürzester Zeit ein.
Der laute Schrei eines Greifvogels riss Vincent wieder aus dem Schlaf. Benommen blinzelte er einige Male, bis er registrierte, dass die trüben Flecken vor seinen Augen kein Produkt seiner Müdigkeit waren, sondern Nebelschwaden, die von den feuchten Wiesen hinauf zu dem mehrere hundert Jahre alten Hegl-Hof trieben.
Stöhnend kämpfte er sich an der Wand in die Höhe. Offenbar war er tatsächlich eingeschlafen, und dass nicht nur einige Minuten, sondern mehrere Stunden. Womöglich ging es bereits auf Mitternacht zu, was ihn allerdings gewundert hätte, denn so lange wären seine Eltern wohl kaum beim Pfarrer Huber geblieben.
Seine Kleidung klebte vor Feuchtigkeit, und angesichts des kühlen Windes, der den Nebel vor sich hertrieb, konnte er sich leicht eine Erkältung einfangen.
Und wenn schon, dachte er, während er sich stumm in die Höhe kämpfte. Sollte er doch krank im Bett liegen. So wie er sich im Moment fühlte, hätte das auch keinen Unterschied mehr gemacht. Oft wusste er nicht einmal, warum er überhaupt noch aufstand und frühstückte, wenn er sowieso nur neben sich stehend über den Hof geisterte.
Mit müden Schritten schleppte er sich an dem Stall vorbei. Das Vieh schlief wohl, jedenfalls drang kein einziger Laut aus der großen Halle hervor.
In den typischen Tiergeruch mischte sich in dieser Nacht noch ein weiterer Gestank, der Vincent zumindest für kurze Zeit aus seiner Lethargie riss. Ein Hauch von Moder und Verwesung wehte über den Hof, wie im Moor, wenn er an besonders heißen Tagen einen Spaziergang durch die für Auswärtige unübersichtliche See- und Buschlandschaft unternahm. Womöglich sorgte der Nebel dafür, dass diese Geruchsnote bis hinauf auf den Hügel getrieben wurde.
Das Auto seiner Eltern stand nicht auf seinem Platz, also waren sie tatsächlich noch unterwegs. Ihm kam auch der Gedanke, dass sie auswärts übernachteten, um nicht mit seiner offen zur Schau getragenen Depression konfrontiert zu werden. Zum ersten Mal seit Maries Tod wurde ihm wirklich bewusst, wie sich sein Verhalten auf den Gemütszustand seiner Mitmenschen auswirkte. Jetzt, während er über alles nachdachte, erinnerte er sich an den verzweifelten Appell seiner Mutter, der einfach an ihm abgeprallt war.
Vincent bemerkte zunächst gar nicht, dass er das Wohnhaus längst erreicht hatte. Der massive Holz- und Steinbau erhob sich vor ihm wie ein düsteres Monument aus vergangener Zeit. Es war ihm völlig fremd geworden, kalt und abweisend. Trotzdem wohnte er immer noch hier.