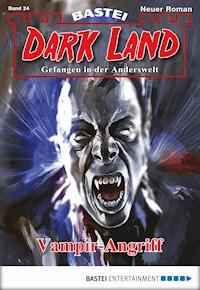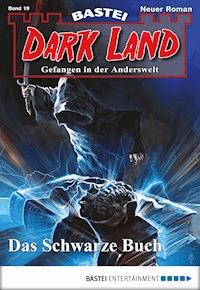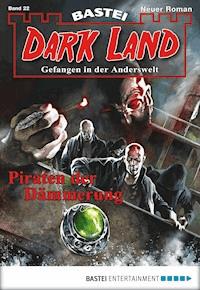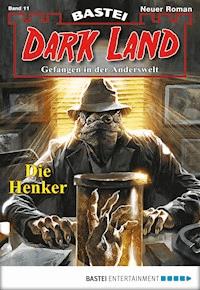1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Frachter verschwand spurlos in einem unnatürlichen Nebel vor der karibischen Insel Marie-Galante. Wochen später tauchte er wieder auf - verwittert, überwuchert von Meeresbewuchs. Und die Besatzungsmitglieder hatten sich in Zombies verwandelt! Suko und ich hörten in London von den unheimlichen Vorgängen, die der französische Geheimdienst zu vertuschen versuchte. Und wir erfuhren auch von einer Gruppe abtrünniger Templer, die vor Jahrhunderten in die Karibik geflohen war. Wir zögerten nicht und reisten auf die Insel Marie-Galante - und trafen dort auf die Diener des Dämons Baphomet!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Verlorenen von Marie-Galante
Grüße aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Die Verlorenen von Marie-Galante
(Teil 1 von 2)
von Rafael Marques
Wer meine Abenteuer liest, der weiß, dass ich mich dem Orden der Templer eng verbunden fühle. Ihr Anführer Godwin de Salier ist sogar ein guter Freund von mir und hat mich schon unzählige Male im Kampf gegen die Mächte der Finsternis unterstützt.
Doch es gibt auch eine Gruppe abtrünniger Templer, die den Götzen Baphomet verehren, den Dämon mit den Karfunkelaugen.
Als mein Partner Suko und ich in die Karibik reisten, um dort einen übersinnlichen Fall aufzuklären, trafen wir erneut auf die fanatischen Diener Baphomets!
Für Callum Conway war die Arbeit Routine. Ladungssicherung kontrollieren, das Deck sauber halten und darauf achten, dass sich keine ungebetenen Gäste Zugang zu den Containern verschafften. In seinen zwanzig Jahren auf See hatte er schon fast alles erlebt, sogar dreiste Diebe, die sich in einem Hafen auf dem Schiff versteckten, um am nächsten Hafen mit ihrer Beute an Land zu gehen.
Diesmal blieb alles friedlich, weshalb er die Momente der Ruhe nutzte, um seinen Blick über den Horizont schweifen zu lassen. Die Arbeit auf der ›Sun of the Sea‹, einem unter britischer Flagge fahrenden Frachter, brachte es mit sich, dass die Crew und er Gegenden bereisten, die für viele Touristen Traumziele darstellten. Und wenn er sie auch nur aus der Ferne betrachten konnte, die zahlreichen Inseln der Karibik waren ein Traum.
Ihre Reise führte von New York nach La Guaira, dem zur venezolanischen Metropole Caracas zählenden Hafen am nördlichen Ende Südamerikas. Im Moment befanden sie sich wenige Seemeilen von Dominica entfernt, südlich des französischen Übersee-Départements Guadeloupe. Die See war ruhig, allerdings war Callum längst aufgefallen, dass sie eine ungewöhnliche Route fuhren, da sie normalerweise Guadeloupe westlich umrundeten.
Ein wenig wunderte ihn das schon, immerhin erzählte man sich über diesen Bereich der Kleinen Antillen eine düstere Legende. Ähnlich dem, was über das berühmte Bermuda-Dreieck berichtet wurde, sollten hier in der Vergangenheit immer wieder Handelsschiffe verschwunden sein.
Gut, solche Geschichten hörte er in so manchen Regionen der Erde, auch vor der Küste Afrikas, wo sich besonders die Mär vom ›Fliegenden Holländer‹ hartnäckig hielt.
Als junger Mann war Callum von derartigen Sagen und Legenden fasziniert gewesen. Pioniere der Seefahrt, Abenteurer und Wagemutige, die spurlos in den Weiten des Meeres verschwanden, nie wiedergesehen wurden und Jahre später auf heruntergekommenen Zweimastern als Untote in die Welt der Lebenden zurückkehrten. Wiederum andere Schiffe fristeten ihr Dasein auf dem Meeresgrund und wurden manchmal von mutigen Tauchern entdeckt und geborgen, wobei sie dabei nicht nur Schätze an Land förderten, sondern auch die Geister der Vergangenheit.
Mittlerweile machte er sich um solche Dinge keine Illusionen mehr. Genauso wie um seinen Job, der ihn mit den Jahren einsam werden ließ. Aus Kostengründen arbeiteten auf den meisten Frachtern – auch auf der ›Sun of the Sea‹ – billige Lohnkräfte aus Südostasien, vornehmlich von den Philippinen. Wenngleich er mit ihnen meist gut zurechtkam, bestand immer eine persönliche und kulturelle Distanz, die sich nicht überwinden ließ.
Und so verbrachte er die ruhigen Tage der manchmal wochenlangen Fahrten allein oder in Gesprächen mit Lee Barringham, dem Kapitän des Frachters.
Lee war schon zur See gefahren, als Callum Conway noch grün hinter den Ohren gewesen war, und würde bald in den wohlverdienten Ruhestand gehen.
Genau ihn funkte Callum jetzt an, während sein Blick auf der Guadeloupe vorgelagerten Insel Marie-Galante hängen blieb. Dabei beobachtete er einige Seevögel, die sich vom Wind treiben ließen.
»Sag mal, warum nehmen wir nicht die übliche Route, Lee?«, fragte er. »Sind dir die Ausblicke zu langweilig geworden?«
Ein Lachen drang durch das kleine Gerät an Callums Ohr. »Das ist eine meiner letzten Fahrten, verflucht! Ich hab keine Lust mehr, mich nach ungeschriebenen Gesetzen zu richten, und ich fürchte mich auch nicht vor Seemannsgarn. Keine Sorge, es wird schon nichts passieren. Außerdem können wir uns den kleinen Umweg vorbei an Marie-Galante leisten.«
»Dein Wort in Gottes Ohr.«
Mit dieser Erwiderung war das kurze Gespräch beendet. Callum, der im kommenden November seinen fünfundvierzigsten Geburtstag feiern würde, hatte sich etwas Ähnliches bereits gedacht. Durch Lee wusste er von manchen ungeschriebenen Gesetzen, an die sich selbst die modernen Schiffskapitäne hielten, ob nun aus Tradition oder Aberglaube.
Seufzend passierte Callum Conway einen der riesigen Container, die nicht nur für Caracas, sondern für zahlreiche Ziele in Südamerika gedacht waren. Auch Wertfracht zählte diesmal wieder dazu, nur würden ihnen in diesem Jahrhundert keine Freibeuter mehr aus ihren Verstecken in der Karibik auflauern.
Mit beiden Armen lehnte er sich an die Reling und betrachtete den Horizont. Bald würde einmal mehr die Sonne im Meer versinken, auch ohne Wolken ein bezauberndes Schauspiel.
Obwohl er inzwischen kein Träumer mehr war, versuchte er, seine Reisen so gut es ging zu genießen. Die Arbeit in einem engen, lauten Büro wäre für ihn unvorstellbar, er brauchte diesen Hauch von Freiheit, wenngleich die Arbeit auf einem Frachter wahrlich nicht nur aus Abenteuern und dem Betrachten schöner Landschaften bestand.
Noch ehe der glühende Ball hinter den Wellen verschwand, wandte er sich kurz ab. Eigentlich wollte er nur nachsehen, ob er noch allein war, doch der Anblick, der sich ihm nun bot, ließ sein Interesse am Sonnenuntergang schlagartig erlöschen.
Jenseits des Bugs breitete sich in wenigen Seemeilen Entfernung eine dunkelgraue Wolke aus, die sich zuvor noch nicht dort befunden hatte. Natürlich zog selbst in der paradiesischen Karibik gelegentlich Nebel auf, nur nicht so plötzlich und unerwartet.
Während er sich in Richtung Bug begab, funkte er erneut den Kapitän der ›Sun of the Sea‹ an, der von der Kommandobrücke eine weitaus bessere Sicht auf die umliegenden Gewässer hatte.
»Siehst du das auch, Lee?«, sprach Callum in sein Funkgerät.
»Ja, Nebel. Und?«
»Also hör mal, vor ein paar Minuten war da noch keine Wolke.«
Trotz der mäßigen Verbindung war der Seufzer des Kapitäns nicht zu überhören. »Er kam schon ziemlich unerwartet, ja, aber was willst du jetzt von mir hören? Dass wir sofort kehrtmachen sollen, weil der Nebel uns sonst das Fleisch von den Knochen frisst?«
Callum lag es auf der Zunge, Lee von einer Geschichte zu erzählen, die ihm einmal in einer Bar am Hafen von London zu Ohren gekommen war. Laut dieser sollte so etwas vor vielen Jahren tatsächlich auf einer Bohrinsel in der Nordsee geschehen sein.
»Du willst also mitten durch die Wolke«, stellte er stattdessen fest.
»So sieht es aus«, bestätigte Lee. »Oder hast du Angst vor der alten Legende?«
»Das nicht ...«
»Also, stell dich nicht so an. Wir sind schließlich beide erwachsen und ich bald Rentner. Gönn einem alten Mann einen Hauch von Abenteuer.«
Callum verdrehte die Augen und beendete das Gespräch.
Was hatte er sich überhaupt dabei gedacht, Lee anzufunken? Im Nachhinein schallt er sich einen Narren dafür, immerhin lief alles darauf hinaus, dass er eben doch dieses Seemannsgarn nicht aus dem Kopf bekam. Natürlich handelte es sich bei der Nebelwolke lediglich um ein seltsames Naturphänomen.
Statt zum Bug zu gehen und den Nebel genauer in Augenschein zu nehmen, lehnte er sich wieder über die Reling und beobachtete die Sonne dabei, wie sie endgültig hinter dem Horizont versank. Ihr intensiver Schein würde natürlich noch eine ganze Weile bestehen bleiben und dem Betrachter eine melancholisch-nachdenkliche Atmosphäre schenken.
Das änderte sich, als der Frachter durch die ersten Nebelschwaden glitt. Callum wunderte sich ein wenig, dass er weder zu frösteln begann noch die in der Luft liegende Feuchtigkeit auf seiner Haut verspürte. Nicht einmal einen Luftzug registrierte er, als würde er sich in einem Vakuum befinden, das selbst das Rauschen des Wassers dämpfte.
Kurze Zeit später war der Nebel bereits so dicht, dass er nicht einmal mehr die Hand vor Augen sah.
»Lee, verflucht, wo hast du uns hingesteuert?«, murmelte er und war versucht, erneut das Funkgerät zu betätigen, doch es kam keine Verbindung zustande.
Plötzlich hörte er einen entsetzlichen Schrei über das Deck hallen. Wahrscheinlich war es einer der Philippinen. Er brüllte sich die Seele aus dem Leib, bis er schlagartig verstummte.
»Was ist los, verflucht?«, rief Callum Conway in das Grau hinein. »Hört ihr mich?«
Eine Antwort erhielt er nicht. Dafür glaubte er, eine fremde Hand auf seiner Schulter ruhen zu spüren, und als er sich umdrehte, begann er selbst zu schreien ...
50 Seemeilen vor Marie-Galante, vier Wochen später
»Champagner, bitte!«
Einer ihrer ganz in Weiß gekleideten Crewmitglieder trat an ihre Seite und schenkte ihr ein Glas des sündhaft teuren Getränks ein, bevor er eine leichte Verbeugung andeutete und ihr das Glas reichte.
Die Frau lächelte den Mann an, von dem sie wusste, dass er gerne ein wenig übertrieb. Gut, er mochte für sie arbeiten, trotzdem war sie weder eine mondäne Adelige noch eine Sklaventreiberin.
Estelle Lacroix nannte sich selbst eine ›Abenteurerin aus Langeweile‹. Sie reiste um die Welt und suchte spektakuläre, mystische, geheimnisvolle und manchmal auch gefährliche Orte auf.
Geld genug stand ihr schließlich zur Verfügung, deshalb tat sie es auch nicht für den horrenden Finderlohn, der Hobby-Forscher, Kryptologen und Abenteurer aus der ganzen Welt anzog.
Vor vier Wochen war ein Frachter vor der Küste von Marie-Galante, einer zum französischen Übersee-Département Guadeloupe gehörenden Insel, spurlos verschwunden. Die ›Inseln über dem Wind‹, wie dieser Teil der Kleinen Antillen auch genannt wurde, waren immer eine Reise wert, aber nun zog eine spektakuläre Geschichte Menschen aus Nah und Fern in ihren Bann.
Nun, das öffentliche Interesse war schon ein wenig abgeebbt, nachdem die großangelegten, von den Vereinigten Staaten und Frankreich geführten Suchmaßnahmen ergebnislos abgebrochen worden waren. Ein riesiger Frachter voller Container verschwand normalerweise nicht einfach so, dennoch war es, als wäre er schlagartig aus dieser Welt gerissen worden.
Verschwörungstheoretiker und Sensationshungrige ließen sich jedoch nicht so leicht davon abbringen, nach dem ›Schatz‹ zu suchen, der mit dem Frachter verschwunden sein sollte. In einem der Container – so hieß es – hätte ein kürzlich verstorbener Milliardär Goldbarren im Wert von hundert Millionen US-Dollar aus den Vereinigten Staaten nach Südamerika schaffen wollen, bevor sein Erbe von den Behörden seiner Heimat beschlagnahmt wurde.
Ob das stimmte oder nicht, war für Estelle zweitrangig. Sie zog vielmehr die Aufregung an, dass hier Kräfte existierten, die außerhalb des menschlich Fassbaren lagen. Ein Teil von ihr wünschte sich sogar, ebenfalls in eine andere Welt gesogen zu werden, um dort eine bestimmte Person wiedersehen zu können.
Seufzend lehnte sie sich über die Reling und blickte in das blaue Meerwasser. Dabei schwenkte sie das Glas hin und her und überlegte, ob sie den Champagner einfach wegschütten sollte. Schließlich entschied sie sich, ihre Sinne ein wenig zu berauschen, bevor der depressive Schub sie wieder einholte.
Sie war jetzt dreiundvierzig Jahre alt, und nur dank sündhaft teurer Kosmetik gelang es ihr, die Zeichen der Zeit vor der Welt zu verstecken. Womöglich wäre ihr das eher gelungen, hätte nicht eine tonnenschwere Last auf ihrer Seele gelegen, die sie jede verfluchte Nacht quälte. Der Schmerz ließ sich weder durch Alkohol noch durch alles Geld der Welt vertreiben.
»Es dämmert langsam, Mademoiselle Lacroix«, sprach sie der ›Kapitän‹ ihrer Yacht an, bei dem es sich um den aus Guadeloupe stammenden Touristenführer Jean Belmont handelte. Er war ungefähr in ihrem Alter, braun gebrannt und ziemlich redegewandt.
Sie konnte nicht verhehlen, dass sie sich ein wenig zu ihm hingezogen fühlte, auch weil sie hinter der aus einem verschmitzten Lächeln bestehenden Fassade ähnliche, verborgene Qualen wie ihre eigenen zu erkennen glaubte.
»Sie meinen, wir sollten zurückfahren?«, fragte Estelle. Es stimmte, das Wasser spiegelte bereits den rötlich-gelben Schein der untergehenden Sonne, die längst hinter dem Horizont versunken war.
»Es zieht Nebel auf.«
Ein Schauer lief über Estelles Körper. Sie kannte alle Einzelheiten, die über das Verschwinden der ›Sun of the Sea‹ bekannt waren. Die Uhrzeit, die exakte Position des Schiffes, die Namen der Besatzungsmitglieder – und auch, dass mehrere Zeugen auf Marie-Galante von einem plötzlich aufziehenden Nebel in diesem Bereich des Meeres berichtet hatten, der sich von keiner Wetterstation verifizieren ließ.
Am dritten Tag in Folge trieb die Yacht nun schon in dem Gebiet, in dem der Frachter zum letzten Mal geortet worden war.
Die beiden anderen Mitglieder der Crew beschäftigten sich damit, das Büffet einzupacken.
Estelle spürte den kalten Luftzug, der von Süden her in ihre Richtung wehte. Sie war lediglich mit einem weißen Ganzkörper-Badeanzug bekleidet. Jean legte ihr die Jacke seiner Kapitänsuniform um die Schultern.
»Das ist kein normaler Nebel«, erklärte er und deutete auf eine über der Wasseroberfläche treibende Wolke, die bereits eine Fläche von mehreren tausend Quadratmetern bedeckte und sich immer weiter auszubreiten schien. »Vor wenigen Minuten war davon noch nichts zu sehen. Außerdem zieht hier vor einem Gewitter kein Nebel auf.«
Estelle drängte sich näher an Jean Belmont, ohne dass er es wagte, die Situation auszunutzen. »Was glauben Sie, ist das dann?«, fragte sie aufgeregt. »Ein Wetterphänomen?«
»Der Hort der Verlorenen«, murmelte der Kapitän.
Seine Worte ließen die Millionärin erschaudern. Ihr war die Legende, die man sich über das Gebiet zwischen Guadeloupe und Dominica erzählte, ebenfalls bekannt. Die allein wäre schon ein Grund gewesen, an diesen Ort zu reisen, um ihren Wahrheitsgehalt zu erforschen. Gepaart mit dem Verschwinden des Frachters konnte Estelle ihre Aufregung diesbezüglich kaum im Zaum halten.
»Glauben Sie daran?«, fragte sie den Franzosen.
»Viele Leute sagen ja, sie würden nur an das glauben, was sie auch sehen können. Lange habe ich nach diesem Motto gelebt, aber eines Tages hat sich mein Blick auf diese Welt verändert. Ich denke, wenn man fühlt, dass etwas da ist, dann existiert es auch. Diese Erkenntnis hat mich gerettet, denn jetzt fühle ich mich nicht mehr allein.«
»Jean ...«
Etwas in ihr drängte Estelle dazu, ihn zu umarmen und sich an ihn zu schmiegen, so sehr sprach er ihr aus der Seele.
Die Ereignisse, die sich wenige Kilometer von ihnen entfernt abspielten, lenkten ihre Gedanken jedoch schnell in eine andere Richtung. Nicht nur, dass die Nebelwolke inzwischen zu einer Breite von mehr als zehn Seemeilen angewachsen war, in ihr bewegte sich auch etwas. Ein gewaltiger Schatten, der von Sekunde zu Sekunde deutlicher zum Vorschein trat.
Der Anblick sorgte dafür, dass sich Estelle noch enger an Jean Belmont drängte. Der ließ es nicht nur zu, sondern legte auch den rechten Arm um ihre Schultern.
»Er ist nicht erschienen, um uns zu holen«, murmelte er.
»Warum dann?«
Jean deutete mit seinem Kinn nach vorn.
Aus dem Nebel schälten sich inzwischen deutlich die Umrisse des vermeintlichen Schattens hervor, bei dem es sich in Wahrheit um ein Schiff handelte.
Jean Belmont reichte Estelle sein Fernglas, und bald darauf erkannte sie den Schriftzug knapp unterhalb des Bugs.
»Sun of the Sea«, presste sie geschockt hervor.
»Die Verlorenen kehren zurück«, hörte Estelle Jean wie aus weiter Entfernung sagen.
Der Anblick des Schiffes raubte ihr den Atem und ließ sie innerlich frieren. Dabei war es genau dieses Ereignis, auf das sie so gehofft hatte. Etwas, das den Rahmen der Realität sprengte und das Tor in eine andere Welt öffnete.
Eine leise Stimme in ihrem Kopf rief ihr zu, das Ruder zu übernehmen und die Yacht mitten hinein in den Nebel zu steuern. Allein, es fehlte ihr der Mut. Zu sehr war sie von dem Erscheinungsbild des Frachters fasziniert, der aussah, als hätte er die vergangenen Wochen auf dem Grund des Meeres verbracht.
Das riesige Ungetüm trug weiterhin seine aus unzähligen Containern bestehende Last, nur schienen einige von ihnen verrutscht zu sein. Einige fehlten auch, sie mussten heruntergefallen sein.
Während an ihnen lediglich Schmutz klebte, war der Bug übersät von Algen, Seetang, Muscheln und sogar Korallen.
Ein unmöglicher Anblick, immerhin bedeutete er, dass das Schiff nicht nur auf Grund gelaufen, sondern auch versunken war. Fragte sich nur, wie es dann wieder an die Oberfläche gelangt war und jetzt ...
Estelles Gedanken brachen ab, denn das Schiff trieb nicht nur aus dem Nebel, sondern rauschte mit voller Fahrt heran. Zu schnell für die geladenen Container, deren Sicherungen nicht mehr zu existieren schienen. Mehrere dieser tonnenschweren Behältnisse stürzten ins Meer.
»Würde ich noch an Gott glauben, würde ich mich jetzt bekreuzigen«, flüsterte Jean, der seine Arbeitgeberin weiterhin festhielt, als wolle er sie beschützen.
»Was meinen Sie?«