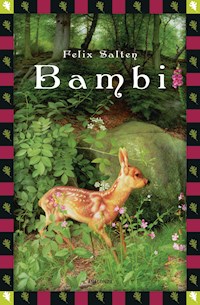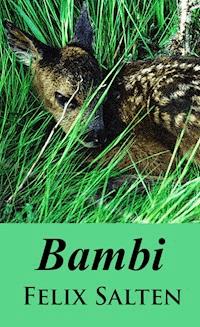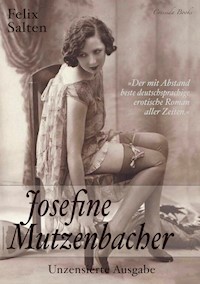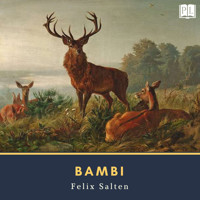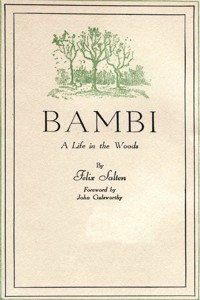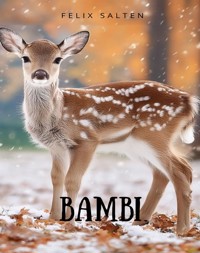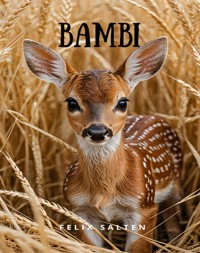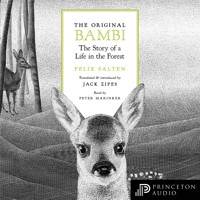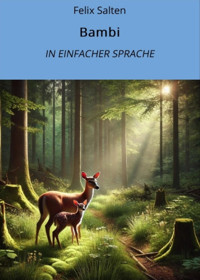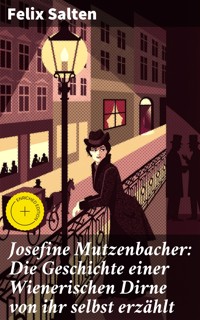
Josefine Mutzenbacher: Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt E-Book
Salten Felix
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In "Josefine Mutzenbacher: Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt" entführt Felix Salten die Leser in die pulsierende Welt des Wiener Rotlichtmilieus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Erzählung präsentiert sich als autobiografische Reflexion der Protagonistin Josefine Mutzenbacher, die mit ungeschönten Einblicken und einer ausgefeilten, sprachlich brillanten Ausdrucksweise die Facetten ihrer Sexualität und ihre Lebensumstände offenbart. Zugleich thematisiert das Werk gesellschaftliche Konventionen und die dahintersteckenden Doppelmoral einer Epoche, die durch eine entfesselte Neugier und einige Tabubrüche geprägt ist. Salten gelingt es, einen literarischen Kontext zu schaffen, der sowohl unterhaltsam als auch provokant ist, und der das Werk zu einem einzigartigen Zeitdokument erhebt. Felix Salten, ein österreichischer Schriftsteller und Journalist, bekannt geworden durch seine vielfältigen Werke und seine scharfsinnigen Beobachtungen der Gesellschaft, bringt in diesem Buch seine persönlichen Erfahrungen und seine kritische Sichtweise auf die Wiener Gesellschaft ein. Geboren 1869 in Budapest, hat Salten ein tiefes Verständnis für soziale Dynamiken entwickelt, geprägt durch seine Zeit als journalistischer Chronicler. Seine literarische Kunstfertigkeit und seine Fähigkeit, das damalige Wien in all seinen Widersprüchen darzustellen, verleihen der Erzählung einen authentischen und packenden Charakter. Dieses Buch ist nicht nur ein scharfer Kommentar zur Geschlechterrolle im Wien des Fin de Siècle, sondern auch ein faszinierender Zugang zu den verborgenen Aspekten der menschlichen Natur. Es empfiehlt sich sowohl für Literaturinteressierte, die das Spannungsfeld zwischen Ethik und Erotik erkunden möchten, als auch für jene, die ein tieferes Verständnis für die gesellschaftlichen Strukturen des damaligen Österreich erlangen wollen. Erleben Sie Josefine Mutzenbacher und lassen Sie sich von ihrer Geschichte fesseln. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Josefine Mutzenbacher: Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen Geständnis und Gesellschaftspanorama entfaltet sich eine Erzählung, die Intimität als Zumutung, Begehren als Ware und das Selbst als Bühne einer Stadt verhandelt, deren Glanz und Elend unauflöslich ineinandergreifen, so dass der vermeintlich private Bericht zur Anatomie eines Milieus wird, in dem Sprache, Körper und Blickregime um Deutungshoheit ringen, während die Grenzen zwischen Selbstbestimmung und Ausbeutung, Verführung und Überleben, Scham und Schaustellung fortwährend verschoben werden und der Leser zugleich Zeuge einer individuellen Stimme wie auch einer schonungslosen, bisweilen satirischen Bestandsaufnahme des Wiener Alltags an der Wende zur Moderne bleibt und mit ihr die Ambivalenzen einer ganzen Epoche.
Das Werk ist ein erotischer Roman und zugleich eine Milieustudie, deren Schauplatz das Wien um 1900 ist; erstmals erschien es 1906 anonym in Wien und wird häufig Felix Salten zugeschrieben, ohne dass diese Autorschaft abschließend belegt wäre. Der Text nutzt die Form eines autobiografischen Berichts, der angeblich von der Titelfigur selbst stammt, und knüpft damit an zeitgenössische Vorlieben für Bekenntnisliteratur und Großstadtprosa an. Zwischen Vorstadt und bürgerlichen Bezirken, zwischen Vergnügungsorten und Elendsquartieren entsteht ein literarisches Stadtpanorama, das auf Reiz und Realismus setzt und in seiner anonymen Veröffentlichung bereits den Nimbus des Skandalösen und des Verbotenen mitträgt.
Ausgangspunkt ist die Stimme einer jungen Frau aus ärmlichen Verhältnissen, die rückblickend ihren Weg ins Wiener Rotlichtmilieu schildert und damit zugleich in eine Welt der engen Wohnungen, der Hinterhöfe und der öffentlichen Lustbarkeiten einführt. Der Ton ist direkt, ironisch und lebensnah; er mischt derbe Umgangssprache mit pointierter Beobachtung und erzeugt eine Nähe, die zugleich fasziniert und verstört. Als Ich-Erzählung entfaltet der Text einen rhythmischen Sog, der Szenen bündig skizziert, Figuren mit wenigen Strichen charakterisiert und die Stadt zum eigentlichen Mitakteur macht, ohne dabei in bloße Sozialreportage zu verfallen. Dabei wahrt die Erzählung trotz Milieugenauigkeit eine deutlich subjektive Linie.
Im Zentrum stehen Fragen nach Machtverhältnissen, sozialer Herkunft und der Ökonomisierung von Intimität: Körper erscheinen als Ressource, Blickbeziehungen als Währung, Sprache als Verhandlungsraum. Das Buch zeigt, wie soziale Mobilität und Verletzbarkeit miteinander verknüpft sind, und wie Geschlechterrollen zwischen Inszenierung und Zwang changieren. Dabei reflektiert die Erzählung fortwährend, wie Selbstbehauptung in einer Umgebung möglich ist, die von Regeln, Preisen und Erwartungen strukturiert wird. Gerade diese Analyse von Tauschlogiken, Klassenunterschieden und Inszenierungsstrategien macht den Text über sein skandalöses Image hinaus zu einer dichten Studie urbaner Moderne. Sie benennt Ambivalenzen, ohne sie aufzulösen, und lässt so moralische Urteile bewusst in der Schwebe.
Die fingierte Autobiografie behauptet Authentizität und lebt zugleich von Konstruktion: Indem die Erzählinstanz beständig Nähe erzeugt, bleibt doch spürbar, dass hier eine literarische Maske spricht. Die anonyme Veröffentlichung und die ungeklärte Zuschreibung tragen zu einem Leseerlebnis bei, das zwischen Dokument und Inszenierung balanciert. Dialektfärbungen, Wiener Redensarten und szenische Verdichtung geben dem Text einen spezifischen Klang, der die Figurenwelt plastisch macht und den sozialen Raum musikalisch rhythmisieren kann. Dieses Spiel mit Stimme und Rahmenbedingungen lädt dazu ein, über Perspektive, Autorität und die Bedingungen des Erzählens nachzudenken. Auch darin liegt eine Quelle der anhaltenden Irritation und Faszination.
Stilistisch verbindet das Buch drastische Anschaulichkeit mit komödiantischer Zuspitzung und satirischer Schärfe, wodurch Milieus, Gesten und Rituale der Stadt anschaulich hervortreten. Die Szenenführung ist episodisch, die Sprache ökonomisch und pointiert; oft genügt ein sozialer Hinweis oder eine räumliche Markierung, um Machtgefälle und Erwartungen sichtbar zu machen. Gleichzeitig wird Wien als Labyrinth der Gelegenheiten gezeichnet, in dem Regeln ständig getestet und Grenzen beständig neu gezogen werden. Diese Mischung aus Tempo, Beobachtung und ironischer Distanz erzeugt ein Doppelbild, das zwischen Entzauberung und Verführung oszilliert, ohne die Ambivalenz der Figuren glattzubügeln. So entsteht literarische Spannung ohne selbstzweckhafte Effekthascherei.
Heutige Leserinnen und Leser finden darin ein historisches Dokument der Großstadtkultur und zugleich einen Prüfstein aktueller Debatten über Einvernehmen, Darstellung, Kommerzialisierung und die Macht des Blicks. Die Lektüre fordert kritische Aufmerksamkeit, weil sie ästhetische Virtuosität mit problematischen Mustern verbindet, die reflektiert werden wollen. Wer das Buch in seinem Kontext ernst nimmt, entdeckt neben dem Reiz des Skandalons eine Erkundung von Sprache, Klasse und Geschlecht, die Fragen stellt, die bis heute nicht erledigt sind. So bleibt die Erzählung relevant: als provokantes Stück Literaturgeschichte und als Spiegel, der Wahrnehmungen und Vorurteile produktiv irritiert.
Synopsis
Das Werk erzählt in der Ich-Perspektive den Lebensweg der Wiener Protagonistin, die rückblickend schildert, wie sie aus einfachsten Verhältnissen zur bekannten Figur des Vergnügungsviertels wird. In nüchternem Ton, durchsetzt mit Ironie, verbindet die Erzählung persönliche Erinnerungen mit einem Panorama des Wien um die Jahrhundertwende. Von Beginn an wird deutlich, dass soziale Herkunft, ökonomischer Druck und die Blicke der Umwelt ihren Werdegang prägen. Der Bericht ist als selbstbewusste Lebensbeichte gestaltet: Sie ordnet Episoden, bewertet sie knapp und deutet an, was sie verschweigt. So entsteht ein Rahmen, der weniger auf Sensation zielt als auf Beobachtung gesellschaftlicher Mechanismen.
Die frühen Kapitel zeichnen ein Bild von Enge, Armut und sozialer Kontrolle in den Mietskasernen, in denen sie aufwächst. Die Erzählerin beobachtet Erwachsene und lernt, wie Beachtung, Anerkennung und Zuneigung an Erwartungen und Gegengaben geknüpft sind. Bereits hier tauchen Grenzverletzungen und ambivalente Begegnungen auf, die sie nüchtern registriert, ohne sie ausführlich zu kommentieren. Gleichzeitig beschreibt sie, wie religiöse und bürgerliche Moral mit den Zwängen des Alltags kollidieren. Daraus entwickelt sie ein instinktives Verständnis für Rollen, Hierarchien und die Bedeutung von Sprache, Kleidung und Auftreten, die ihr später helfen, Situationen einzuschätzen und Chancen zu nutzen.
Mit dem Übergang zur Jugend erweitert sich ihr Radius: Straßen, Hinterhöfe und Vergnügungsorte werden zu Lernfeldern, in denen sie Beobachtungsgabe, Schlagfertigkeit und Anpassung trainiert. Bekanntschaften mit älteren Bekannten und vermeintlichen Beschützern öffnen Türen, aber auch Abhängigkeiten. Ein Wendepunkt liegt in der pragmatischen Entscheidung, aus der Nachfrage nach Gesellschaft und Nähe ein Auskommen zu machen. Die Motive sind weniger romantisch als ökonomisch und sozial begründet. Die Erzählerin betont, wie sie Regeln aushandelt, Grenzen definiert und Tarife, Räume sowie Zeiten bestimmt. Damit beginnt ihre bewusste Rollenübernahme als Akteurin im Schatten der offiziellen Moral.
Die weiteren Episoden entfalten eine Stadtszenerie, in der Kundschaft, Mittelsleute und Neider aus allen Schichten auftreten. In wechselnden Milieus verhandelt sie stets neu, wer Macht besitzt und wer Bedarf hat. Die Erzählung legt die Widersprüche bloß: öffentliche Tugend, private Doppelmoral, Distinktion nach außen, heimliche Abhängigkeiten dahinter. Sie trifft auf Wohlwollen, Berechnung, Eifersucht und Drohkulissen; Gefahren werden angedeutet, ohne ausgespielt zu werden. Gleichzeitig markieren Umgangsformen, Geld und Wohnorte Grenzen der Zugehörigkeit. Behörden, Wirte und Hausmeister setzen Regeln, die sie kreativ umgeht. So zeichnet der Text ein bewegliches Geflecht aus Kontrolle, Kommerz und improvisierter Selbstbehauptung.
Besonders prägnant ist die Stimme der Erzählerin: ein Mix aus lakonischer Direktheit, Wiener Tonfall und kalkuliertem Witz. Sie arrangiert Erinnerungen zu Miniaturen, die gleichzeitig unterhalten, enthüllen und beschönigen können. Immer wieder verschiebt sie Perspektiven, deutet Motive um und präsentiert sich als kluge Taktikerin, ohne Leid oder Verletzlichkeit in den Mittelpunkt zu rücken. So entsteht der Eindruck einer performativen Autobiografie, in der Selbstdarstellung Teil der Überlebensstrategie ist. Der Text spielt mit Authentizität und Inszenierung und lässt offen, wann er Protokoll liefert und wann er Legende produziert, was die Lesart produktiv ambivalent hält.
In späteren Passagen verdichten sich Fragen nach Sicherheit und Aufstieg. Die Erzählerin sucht beständige Arrangements, verhandelt mit Förderern und navigiert Gerüchte, Eitelkeiten und Rivalitäten. Beziehungen zu anderen Frauen schwanken zwischen Solidarität und Konkurrenz, wobei geteilte Erfahrungen ein stilles Verständnis stiften. Zugleich werden Altersangst, ökonomische Schwankungen und Gesundheitsrisiken als latente Bedrohungen spürbar, ohne ausgesponnen zu werden. Wien bleibt die Bühne: Straßen, Wohnungen und Lokale strukturieren Chancen und Grenzen. Der Text zeigt, wie Imagepflege, Diskretion und Routine zur Arbeit gehören und wie zerbrechlich das Gleichgewicht zwischen Sichtbarkeit und Schutz sein kann. Zuweilen blitzen Wünsche nach Privatheit und Ruhe auf.
Im Ganzen lässt sich der Roman als schonungslose, doch analytische Studie der Verflechtungen von Sexualität, Geld und sozialer Ordnung lesen. Er entlarvt Doppelmoral und zeigt, wie Körper, Sprache und Emotionen ökonomisiert werden, ohne die Erzählerin auf einfache Rollen festzulegen. Gerade die Spannung zwischen Selbstermächtigung und Ausbeutung, zwischen Pragmatismus und Verletzlichkeit, verleiht dem Text seine nachhaltige Wirkung. Zugleich bleibt das Werk umstritten, weil es Tabus berührt und Grenzen des Darstellbaren testet. Es fordert dazu auf, Machtverhältnisse und Moralbegriffe zu hinterfragen und die Mechanismen zu erkennen, die Menschen in Rollen drängen, die sie später virtuos bedienen.
Historischer Kontext
Um 1900 war Wien, Hauptstadt der k.u.k. Monarchie unter Kaiser Franz Joseph I., ein rasch wachsendes Zentrum von Verwaltung, Militär, Universität und Kirche. Nach der Dezemberverfassung von 1867 war die formelle Vorzensur zwar abgeschafft, doch Polizei- und Strafrecht überwachten weiterhin „Sittlichkeit“ und öffentliche Ordnung. Die Stadt war geprägt von der Ringstraßenmoderne, einem ausgebauten Beamtenapparat, der Sitten- und Sanitätspolizei, mächtigen katholischen Institutionen, einem dichten Pressewesen und der Kaffeehauskultur. Theater und Feuilleton galten als Leitmedien, während Wohlfahrts- und Kontrollinstitutionen das Leben der Unterschichten regulierten. In dieser Gemengelage von Fortschritt, Moralaufsicht und urbaner Armut entstand der kulturelle Kontext von Josefine Mutzenbacher.
Der Roman erschien 1906 anonym in Wien unter dem Titel „Josefine Mutzenbacher. Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt“. Die Autorschaft wird seit dem frühen 20. Jahrhundert überwiegend Felix Salten (geboren als Siegmund Salzmann, 1869–1945) zugeschrieben, einem Wiener Journalisten und Feuilletonisten; eine öffentliche Autorenerklärung legte er nie vor. Frühdrucke kursierten abseits des etablierten Buchhandels und gerieten rasch ins Visier von Polizei und Gerichten wegen angeblicher Unzüchtigkeit. Sprachlich zeichnet sich das Buch durch ausgeprägten Wiener Dialekt und Milieuschilderung aus, wodurch es sich von zeitgenössischer Hochliteratur abhebt und an urbane Mündlichkeit sowie soziale Authentizität anknüpft.
Das Werk steht im Umfeld der Wiener Moderne und der Gruppe Jung-Wien, deren Autoren (etwa Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg) bürgerliche Moral, Sexualität und Rollenbilder kritisch beleuchteten. Zeitgleich provozierte Schnitzlers „Reigen“ (1897/1900) Verbote und Prozesse, was die enge Verzahnung von Literatur, Öffentlichkeit und Sittlichkeitsnormen zeigt. Realistische und naturalistische Verfahren, der Fokus auf Großstadtmilieus sowie eine Hinwendung zur Alltagssprache prägten die Epoche. Vor diesem Hintergrund verbindet „Josefine Mutzenbacher“ eine konsequente Ich-Perspektive mit Milieustudie und Dialekt, wodurch soziale Hierarchien, Sprache und Körper als historische Marker einer spezifischen Wiener Urbanität um 1900 sichtbar werden.
Die Jahrzehnte vor 1900 waren in Wien von Massenzuzug, Wohnungsnot und prekären Arbeitsverhältnissen geprägt. In den Vorstädten entstanden dicht bewohnte Zinshäuser; viele Frauen arbeiteten in Dienstbotenstellen, Fabriken oder informellen Sektoren. Prostitution wurde nach dem damals verbreiteten Reglementationsmodell polizeilich erfasst und medizinisch kontrolliert; die Sittenpolizei überwachte Registrierungen, Meldungen und Untersuchungen. Derartige Praktiken zielten auf die Eindämmung von Geschlechtskrankheiten und die Aufrechterhaltung öffentlicher Ordnung, verfestigten aber zugleich soziale Stigmata. Diese Realität eines verwalteten, geschlechtsspezifisch codierten Großstadtlebens bildet eine wesentliche Folie, vor der Figurenrede, Ortsnamen, Umgangsformen und soziale Mobilität im Roman historisch verortet werden können.
Parallel entfalteten sich medizinische, juristische und moralreformerische Diskurse über Sexualität. Werke wie Richard von Krafft-Ebings „Psychopathia Sexualis“ (ab 1886) prägten die zeitgenössische Begriffsbildung, während Schriften wie Otto Weiningers „Geschlecht und Charakter“ (1903) polarisierende Thesen zur Geschlechterordnung verbreiteten. Katholische Verbände, bürgerliche Vereine und sozialreformerische Initiativen stritten über Reglementierung oder Abschaffung der Prostitution sowie über Schutz- und Fürsorgeeinrichtungen. In der Presse verdichteten sich „Sittlichkeitsdebatten“, die zugleich Klassen- und Geschlechterhierarchien verhandelten. Das Buch reflektiert diese Diskurslage, indem es die Verzahnung von Sexualmoral, Behördenpraxis und städtischer Lebenswelt zeigt, ohne sich offen programmatisch auf eine Reformrichtung festzulegen.
Seit seinem Erscheinen wurde der Text in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich wiederholt wegen Unzüchtigkeit beanstandet, beschlagnahmt oder nur verdeckt vertrieben. Auch im internationalen Kontext unterlag er bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Beschränkungen, Übersetzungen wurden teils verboten oder eingezogen. Die rechtliche Kritik bezog sich besonders auf sexualisierte Darstellungen Minderjähriger, was zu anhaltenden Jugendschutz- und Zensurmaßnahmen führte. Mit der sexuellen Liberalisierung der 1960er/70er Jahre kam es zu breiterer Verfügbarkeit, jedoch blieben Indizierungen und gerichtliche Auseinandersetzungen in verschiedenen Ländern bestehen. Zugleich gewann das Werk als Gegenstand literatur- und kulturhistorischer Forschung an Sichtbarkeit.
Felix Salten war eine bekannte Stimme der Wiener Presse und veröffentlichte neben Reportagen und Theaterkritiken auch Erzählprosa; internationale Bekanntheit erlangte er mit „Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ (1923). Als jüdischer Autor war er nach 1933 von nationalsozialistischen Maßnahmen betroffen; seine Werke wurden in Deutschland bekämpft. Nach dem „Anschluss“ Österreichs 1938 emigrierte Salten in die Schweiz und starb 1945 in Zürich. Die anonyme Zuschreibung von „Josefine Mutzenbacher“ blieb zu Lebzeiten unbestätigt, ist jedoch in der Forschung weit verbreitet. Diese biografischen Daten rahmen die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Romans zwischen Wiener Moderne, Exil und Nachruhm.
Als Zeitdokument kommentiert der Roman die Kluft zwischen repräsentativer Kaiserreichskultur und den Bedingungen des Alltags in der Großstadt. Die konsequente Ich-Erzählung und der Wiener Dialekt fungieren als soziale Marker, die Machtverhältnisse, ökonomische Abhängigkeiten und Moralrhetorik sichtbar machen. Hinter dem Skandal um Obszönität steht die Beobachtung von Behördenpraxis, Klassenunterschieden und städtischer Ökonomie, die das Fin de Siècle in seiner Ambivalenz spiegelt. Damit dient das Buch, über seine problematische Rezeptionsgeschichte hinaus, als kritischer Kommentar zur Epoche: Es zeigt, wie Modernisierung, Kontrolle und Doppelmoral im Wien um 1900 zusammenwirkten und Lebenswege strukturierten.
Josefine Mutzenbacher: Die Geschichte einer Wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt
Erstes Kapitel
Man sagt, daß aus jungen Huren alte Betschwestern werden[1q]. Aber das trifft bei mir nicht zu. Ich bin frühzeitig zur Hure geworden, ich habe alles erlebt, was ein Weib im Bett, auf Tischen, Stühlen, Bänken, an kahle Mauerecken gelehnt, im Grase liegend, im Winkel dunkler Haustore, in chambres séparées[4], im Eisenbahnzug, in der Kaserne, im Bordell und im Gefängnis überhaupt nur erleben kann, aber ich bereue nichts von alledem. Ich bin heute bei Jahren, die Genüsse, die mein Geschlecht mir bieten kann, sind im Entschwinden begriffen, ich bin reich, bin verblüht, und sehr oft ganz vereinsamt. Aber es fällt mir nicht ein, obgleich ich immer fromm und gläubig gewesen bin, jetzt Buße zu tun. Aus Armut und Elend wie ich entstammt bin, habe ich alles meinem Körper zu verdanken. Ohne diesen gierigen, zu jeder Sinnenlust frühzeitig entzündeten, in jedem Laster von Kindheit auf geübten Körper, wäre ich verkommen, wie meine Gespielinnen, die im Findelhaus[3] starben oder als abgerackerte, stumpfsinnige Proletarierfrauen zugrunde gingen. Ich bin nicht im Dreck der Vororte erstickt[2q]. Ich habe mir eine schöne Bildung erworben, die ich nur einzig und allein der Hurerei verdanke[3q], denn diese war es, die mich in Verkehr mit vornehmen und gelehrten Männern brachte. Ich habe mich aufklären lassen und gefunden, daß wir armen, niedrig geborenen Weiber nicht so viel Schuld haben, als man uns einreden möchte. Ich habe die Welt gesehen und meinen Gesichtskreis erweitert, und alles das verdanke ich meinem Lebenswandel, den man einen »lasterhaften« nennt. Wenn ich meine Schicksale jetzt aufschreibe, so tue ich das nur, die Stunden meiner Einsamkeit damit zu kürzen, und was mir jetzt abgeht, aus der Erinnerung wenigstens herbeizuschaffen. Ich halte das für besser als bußfertige Erbauungsstunden, die meinem Pfarrer wohl gefielen, die mir aber nicht zu Herzen gingen und mir nur eine grenzenlose Langeweile bereiten würden. Auch finde ich, daß der Lebensgang von Meinesgleichen nirgends aufgeschrieben steht. Die Bücher, die ich danach durchsucht habe, erzählen nichts davon, und es wäre vielleicht doch gut, wenn die vornehmen und reichen Herren, die sich an uns ergötzen, die uns locken und sich von uns alle unmöglichen Dinge aufbinden lassen, einmal erfahren würden, wie es in einem jener Mädchen aussieht, die sie so brünstig in ihre Arme schließen, woher es stammt, was es erlebt hat, und was es denkt.
Mein Vater war ein blutarmer Sattlergehilfe, der in einem Geschäft in der Josefstadt arbeitete. Wir wohnten ganz weit draußen in Ottakring, in einem damals neuen Hause, einer Zinskaserne[2], die von oben bis unten mit armen Leuten angefüllt war. Alle diese Leute hatten viele Kinder, und im Sommer war der Hof zu klein für ihre Schar. Ich selbst besaß zwei Brüder, die beide um wenige Jahre älter waren als ich. Mein Vater, meine Mutter, wir drei Kinder wohnten in einer Küche und einem Zimmer und hatten noch einen Bettgeher[1] mit dazu. Solche Bettgeher waren der Reihe nach wohl ein halbes hundert bei uns; sie kamen und gingen, bald friedlich, bald in Streit, und die meisten von ihnen verschwanden spurlos, ohne daß wir jemals wieder etwas von ihnen hörten. Ich erinnere mich hauptsächlich an zwei von ihnen. Der eine war ein Schlossergeselle, ein schwarzer, traurig aussehender Bursche, der ganz kleine schwarze Augen hatte, und immer voll Ruß im Gesicht war. Wir Kinder fürchteten uns vor ihm. Er war auch immer schweigsam und sprach kein Wort. Ich entsinne mich, daß er eines Nachmittags nach Hause kam, während ich allein in der Wohnung mich befand. Ich war damals fünf Jahre alt und spielte am Boden des Zimmers[4q]. Meine Mutter war mit den beiden Buben am Fürstenfeld, mein Vater von der Arbeit noch nicht zurück. Der Schlosser nahm mich vom Boden auf und hielt mich auf seinem Schoß. Ich wollte schreien, aber er sagte leise: »Sei stad, ich tu' dir nix!« Und dann legte er mich zurück, hob mein Röckchen auf, und betrachtete mich, wie ich nackt vor ihm auf seinen Knien lag. Ich fürchtete mich sehr vor ihm, aber ich verhielt mich ganz still. Wie er meine Mutter kommen hörte, setzte er mich rasch auf den Fußboden und ging in die Küche. Ein paar Tage später kam er wieder frühzeitig nach Hause und die Mutter ersuchte ihn auf mich aufzupassen. Er versprach es, und hielt mich wieder die ganze Zeit auf seinen Knien, in Betrachtung meines nackten Mittelstückes begriffen. Er sprach kein Wort, sondern schaute nur immer auf die eine Stelle hin, und ich traute mich auch nicht, etwas zu reden. Das wiederholte sich, solange er bei uns wohnte, einigemale. Ich begriff nichts davon, und machte mir auch, nach Kinderart, keine Gedanken darüber. Heute weiß ich, was das bedeutet hat, und nenne den Schlossergesellen oft meinen ersten Geliebten.
Von dem zweiten Bettgeher werde ich später reden.
Meine beiden Brüder Franz und Lorenz waren sehr ungleich. Lorenz, der älteste, er war um vier Jahre älter als ich, war immer sehr verschlossen, in sich gekehrt, fleißig und heilig. Franz, der nur anderthalb Jahre mehr zählte als ich, war dagegen lustig, und er hielt sich auch viel mehr zu mir als zum Lorenz. Ungefähr sieben Jahre war ich alt geworden, als ich eines Nachmittags mit Franz zu Nachbarskindern auf Besuch ging. Es war auch ein Bruder und eine Schwester, und diese Kinder waren immer allein, weil sie keine Mutter hatten, und ihr Vater in die Arbeit gehen mußte. Die Anna war damals schon neun Jahre alt, ein blasses, mageres, weißblondes Mädchen mit einer gespaltenen Lippe. Und ihr Bruder Ferdl, ein dreizehnjähriger, robuster Bub, auch ganz weißblond, aber rotwangig und breitschultrig. Wir spielten zuerst ganz harmlos. Da sagte die Anna auf einmal: »Spiel'n wir doch Vater und Mutter.« Ihr Bruder lachte und sagte: »Die will immer nur Vater und Mutter spielen.« Aber Anna bestand darauf, trat zu meinem Bruder Franz und meinte: »Also du bist der Mann und ich bin die Frau.« Und Ferdl war gleich bei mir, faßte mich am Arm und erklärte: »Da bin dann halt ich dein Mann und du meine Frau.« Sofort nahm Anna zwei Polsterüberzüge, machte zwei Wickelkinder daraus, und gab mir eines. »Da hast dazu ein Kind«, meinte sie. Ich begann die Lappendocke gleich zu wiegen, aber Anna und Ferdl lachten mich aus. »So geht das nicht. Z'erst muß man das Kind machen, dann muß man in der Hoffnung sein, dann muß man es kriegen, und dann erst kann man's hutschen!« Ich hatte natürlich schon manchmal davon reden gehört, daß Frauen »in der Hoffnung« sind, daß sie ein Kind kriegen werden. An den Storch glaubte ich auch nicht mehr so recht, und wenn ich Frauen mit einem großen Bauch sah, wußte ich ungefähr, was das bedeutet. Aber genauere Vorstellungen davon hatte ich bisher nicht gehabt. Auch mein Bruder Franz nicht. Wir standen deshalb gänzlich verdutzt und ratlos da, und wußten nicht, wie wir dieses Spiel werden versuchen, oder uns daran beteiligen können. Aber Anna war schon zu Franz getreten und griff nach seinem Hosentürl. »Komm nur«, sagte sie, »tu ihn heraus, dein' Zipfel!« Und dabei hatte sie ihm die Hose auch gleich aufgeknöpft und seinen »Zipfel« zum Vorschein gebracht. Ferdl und ich sahen zu. Ferdl lachend. Ich mit einem Gefühl, das aus Neugierde, Staunen, Entsetzen und noch einer besonderen, mir bisher fremden Erregung gemischt war. Franz stand ganz bewegungslos da, und wußte nicht, wie ihm geschah. Unter Annas Berührung richtete sich sein »Zipfel« ganz steif in die Höhe. »Jetzt komm«, hörte ich Anna leise flüstern. Ich sah, wie sie sich auf den Boden warf, ihre Röcke hob und die Beine spreizte. In diesem Moment ergriff mich Ferdl. »Leg dich nieder«, zischelte er mir zu, und dabei spürte ich auch schon seine Hand zwischen meinen Beinen. Ganz willig legte ich mich auf den Boden, hatte meine Röcke aufgeschlagen, und Ferdl rieb sein steifes Glied an meiner Fut. Ich mußte lachen, denn sein Schwanz kitzelte mich nicht wenig, weil er mir auch auf dem Bauch und sonst überall herumfuhr. Er keuchte dabei, und lag schwer auf meiner Brust. Mir kam das Ganze unsinnig und lächerlich vor, nur eine kleine Aufregung war in mir, und nur dieser allein ist es wohl zuzuschreiben, daß ich liegen blieb, ja sogar ernsthaft wurde. Ferdl wurde plötzlich ruhig und sprang auf. Ich erhob mich gleichfalls, und er zeigte mir jetzt seinen »Zipfl«, den ich ruhig in die Hand nahm. Ein kleiner heller Tropfen war auf der Spitze zu sehen. Dann zog Ferdl die Vorhaut zurück, und ich sah die Eichel zum Vorschein kommen. Ich schob nun die Vorhaut ein paarmal hin und her, spielte damit, und freute mich, wenn die Eichel, wie der rosige Kopf eines kleinen Tieres hervorspitzte. Anna und mein Bruder lagen noch auf dem Boden, und ich sah, wie Franz ganz aufgeregt hin und her wetzte. Er hatte rote Wangen und keuchte, ganz wie Ferdl vorhin. Aber auch Anna war ganz verändert. Ihr bleiches Gesicht hatte sich gefärbt, ihre Augen waren geschlossen, und ich glaubte, ihr sei schlecht geworden. Dann wurden die beiden auch plötzlich still, lagen ein paar Sekunden aufeinander, und standen dann auf. Wir saßen eine Weile zusammen. Ferdl hielt mich unter den Röcken mit der Hand an der Mitte, Franz tat dasselbe mit Anna. Ich hatte Ferdls Schwanz in der Hand, Anna den meines Bruders; und es war mir ganz angenehm, wie Ferdl bei mir herumfingerte. Es kitzelte mich, aber nicht mehr so, daß ich lachen mußte, sondern so, daß mir ein Wohlgefühl durch den ganzen Körper lief. Diese Beschäftigung wurde von Anna unterbrochen, die jetzt die beiden Puppen nahm, von denen sie die eine sich selbst unter das Kleid auf den Bauch legte, die andere mir. »So«, sagte sie. »Jetzt sind wir in der Hoffnung.« Wir zwei gingen nun im Zimmer herum, streckten unsere ausgestopften Bäuche heraus und lachten darüber. Dann brachten wir unsere Kinder zur Welt, wiegten sie in den Armen, gaben sie unseren Ehemännern, damit sie sie halten und bewundern sollten, und spielten eine Weile wie unschuldige Kinder. Anna kam auf die Idee, daß sie ihr Kind säugen müsse. Sie knöpfte ihre Jacke auf, zog das Hemd herab und tat so, als ob sie einem Kind die Brust reichen würde. Ich bemerkte, daß sie schon leise anschwellende Warzen hatte; und ihr Bruder trat hinzu und spielte damit; auch Franz machte sich bald an Annas Brust zu schaffen, und Ferdl meinte, es sei schade, daß ich keine Duteln habe. Dann kam eine Erklärung vom Kindermachen. Wir erfuhren, daß das, was wir eben getan hatten vögeln heiße, daß unsere Eltern dasselbe tun, wenn sie miteinander im Bett liegen, und daß die Frauen davon die Kinder bekämen. Ferdl war schon ein Ausgelernter. Er sagte uns Mädchen, daß unsere Fut noch zugewachsen sei, daß man deshalb nur von außen daran herumwetzen könne. Er sagte ferner, daß wir einmal, wenn wir größer werden, Haare darauf bekommen, daß dann unser Loch sich öffnen wird, und daß man dann mit dem ganzen Schwanz hineinfahren können wird. Ich wollte es nicht glauben, aber Anna erklärte mir, Ferdl wisse das ganz genau. Er habe auf dem Boden die Frau Reinthaler gevögelt, und da sei sein Schwanz ganz in ihr Loch hineingegangen. Die Frau Reinthaler war die Frau eines Tramwaykondukteurs[5], der in unserem Haus im letzten Stock wohnte. Es war eine dicke, schwarze Frau, klein und hübsch und immer sehr freundlich. Ferdl erzählte uns die Geschichte: »Die Frau Reinthaler ist vom Waschen 'kommen. Ein' ganzen Korb voller Wäsch' hats 'tragen, und ich bin g'rad auf der Stieg'n g'wesen. Na, und wie ichs grüßt hab' sagt sie zu mir: ›Geh Ferdl, bist ein starker Bub, könntst mir wirklich helfen, den schweren Korb am Boden tragen.‹ So bin ich halt mit ihr auffi gangen, und wie wir droben sein, fragt sie mich, ›was willst denn jetzt dafür, daß du mir g'holfen hast?‹ – ›Nix‹, sag ich drauf. ›Komm, ich zeig' dir was‹, sagt sie, packt mich bei der Hand und legt sich's auf die Brust. ›Gelt ja, das ist gut?‹ Da hab' ich schon g'wußt, was los ist, denn mit der Anna hab' ich ja schon oft früher gewetzt – was?« – Anna nickte bekräftigend, als ob sich das alles ganz von selbst verstünde, Ferdl fuhr fort: »Aber ich hab' mich doch nicht getraut, und hab' nur ihre Brust fest z'sammendruckt. Sie hat sich gleich ihr Leibl aufg'macht, und hat mir's alser nackter herausgeben, und hat mich spielen lassen, und dann hat's mich bei der Nudel packt, und hat alleweil gelacht, und hat g'sagt: ›Wenn's d' niemanden was ausplauschen möchst, derfest noch was andres tun …‹ – ›Ich red' nix‹, hab' ich drauf g'sagt, – ›g'wiß nix?‹ fragt sie noch amal. ›Nein, g'wiß nix.‹ Na da hat sie sich übern Wäschkorb g'legt, und hat mich auf sich g'nommen, und hat mir den Schwanz mit der Hand hineingesteckt in ihre Fut. Ganz drinn war er, ich hab's ganz genau g'spürt. Und die Haar, was sie drauf hat, hab' ich auch g'spürt.«
Anna wollte noch nicht, daß die Erzählung aus sei. »War's gut?« forschte sie weiter. »Sehr gut war's«, antwortete Ferdl trocken, »und g'stoßen hat sie, wie nicht g'scheit, und druckt hat's mich, und mit ihre Duteln hab' ich spielen müssen. Und wie's dann aus war, is sie rasch aufg'sprungen, hat sich ihr Leibl zuknöpfelt und hat ein ganz böses Gesicht g'macht. ›Schau, daß d' weiterkommst, du Lausbub‹, hat's zu mir g'sagt, ›und wenn du dich verplauscht, reiß' ich dir dein Schädel aber …‹« Ferdl machte ein ganz nachdenkliches Gesicht. Anna aber meinte plötzlich: »Glaubst du nicht, daß er bei mir schon hineingeht?« Ferdl sah sie an, sie hielt noch immer ihr Puppenkind an der bloßen Brust, und er griff sie an, strich wie versuchend daran herum, und sie entschied endlich: »Versuch's ein bißl …« – »Alsdann spielen wir wieder Vater und Mutter«, schlug Anna vor. Franz ging gleich zu ihr, und auch ich nahm jetzt, nach all den Belehrungen, die ich empfangen hatte, und nach der Geschichte, die ich eben vernommen, diesen Vorschlag bereitwillig an. Aber Anna wies Franz von sich. »Nein«, sagte sie, »jetzt soll der Ferdl mein Mann sein, und du bist der Pepi ihrer.« Damit rückte sie ihrem Bruder an die Seite, schob ihre Hand in seinen Hosenspalt, und er griff ihr sogleich unter die Röcke. Ich packte Franz und erinnere mich, daß ich das mit einer starken Aufregung tat. Als ich seine kleine bloße Nudel aus der Hose nahm, und die Vorhaut auf- und niederschob, spielte er mit seinen Fingern an meinem Loch, und da wir jetzt beide wußten, wie's gemacht wird, lagen wir in der nächsten Sekunde auf dem Boden, und ich regierte mit der Hand seinen Zapfen so genau, daß er mir nicht den Bauch hinauffuhr, sondern mich genau in meiner Spaltung bestreichelte. Dies machte mir ein Vergnügen, von dem ich im ganzen Körper eine wohlige Spannung verspürte, so daß auch ich mich gegen ihn rieb und wetzte, wann ich nur konnte. Das dauerte eine Weile, bis Franz erschöpft auf mich fallend niedersank und sich nicht rührte. Wir lagen ein paar Momente so, dann hörten wir einen Disput zwischen Ferdl und Anna, und schauten nach, was sie machten. Sie lagen noch immer aufeinander, aber Anna hielt ihre beiden Beine so hoch, daß sie über Ferdls Rücken sich berührten. »Er geht schon hinein …« sagte Ferdl, aber Anna meinte: »Ja, hinein geht er, aber weh tut's – laß gehn, es tut weh.« Ferdl beruhigte sie: »Das macht nix, – das ist im Anfang – wart nur, vielleicht geht er ganz hinein.« Wir legten uns flach auf den Boden, rechts und links von den beiden, um festzustellen, ob Ferdl drin sei oder nicht. Er war wirklich ein wenig drin. Der untere Teil von Annas Fummel war breit geöffnet, wie wir mit Staunen wahrnahmen, und da drinnen steckte Ferdls Schwanz bis über den Kopf und fuhr unbeholfen hin und her. Wie Ferdl eine heftige Bewegung machte, glitt er ganz hinaus, aber ich ergriff ihn sofort und fügte ihn wieder in Annas Eingang, der mir schon ganz rotgerieben vorkam. Ich hielt ihn fest, und versuchte ihn tiefer hineinzudrängen. Ferdl selbst stieß in der Richtung, die ich ihm gab, kräftig nach, aber Anna fing auf einmal laut zu schreien an, so daß wir erschrocken auseinanderfuhren. Sie weigerte sich, das Spiel fortzusetzen, und ich mußte Ferdl noch einmal auf mich nehmen, weil er sich nicht beruhigen wollte. Nun war aber auch ich einigermaßen rot gerieben, und weil es inzwischen schon Zeit wurde, gingen wir heim. Mein Bruder und ich sprachen auf dem Weg in unsere Wohnung kein Wort. Wir wohnten auch im letzten Stockwerk dieses Hauses, Tür an Tür mit der Frau Reinthaler. Als wir oben auf dem Gang ankamen, sahen wir die kleine dicke Frau im Gespräch mit einer anderen Nachbarin stehen. Wir gafften sie an und begannen laut zu lachen. Als sie sich nach uns umdrehen wollte, flüchteten wir in unsere Tür.
Seit jenem Tage betrachtete ich Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen mit völlig veränderten Blicken. Ich war erst sieben Jahre alt, aber meine Geschlechtlichkeit kam voll zum Ausbruch. Sie muß in meinen Augen zu lesen gewesen sein, mein ganzes Gesicht, mein Mund, mein Gang muß eine einzige Aufforderung gewesen sein, mich anzupacken und hinzuschmeißen. Nur so kann ich mir die Wirkung erklären, die damals schon von mir ausging, die ich in der Folge übte, und die es zustande brachte, daß fremde und wie mir scheint, besonnene Männer gleich bei der ersten Begegnung mit mir alle Vorsicht außer Acht ließen und unbedenklich alles wagten. Diese Wirkung kann ich auch jetzt noch bemerken, wo ich weder jung bin noch schön und wo mein Körper welk geworden und die Spuren meines Wandels greifbar zu erkennen gibt. Trotzdem gibt es noch Männer, die auf den ersten Blick von mir in Flammen geraten und sich dann in meinem Schoß wie die Rasenden gebärden. Diese Wirkung mag schon viel früher tätig gewesen sein, als ich noch wahrhaft unschuldig war, und vielleicht ist sie es gewesen, die den Schlossergesellen dazu trieb, die Scham der Fünfjährigen zu entblößen.
Ein paar Tage später waren wir Kinder allein zu Hause, und da begann der Franz den Lorenz zu fragen, ob er denn wisse, woher die Kinder kommen und wie sie gemacht werden. Lorenz meinte: »Weißt du's vielleicht?« Franz und ich lachten, und ich holte Franzens kleinen Stift aus dem Hosentürl, streichelte ihn ein wenig, während Lorenz mit ernster Miene zusah, wie Franz mich an meiner Spalte kitzelte. Dann legten wir uns aufs Bett und spielten unser Stückchen, das wir von Anna und Ferdl gelernt hatten, mit allem Talent herunter. Lorenz sprach kein Wort, auch nicht, als wir fertig waren, aber als ich mich ihm näherte, und die Hand in seine Hose stecken wollte, indem ich ihm sagte: »Komm, jetzt mußt du's auch probieren …« stieß er mich weg und zu unserem großen Erstaunen erzählte er: »Das Vögeln kenn' ich schon längst. Glaubt's ihr vielleicht, ich werd' auf euch warten? Aber das darf man nicht. Das ist eine schwere Sünd', Unkeuschheit ist das, und wer vögelt, kommt in die Höll'.« Wir erschraken nicht wenig, aber dann bestritten wir die Behauptung. »Glaubst du am End'«, fragten wir ihn, »daß der Vater und die Mutter auch in die Höll' kommen?« Er war fest überzeugt davon, und gerade deshalb gaben wir alle Angst auf und verhöhnten ihn. Lorenz aber drohte, er werde uns beim Vater, beim Lehrer und beim Katecheten[6] verklagen, und seitdem haben wir unsere kleinen Vergnügungen niemals wieder in seiner Gegenwart vorgenommen. Er wußte trotzdem, daß Franz und ich fortfuhren, aufeinander zu liegen, oder uns mit anderen Kindern abzugeben; aber er schwieg und wich uns aus.
Wir waren sehr oft bei Anna und Ferdl und spielten immer dasselbe. Immer wurde ich zuerst vom Ferdl, Anna von Franz gevögelt, dann die Anna von ihrem Bruder und ich von dem meinigen. Trafen wir die beiden einmal nicht daheim, oder mußten wir selbst zu Hause bleiben, dann vögelten wir eben allein. Aber es verging kein Tag, an dem wir nicht aufeinander lagen. Unsere gemeinsamen Gespräche aber drehten sich nur um den einzigen Wunsch, es einmal mit einem Großen tun zu dürfen. Anna und ich wünschten sich einen wirklichen, erwachsenen Mann, Ferdl und Franz wünschten sich die Frau Reinthaler.
Einmal als wir wieder zu Anna kamen, war Besuch da. Eine dreizehnjährige Kousine von ihr, Mizzi und ihr Bruder Poldl. Die Mizzi war ein hübsches, schon recht entwickeltes Mädchen, und ihre jungen Brüste standen fest und frei unter ihrer dünnen Bluse. Es wurde natürlich gleich von dem gesprochen, was uns am meisten interessierte, und Poldl rühmte sich, daß seine Schwester schon Haare auf der Fut hätte. Er hob ihr ganz ruhig die Kleider auf, und wir sahen respektvoll auf das dreieckige, dunkle Büschel, das sich dort befand, wo wir noch nackt waren. Dann wurden die Brüste der Mizzi entblößt und von uns allen bestaunt und gestreichelt. Mizzi geriet in Aufregung. Sie schloß die Augen, lehnte sich zurück und streckte die Hände nach Franz und nach ihrem Bruder aus. Jeder gab ihr, was er in der Hose trug, zu halten, und Ferdl stellte sich zwischen ihre Beine und spielte mit seinem Schwanz an ihrem Spalt. Endlich sprang sie auf, eilte zum Bett, warf sich darauf und rief: »Poldl, komm her, ich halt's nimmer aus.« Ihr Bruder schwang sich zu ihr hinauf. Wir waren alle um das Bett getreten und sahen zu. Während Ferdl seinen Schweif der atemlos daliegenden Mizzi zu halten gab, vertraute Franz den seinigen Annas Händen an; ich aber schaute voll Interesse zu, wie einmal »wirklich gevögelt« wird. Denn Mizzi und ihr Bruder, der erst zwölf Jahre alt war, erklärten uns, daß sie es genauso machen könnten wie die Großen. Ich sah mit Verwunderung, wie Poldl seine Schwester auf den Mund küßte. Denn ich hatte bisher nicht gedacht, daß das Küssen mit dazugehört. Ich sah auch, wie Poldl Mizzis beide Brüste in der Hand hielt, während er auf ihr lag, sie fortwährend streichelte und ich bemerkte, wie die Brustwarzen spitz und hoch herausstanden. Ich sah, wie Poldls Schweif gänzlich in dem schwarzen Haarbüschel seiner Schwester verschwand, und griff selbst hin, um mich zu überzeugen, ob er wirklich in ihrem Leib steckte. Und ich war plötzlich furchtbar erregt, als ich mit eigenen Händen fühlte, wie Poldls Stange, die übrigens viel größer war als die von Franz und Ferdl, tief in Mizzis Leib hineinfuhr, bis ans Ende, wieder herauskam, und wieder darin versank. Am meisten aber setzte mich Mizzis Gehaben in Verwunderung. Sie warf sich mit ihrem Popo ihrem Bruder entgegen, vollführte hitzige Stöße, zappelte mit den Füßen in der Luft, war ganz atemlos und seufzte immerfort, so daß ich glaubte, es müsse ihr doch furchtbar weh tun. Ich merkte aber dann, daß es anders war, als sie keuchend ein ums andere Mal ausrief: »Fester! Fester! Noch fester, so, so, gut, gut, gut, aah!« Kaum hatte Poldl seinen Schwanz herausgezogen und stieg vom Bett herab, als Ferdl und Franz sich herandrängten. Mizzi war mit gespreizten Beinen liegen geblieben, mit nackten Schenkeln und mit nackten Brüsten. Lächelnd sah sie zu, wie Ferdl und Franz sich stießen, wer sie zuerst haben sollte, und eben als die beiden Miene machten, miteinander ernstlich zu raufen, entschied sie den Streit, indem sie nach meinem Bruder griff und erklärte: »Zuerst der Kleine da!« Franz warf sich auf Mizzi. Aber er fing an, sie in der Art zu reiben, wie er es an mir und Anna gewöhnt war. Mizzi hielt seine Bewegung auf, erwischte ihn am Zipfel und schob ihn mit einem Ruck in die Spalte. Franz war ganz verblüfft, hörte auf, sich zu rühren, und tat so, als wollte er mit seinem Schwanz erst fühlen, wo er sich befand. Aber Mizzi duldete diese Ruhe nicht. Sie begann sich unter ihm zu werfen, fing ihre Gegenstöße an, und gleich war Franz wieder herausgerutscht ohne hineinzufinden. Jetzt half ich ihm aber, ich hielt meine Hand hin und brachte ihn, wenn er ausgleiten wollte, jedesmal auf den rechten Weg. Eine neue Schwierigkeit ergab sich, weil Mizzi durchaus wollte, Franz solle mit ihren Brüsten spielen. Aber wenn er sie in die Hand nahm und sie zu kitzeln und zu streicheln begann, vergaß er ganz das Vögeln, und wenn ihn Mizzi dann wieder zum Vögeln trieb, vergaß er ihre Brüste. Er konnte beides zugleich nicht bewältigen, und Mizzi beklagte sich schweratmend: »Schad is, der kann noch gar nix!« Ferdl, der ungeduldig dabeistand, bemächtigte sich jetzt der Duteln Mizzis, drückte sie, küßte sie auf die Warzen, daß sie wieder hoch aufgerichtet wurden, und nahm damit Franz die eine Hälfte seiner Aufgabe ab. Franz kam in ein regelmäßiges schnelles Stoßen, was Mizzi sehr recht war. Sie seufzte und jammerte und schnalzte mit den Lippen, und warf sich hoch im Bett in die Höhe und sagte dabei zu uns: »Ah, das ist gut, das ist gut, der kleine Schwanz ist gut.«