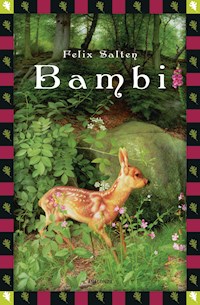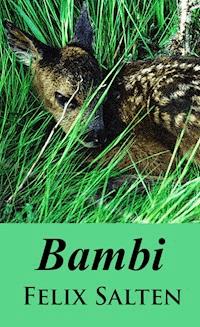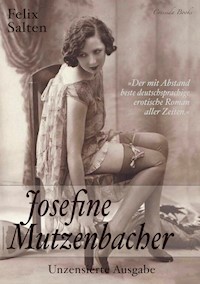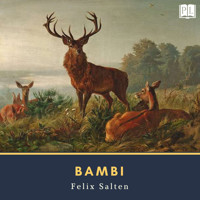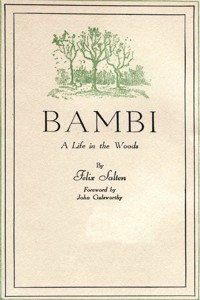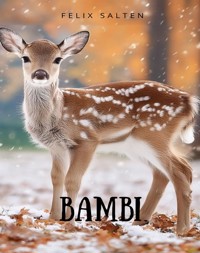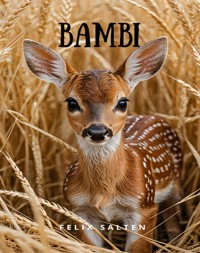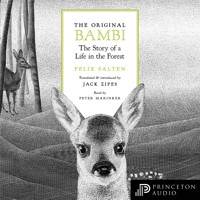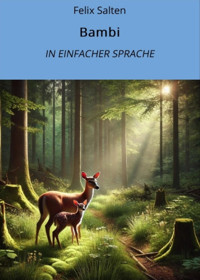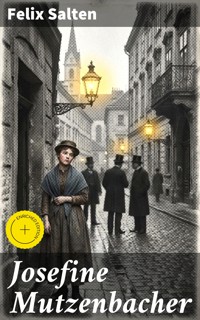
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
In "Josefine Mutzenbacher" entführt uns Felix Salten in eine facettenreiche und provokante Welt des 19. Jahrhunderts, in der die Hauptfigur, die gleichnamige Josefine, eine einzigartige Perspektive auf ihre eigene Sexualität und die gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit entfaltet. Diese autobiografisch angehauchte Erzählung, stilistisch geprägt von einem deutlichen Realismus und einer eindringlichen Psychologie, stellt die moralischen Standards der Epoche in Frage. Mit einer Kombination aus Sinnlichkeit und scharfer Beobachtungsgabe schafft Salten ein Portrait, das gleichermaßen verführerisch wie herausfordernd ist und die Leser dazu anregt, über die Beschränkungen der bürgerlichen Moral nachzudenken. Felix Salten, ein österreichischer Schriftsteller und Journalist, wurde 1869 geboren und trat in der literarischen Szene zunächst als angesehener Kritiker und Autor von Kinderbüchern in Erscheinung. Sein größter Ruhm erlangte er durch die Schaffung des zeitlosen Werkes "Bambi", doch "Josefine Mutzenbacher" reflektiert seine tiefere Auseinandersetzung mit Erotik und Geschlechterrollen. Basteln aus persönlichen Erfahrungen und der gesellschaftlichen Konvention seiner Zeit zeugt von einem mutigen Schriftsteller, der für seine Zeitgenossen oft als kontrovers galt. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die tiefen Abgründe menschlicher Psyche, Feminismus und die Entwicklung der Geschlechterrollen interessieren. Salten schafft nicht nur ein unterhaltsames Werk, sondern regt auch zur Reflexion über die eigenen Vorurteile und die Entwicklung unserer modernen Werte an. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Tabus und bleiben Sie intellektuell herausgefordert! In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Josefine Mutzenbacher
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen Begehren, sozialer Härte und dem Drang nach Selbstbehauptung verdichtet sich in dieser fiktiven Lebensbeichte die grundlegende Spannung einer Erzählstimme, die Wien als Bühne der Doppelmoral erfahrbar macht, den Körper als Schauplatz gesellschaftlicher Erwartungen ausstellt und durch scharfes Beobachten zugleich offenlegt, wie Macht, Lust und Armut einander bedingen, sich verbergen und entgrenzen. Dabei richtet sie einen nüchternen, manchmal spöttischen Blick auf Konventionen, stellt Besitz und Herkunft der Figuren neben ihre Sehnsüchte, setzt derb-direkte Sprache gegen bürgerliche Zierde und zeigt, wie Erinnerung und Selbstdarstellung zu Werkzeugen werden, um eine Ordnung zu begreifen, die Vergnügen predigt und zugleich sanktioniert.
Josefine Mutzenbacher ist eine fiktive Autobiographie und ein Schlüsseltext der erotischen Literatur um 1900. Das Buch erschien 1906 anonym in Wien und wird häufig dem österreichischen Autor Felix Salten zugeschrieben; eine endgültige Zuschreibung ist historisch nicht gesichert. Sein Schauplatz ist das Wien der späten Habsburgerzeit, mit Gassen, Hinterhöfen und Vergnügungsorten als sozialem Panorama. Als Skandal- und Milieuroman verbindet es erotische Darstellung mit satirischer Gesellschaftsbeobachtung und wurde wegen seines Themas immer wieder kontrovers rezipiert. Wer das Werk liest, begegnet weniger einem klassischen Plot als einem dichten Stadt- und Sprachporträt, das aus einer einzigen, unverwechselbaren Stimme erwächst.
Im Zentrum steht die Ich-Erzählerin, die in rückblickender Form ihre frühen Lebensumstände und den Weg in das Wiener Vergnügungsmilieu schildert. Die Anfangssituation ist schlicht: ein Kind der Stadt, geprägt von Armut, Gedränge und der Suche nach Chancen, das beobachtet, lernt und sich behauptet. Der Ton ist direkt, häufig lakonisch, mit einem wienerischen Einschlag, der Mündlichkeit und Eigenwitz vermittelt. Saloppes Erzählen steht neben präziser Milieuschilderung; Tempo und Rhythmus erzeugen das Gefühl eines mitreißenden, manchmal schonungslosen Berichts. Leserinnen und Leser erleben weniger dramatische Wendungen als eine Folge pointierter Szenen, die Sprache, Orte und Beziehungen als Triebkräfte eines Lebens sichtbar machen.
Zentrale Themen sind soziale Herkunft und Aufstiegschancen, die Doppelmoral bürgerlicher Normen und die Ökonomie der Intimität. Die Erzählung zeigt, wie Körper, Sprache und Kleidung als Ressourcen zirkulieren, wie Blicke Macht erzeugen und wie Nähe verhandelt wird, ohne je zur soziologischen Abhandlung zu erstarren. Ebenso präsent ist das urbane Milieu: Wirtshäuser, Gassen, Wohnungen und öffentliche Feste bilden eine Topografie, in der Rollenbilder entstehen und bröckeln. Immer wieder schwingt die Frage mit, wer erzählt, wer schaut und wem geglaubt wird. Dadurch verbindet sich private Erfahrung mit einer präzisen Diagnose von Klassenverhältnissen und kulturellen Erwartungen.
Formal arbeitet der Text mit der Pose einer Autobiographie, die mündliche Erzählweisen imitiert: Wiederholungen, Sprünge, Abschweifungen und pointierte Miniaturen erzeugen den Eindruck eines gesprochenen Berichts. Der Stil ist zugleich derb und kunstvoll gebaut; Humor und Ironie kontrastieren mit nüchternen Beobachtungen. Die Ich-Stimme inszeniert sich selbstbewusst und gelegentlich kokett, was Nähe schafft, aber auch Distanz erzwingt, weil Leserinnen und Leser beständig abwägen, wie sie das Gesagte einordnen. So entsteht ein Spiel mit Glaubwürdigkeit und Perspektive, das den Reiz des Buches mitträgt und seine gesellschaftskritische Dimension stärker hervortreten lässt. Dabei bleibt die Sprache rhythmisch und zügig, ohne das Tempo der Erzählung zu bremsen.
Die Geschichte der Rezeption ist von Kontroversen geprägt: Anstößigkeit, Zensur und Beschlagnahmungen begleiten das Buch seit seinem Erscheinen, ebenso Diskussionen über Autorschaft und editorische Überlieferung. Diese Konflikte verweisen auf eine zentrale Frage der Moderne: Wo verlaufen die Grenzen zwischen Literatur, Moral und öffentlicher Ordnung? Das Werk wurde immer wieder als Skandaltext gelesen, zugleich aber als präzise Milieustudie und als Dokument städtischer Kultur der Jahrhundertwende gewürdigt. Gerade diese Spannung hat seine Lektüre über Generationen hinweg lebendig gehalten und lädt dazu ein, ästhetische Gestaltung und gesellschaftlichen Kontext nicht getrennt, sondern im produktiven Widerspruch zu betrachten.
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch relevant, weil es grundlegende Fragen nach Macht, Konsens, Ausbeutung, Klassenlage und der Form, in der Sexualität kulturell erzählt wird, bündelt. Es macht sichtbar, wie Sprache Begehren normiert und wie Rollenbilder in einer Stadtgesellschaft entstehen, verhandelt und unterlaufen werden. Zugleich fordert es eine wache, kontextbewusste Lektüre, die historische Distanz, ethische Sensibilität und ästhetische Neugier verbindet. Wer sich darauf einlässt, findet ein kompromissloses Stadtporträt und eine Stimme, die Konventionen testet, Grenzen benennt und damit Diskussionen anstößt, die weit über die Entstehungszeit hinausführen. So wird aus der provokanten Erzählung ein Spiegel, der unsere Gegenwart mitfragt.
Synopsis
Josefine Mutzenbacher, vielfach Felix Salten zugeschrieben und 1906 anonym erstveröffentlicht, präsentiert sich als fiktive Lebensbeichte einer Frau aus dem Wien der Jahrhundertwende. In der Ich-Perspektive blickt die Erzählerin auf Herkunft, Aufstieg und die Mechanismen einer Großstadt, in der Armut, soziale Enge und Doppelmoral den Ton angeben. Das Buch entfaltet aus dieser Stimme heraus eine Milieustudie, in der Wahrnehmung, Selbsterzählung und Beobachtung ineinandergreifen. Früh setzt es die Leitfrage nach Selbstbestimmung und Abhängigkeit, nach dem Preis sozialer Teilhabe und den Grenzen weiblicher Handlungsräume. Die Rahmenanlage verspricht einen lückenlosen Lebenslauf, ohne dadurch sein Ende vorwegzunehmen.
Die Anfänge zeichnen ein enges, prekäres Viertel, in dem familiäre Fürsorge und ökonomischer Druck unauflöslich verschränkt sind. Aus kindlicher Perspektive formt sich ein waches Sensorium für Blicke, Aufmerksamkeit und Rangordnungen, die außerhalb des Elternhauses herrschen. Kleine Gelegenheiten und Zufälle öffnen Passagen zur Straße und in Vergnügungsräume, in denen Regeln anders gelten. Ein entscheidender Einschnitt ist das frühe Verlassen des vermeintlich sicheren Rahmens und der Schritt in eine von Abhängigkeiten strukturierte Erwachsenenwelt. Notwendigkeit, Versprechen von Komfort und der Wunsch nach Anerkennung treiben Entscheidungen voran, während die Erzählerin das eigene Bild schärft, ohne die Risiken ihres Umfelds ganz zu begreifen.
Mit zunehmender Selbstständigkeit lernt Josefine, Erscheinung, Witz und Rede zur Währung zu machen. Begegnungen mit älteren Bezugspersonen und wechselnden Gönnern zeigen, wie Fürsorge, Nutzenkalkül und Kontrolle ineinander greifen. Das Milieu der käuflichen Beziehungen erscheint dabei zugleich als Bedrohung und als vermeintlicher Schutz vor Elend; Regeln, Vermittlerinnen und Treffpunkte strukturieren den Alltag. Die Erzählerin beobachtet die Doppelmoral einer Gesellschaft, in der Anstand beschworen und doch hinter verschlossenen Türen unterlaufen wird. Sie deutet diese Widersprüche als Chance auf Aufstieg und als Gefahr, sich zu verlieren, und schärft aus beidem eine Rolle, die Selbstbehauptung verspricht, aber Verpflichtungen erzeugt.
Im weiteren Verlauf wechselt Josefine die Schauplätze: von informellen Treffpunkten in kontrollierte Etablissements, in denen Rollen zugewiesen und Einnahmen geteilt werden. Mit höherem Einkommen steigen Erwartungshaltungen, Taktvorgaben und Sanktionen. Sie perfektioniert Auftreten, Kleidung und das Spiel mit Andeutungen, um sich in verschiedener Gesellschaft zu behaupten. Zugleich treten Netzwerke von Frauen hervor, deren Solidarität mit Rivalität ringt und deren Pragmatismus Sicherheit schafft. Ein Wendepunkt ist die Annäherung an Kreise, die Distinktion pflegen und Diskretion fordern; hier werden soziale Masken essenziell, und Abhängigkeiten verschieben sich von unmittelbarer Not zu bindenden Verpflichtungen gegenüber Vermittlern und zahlungskräftigen Bekannten.
Aus der Position einer scharf beobachtenden Erzählerin öffnet sich ein Panorama männlich dominierter Räume: Amtsstuben, Casinos, Kaffeehäuser, Salons. Vertreter verschiedener Klassen treten auf, deren Privatleben die offiziellen Tugenden konterkariert. Josefine nutzt Erzählgabe und situatives Gespür, um Erwartungen zu spiegeln und Risiken zu mindern. Dabei zeigt die Stadt ein doppeltes Gesicht: ein Versprechen auf Vergnügen und Nähe, das jederzeit in Prekarität umschlagen kann. Situationen, in denen Macht demonstrativ ausgespielt wird, markieren die Fragilität ihrer Position. Zugleich skizziert der Text Wege, wie sie Selbstschutz organisiert und Grenzen setzt, ohne die langfristigen Kosten solcher Strategien zu beschönigen.
Mit fortschreitender Erzählzeit wird die Reflexion über Erinnerung, Inszenierung und Wahrheit deutlicher. Die Ich-Stimme pendelt zwischen Stolz auf erlernte Souveränität und Ernüchterung über deren Preis. Fragen nach Zugehörigkeit, Zuneigung und dauerhaftem Halt treten hervor, ohne dass sich eine eindeutige Lösung abzeichnet. Beziehungen versprechen Schutz, binden aber an Erwartungen anderer; finanzielle Erfolge erweitern Spielräume und schaffen neue Abhängigkeiten. Der Text hält die Spannung zwischen behaupteter Autonomie und faktischer Verstrickung, indem er Entscheidungen schildert, deren Folgen erst allmählich sichtbar werden. So bleibt der weitere Weg bewusst offen, während die Leitmotive von Macht, Moral und Selbsterhaltung zusammenschwingen.
Über die Handlung hinaus wirkt das Werk als ambivalente Mischung aus Milieuschilderung und bewusst provokanter Literatur, deren Urheberschaft weithin Felix Salten zugeschrieben wird. Seit der anonymen Erstveröffentlichung wurde es kontrovers rezipiert, teils als Zeitdokument über Armut, Urbanität und Doppelmoral gelesen, teils wegen seines Materials beanstandet und zensiert. Nachhaltig ist die Frage, wie eine weibliche Ich-Stimme Machtverhältnisse beobachtet und zugleich von ihnen geformt wird. In dieser Spannung liegt der Reiz und die Irritation: Die Erzählung konfrontiert Leserinnen und Leser mit sozialen Mechanismen, deren Aktualität fortbesteht, und markiert Grenzen zwischen Voyeurismus, Kritik und literarischer Gestaltung.
Historischer Kontext
Um 1900 war Wien, Hauptstadt der Habsburgermonarchie, ein dicht urbanisiertes Zentrum, geprägt von katholischer Kirche, monarchischer Verwaltung, Sittenpolizei und einer selbstbewussten bürgerlichen Öffentlichkeit. Kaffeehäuser, Theater, Zeitungen und Verlage prägten den Diskurs ebenso wie medizinische Anstalten und Universitäten. In diesem Umfeld erschien 1906 anonym der Roman 'Josefine Mutzenbacher', der im Wiener Alltag verankert ist. Zensur und Strafrecht setzten damals Grenzen für 'unsittliche' Veröffentlichungen, zugleich existierte ein reger Markt für erotische Literatur. Die städtische Ordnung regulierte Prostitution polizeilich und gesundheitlich. Die Spannung zwischen offizieller Moral und gelebter Praxis bildete den unmittelbaren historischen Horizont des Buches.
Die rasche Urbanisierung seit der Gründerzeit hatte breite Arbeiterquartiere entstehen lassen, in denen Armut, beengtes Wohnen und Gelegenheitsarbeit verbreitet waren. Binnenmigration aus den Kronländern und Zuwanderung speisten ein vielsprachiges, hierarchisiertes Stadtleben. Wien kannte ein System der reglementierten Prostitution: registrierte Frauen unterlagen Gesundheitskontrollen, Bordelle und Vermietungen standen unter Aufsicht. Gleichzeitig existierten ungeregelte Formen sexueller Ökonomie auf Straßen und in Wirtshäusern. Der Roman verankert seine Perspektive in diesem Milieu und führt durch Märkte, Vorstädte und Vergnügungsräume der Stadt. Er schildert Aufwachsen, Armut und sozialen Aufstieg aus der Unterschicht, ohne den Rahmen des spezifisch wienerischen Alltags um 1900 zu verlassen.
Das intellektuelle Klima der Wiener Moderne verband naturwissenschaftliche Autorität mit Tabudebatten. Sigmund Freuds 'Die Traumdeutung' (1900) und seine Schriften zur Sexualität trugen zur Psychologisierung privater Erfahrung bei. Zeitgleich diskutierten Sozialhygieniker, Juristen und Moralvereine über 'Sittlichkeit' und öffentliche Gesundheit. In der Literatur verschob Arthur Schnitzler mit 'Reigen' (1903, später skandalisiert) die Grenzen der Darstellung von Intimität; Karl Kraus kritisierte Presse und Doppelmoral. Der Roman steht in diesem Spannungsfeld: Er nutzt eine scheinbar dokumentarische, direkte Stimme, die Intimität als soziale Erfahrung in der Großstadt sichtbar macht, und spiegelt damit zentrale Diskurslinien des Fin de Siècle, ohne gelehrte Terminologie zu verwenden.
Die Publikationspraxis für erotische Texte war stark von Zensur und Strafrecht geprägt. In Österreich stellten Bestimmungen des Strafgesetzes Veröffentlichungen 'unzüchtiger Schriften' unter Strafe; Beschlagnahmen durch Staatsanwaltschaft und Sittenpolizei waren möglich. Viele einschlägige Titel erschienen anonym, im Privatdruck oder in Verlagen, die unter dem Ladentisch verkauften. 'Josefine Mutzenbacher' wurde 1906 anonym verbreitet und kursierte bald in zahlreichen, teils inhaltlich identischen, teils gekürzten Nachdrucken. In verschiedenen Ländern wurde das Buch über Jahrzehnte indiziert oder beschlagnahmt; zugleich blieb es ein Bestseller des Untergrundmarkts. Diese Doppelbewegung prägte seine Rezeption: offizielle Ächtung bei gleichzeitiger breiter, verdeckter Leserschaft.
Die Autorschaft ist bis heute nicht urkundlich gesichert. Früh schon kursierte die Zuschreibung an Felix Salten (1869–1945), jüdischer Wiener Journalist und Schriftsteller der Jung-Wien-Generation, der später mit 'Bambi' internationale Bekanntheit erlangte. Zeitgenössische Notizen, stilistische Indizien und Zeugnisse aus dem Wiener Literaturbetrieb stützen diese Annahme, ein eindeutiges Geständnis oder Verlagsvertrag ist jedoch nicht überliefert. Saltens Tätigkeit als Feuilletonist, Theaterkritiker und Erzähler, seine Nähe zu Kreisen um Schnitzler sowie sein Umgang mit Pseudonymen erklären, warum die Vermutung plausibel blieb. Nach 1933 wurden Saltens Schriften im Deutschen Reich verboten; er emigrierte 1939 in die Schweiz.
Formal verbindet der Text Elemente des Schelmenromans mit einer scheinbar mündlichen, autobiografischen Erzählhaltung. Das Wienerische, idiomatische Redeweisen und Milieuausdrücke erzeugen Nähe zur städtischen Alltagssprache. Gleichzeitig nutzt der Roman realistische Details der Topografie, der Arbeits- und Vergnügungswelten, wie sie in journalistischen Reportagen der Zeit ebenfalls auftauchen. Diese Mischung ordnet das Buch in Strömungen von Naturalismus und Sittenroman ein, die soziale Umwelt als prägende Kraft zeigen. Die Ich-Perspektive rahmt Erfahrungen als Abfolge urbaner Episoden und Kontakte über Klassengrenzen hinweg. Dadurch wird das Wien um 1900 nicht als Kulisse, sondern als Handlungsraum mit konkreten Regeln und Zwängen sichtbar.
Die Rezeption oszillierte zwischen Skandal und literarischer Aufwertung. In vielen Staaten galt der Text lange als anstößig und wurde beschlagnahmt oder nur unter Jugendverbot geführt; zugleich etablierte er sich als langlebiger Verkaufserfolg. Mit der Liberalisierung von Sittlichkeits- und Zensurbestimmungen in den 1960er/70er Jahren traten Neuauflagen, kommentierte Ausgaben und populärkulturelle Adaptionen hervor, darunter mehrere Filmfassungen in den 1970er Jahren. Seitdem widmet sich die Forschung verstärkt Sprache, Milieuschilderung und Überlieferungsgeschichte. 2022 thematisierte ein Dokumentarfilm von Ruth Beckermann die heutige Lektüre und die historische Position des Buches, ohne den anonymen Ursprung oder den Wiener Kontext zu verkennen.
Im historischen Rückblick fungiert 'Josefine Mutzenbacher' als Kommentar auf die Widersprüche der späten Habsburgermonarchie. Der Text macht sichtbar, wie städtische Modernisierung, Klassengesellschaft und geschlechtliche Machtverhältnisse mit behördlicher Kontrolle und bürgerlicher Moral kollidierten. Er dokumentiert Redeweisen, Räume und Praktiken des Wiener Alltags und zeigt, wie ökonomische Not und Ambitionen soziale Grenzen verschieben konnten. Die anonyme Form, der Vertrieb jenseits offizieller Kanäle und die anhaltende Zensurgeschichte verweisen zugleich auf die Empfindlichkeiten der Epoche. So lässt sich das Buch als literarische Quelle lesen, die die kulturellen Selbstbilder und ihre Verdrängungen um 1900 prägnant bündelt.
Josefine Mutzenbacher
Vorbemerkung
Josefine Mutzenbacher – ihr Name lautete in Wirklichkeit ein wenig anders – wurde zu Wien, in der Vorstadt Hernals am 20. Februar 1852 geboren. Sie stand frühzeitig unter sittenpolizeilicher Kontrolle, und übte ihr Gewerbe zuerst in wohlfeilen Freudenhäusern, der äußeren Bezirke, dann im Dienste einer Kupplerin, die während des wirtschaftlichen Aufschwungs- und Ausstellungsjahres 1873 die vornehmere Lebewelt mit Mädchenware versorgte.
Josefine verschwand damals mit einem Russen aus Wien, kehrte nach wenigen Jahren wohlhabend und glänzend ausgestattet in ihre Vaterstadt zurück, wo sie als Dirne der elegantesten Sorte noch bis zum Jahre 1894 ein auffallendes und vielbemerktes Dasein führte.
Sie bezog dann in der Nähe von Klagenfurt ein kleines Gut, und verbrachte ihre Tage in ziemlicher Einsamkeit, zu der sich dann bald auch ihre Erkrankung gesellte. Während dieser Krankheit, einem Frauenleiden, dem Josefine später auch erlag, schrieb sie die Geschichte ihrer Jugend.
Das Manuskript übergab sie, etliche Wochen vor der schweren Operation, an deren Folge sie starb, ihrem Arzt. Es erscheint hier als ein seltenes Dokument seelischer Aufrichtigkeit, als ein wertvolles und sonderbares Bekenntnis, das auch kulturgeschichtlich für das Liebesleben der Gegenwart Interesse verdient. An den Bekenntnissen der Josefine Mutzenbacher wurde im Wesentlichen nicht viel geändert. Nur sprachliche Unrichtigkeiten, stilistische Fehler wurden verbessert, und die Namen bekannter Persönlichkeiten, die Josefine in ihren Äußerungen meint, durch andere ersetzt.
Sie starb den 17. Dezember 1904 in einem Sanatorium.
Der Herausgeber
Erstes Kapitel
Man sagt, daß aus jungen Huren alte Betschwestern werden[1q]. Aber das trifft bei mir nicht zu. Ich bin frühzeitig zur Hure geworden, ich habe alles erlebt, was ein Weib im Bett, auf Tischen, Stühlen, Bänken, an kahle Mauerecken gelehnt, im Grase liegend, im Winkel dunkler Haustore, in chambres séparées[1], im Eisenbahnzug, in der Kaserne, im Bordell und im Gefängnis überhaupt nur erleben kann, aber ich bereue nichts von alledem[2q]. Ich bin heute bei Jahren, die Genüsse, die mein Geschlecht mir bieten kann, sind im Entschwinden begriffen, ich bin reich, bin verblüht, und sehr oft ganz vereinsamt. Aber es fällt mir nicht ein, obgleich ich immer fromm und gläubig gewesen bin, jetzt Buße zu tun. Aus Armut und Elend wie ich entstammt bin, habe ich alles meinem Körper zu verdanken. Ohne diesen gierigen, zu jeder Sinnenlust frühzeitig entzündeten, in jedem Laster von Kindheit auf geübten Körper, wäre ich verkommen, wie meine Gespielinnen, die im Findelhaus[4] starben oder als abgerackerte, stumpfsinnige Proletarierfrauen zugrunde gingen. Ich bin nicht im Dreck der Vororte erstickt[3q]. Ich habe mir eine schöne Bildung erworben, die ich nur einzig und allein der Hurerei verdanke, denn diese war es, die mich in Verkehr mit vornehmen und gelehrten Männern brachte. Ich habe mich aufklären lassen und gefunden, daß wir armen, niedrig geborenen Weiber nicht so viel Schuld haben, als man uns einreden möchte. Ich habe die Welt gesehen und meinen Gesichtskreis erweitert, und alles das verdanke ich meinem Lebenswandel, den man einen »lasterhaften« nennt. Wenn ich meine Schicksale jetzt aufschreibe, so tue ich das nur, die Stunden meiner Einsamkeit damit zu kürzen, und was mir jetzt abgeht, aus der Erinnerung wenigstens herbeizuschaffen. Ich halte das für besser als bußfertige Erbauungsstunden, die meinem Pfarrer wohl gefielen, die mir aber nicht zu Herzen gingen und mir nur eine grenzenlose Langeweile bereiten würden. Auch finde ich, daß der Lebensgang von Meinesgleichen nirgends aufgeschrieben steht. Die Bücher, die ich danach durchsucht habe, erzählen nichts davon, und es wäre vielleicht doch gut, wenn die vornehmen und reichen Herren, die sich an uns ergötzen, die uns locken und sich von uns alle unmöglichen Dinge aufbinden lassen, einmal erfahren würden, wie es in einem jener Mädchen aussieht, die sie so brünstig in ihre Arme schließen, woher es stammt, was es erlebt hat, und was es denkt.
* * * * *
Mein Vater war ein blutarmer Sattlergehilfe, der in einem Geschäft in der Josefstadt arbeitete. Wir wohnten ganz weit draußen in Ottakring, in einem damals neuen Hause, einer Zinskaserne[2], die von oben bis unten mit armen Leuten angefüllt war. Alle diese Leute hatten viele Kinder, und im Sommer war der Hof zu klein für ihre Schar. Ich selbst besaß zwei Brüder, die beide um wenige Jahre älter waren als ich. Mein Vater, meine Mutter, wir drei Kinder wohnten in einer Küche und einem Zimmer und hatten noch einen Bettgeher[3] mit dazu. Solche Bettgeher waren der Reihe nach wohl ein halbes hundert bei uns; sie kamen und gingen, bald friedlich, bald in Streit, und die meisten von ihnen verschwanden spurlos, ohne daß wir jemals wieder etwas von ihnen hörten. Ich erinnere mich hauptsächlich an zwei von ihnen. Der eine war ein Schlossergeselle, ein schwarzer, traurig aussehender Bursche, der ganz kleine schwarze Augen hatte, und immer voll Ruß im Gesicht war. Wir Kinder fürchteten uns vor ihm. Er war auch immer schweigsam und sprach kein Wort. Ich entsinne mich, daß er eines Nachmittags nach Hause kam, während ich allein in der Wohnung mich befand. Ich war damals fünf Jahre alt und spielte am Boden des Zimmers. Meine Mutter war mit den beiden Buben am Fürstenfeld[5], mein Vater von der Arbeit noch nicht zurück. Der Schlosser nahm mich vom Boden auf und hielt mich auf seinem Schoß. Ich wollte schreien, aber er sagte leise: »Sei stad, ich tu' dir nix!« Und dann legte er mich zurück, hob mein Röckchen auf, und betrachtete mich, wie ich nackt vor ihm auf seinen Knien lag. Ich fürchtete mich sehr vor ihm, aber ich verhielt mich ganz still. Wie er meine Mutter kommen hörte, setzte er mich rasch auf den Fußboden und ging in die Küche. Ein paar Tage später kam er wieder frühzeitig nach Hause und die Mutter ersuchte ihn auf mich aufzupassen. Er versprach es, und hielt mich wieder die ganze Zeit auf seinen Knien, in Betrachtung meines nackten Mittelstückes begriffen. Er sprach kein Wort, sondern schaute nur immer auf die eine Stelle hin, und ich traute mich auch nicht, etwas zu reden. Das wiederholte sich, solange er bei uns wohnte, einigemale. Ich begriff nichts davon, und machte mir auch, nach Kinderart, keine Gedanken darüber. Heute weiß ich, was das bedeutet hat, und nenne den Schlossergesellen oft meinen ersten Geliebten.
Von dem zweiten Bettgeher werde ich später reden.
Meine beiden Brüder Franz und Lorenz waren sehr ungleich. Lorenz, der älteste, er war um vier Jahre älter als ich, war immer sehr verschlossen, in sich gekehrt, fleißig und heilig. Franz, der nur anderthalb Jahre mehr zählte als ich, war dagegen lustig, und er hielt sich auch viel mehr zu mir als zum Lorenz. Ungefähr sieben Jahre war ich alt geworden, als ich eines Nachmittags mit Franz zu Nachbarskindern auf Besuch ging. Es war auch ein Bruder und eine Schwester, und diese Kinder waren immer allein, weil sie keine Mutter hatten, und ihr Vater in die Arbeit gehen mußte. Die Anna war damals schon neun Jahre alt, ein blasses, mageres, weißblondes Mädchen mit einer gespaltenen Lippe. Und ihr Bruder Ferdl, ein dreizehnjähriger, robuster Bub, auch ganz weißblond, aber rotwangig und breitschultrig. Wir spielten zuerst ganz harmlos. Da sagte die Anna auf einmal: »Spiel'n wir doch Vater und Mutter.« Ihr Bruder lachte und sagte: »Die will immer nur Vater und Mutter spielen.« Aber Anna bestand darauf, trat zu meinem Bruder Franz und meinte: »Also du bist der Mann und ich bin die Frau.« Und Ferdl war gleich bei mir, faßte mich am Arm und erklärte: »Da bin dann halt ich dein Mann und du meine Frau.« Sofort nahm Anna zwei Polsterüberzüge, machte zwei Wickelkinder daraus, und gab mir eines. »Da hast dazu ein Kind«, meinte sie. Ich begann die Lappendocke gleich zu wiegen, aber Anna und Ferdl lachten mich aus. »So geht das nicht. Z'erst muß man das Kind machen, dann muß man in der Hoffnung sein, dann muß man es kriegen, und dann erst kann man's hutschen!« Ich hatte natürlich schon manchmal davon reden gehört, daß Frauen »in der Hoffnung« sind, daß sie ein Kind kriegen werden. An den Storch glaubte ich auch nicht mehr so recht, und wenn ich Frauen mit einem großen Bauch sah, wußte ich ungefähr, was das bedeutet. Aber genauere Vorstellungen davon hatte ich bisher nicht gehabt. Auch mein Bruder Franz nicht. Wir standen deshalb gänzlich verdutzt und ratlos da, und wußten nicht, wie wir dieses Spiel werden versuchen, oder uns daran beteiligen können. Aber Anna war schon zu Franz getreten und griff nach seinem Hosentürl. »Komm nur«, sagte sie, »tu ihn heraus, dein' Zipfel!« Und dabei hatte sie ihm die Hose auch gleich aufgeknöpft und seinen »Zipfel« zum Vorschein gebracht. Ferdl und ich sahen zu. Ferdl lachend. Ich mit einem Gefühl, das aus Neugierde, Staunen, Entsetzen und noch einer besonderen, mir bisher fremden Erregung gemischt war. Franz stand ganz bewegungslos da, und wußte nicht, wie ihm geschah. Unter Annas Berührung richtete sich sein »Zipfel« ganz steif in die Höhe. »Jetzt komm«, hörte ich Anna leise flüstern. Ich sah, wie sie sich auf den Boden warf, ihre Röcke hob und die Beine spreizte. In diesem Moment ergriff mich Ferdl. »Leg dich nieder«, zischelte er mir zu, und dabei spürte ich auch schon seine Hand zwischen meinen Beinen. Ganz willig legte ich mich auf den Boden, hatte meine Röcke aufgeschlagen, und Ferdl rieb sein steifes Glied an meiner Fut. Ich mußte lachen, denn sein Schwanz kitzelte mich nicht wenig, weil er mir auch auf dem Bauch und sonst überall herumfuhr. Er keuchte dabei, und lag schwer auf meiner Brust. Mir kam das Ganze unsinnig und lächerlich vor, nur eine kleine Aufregung war in mir, und nur dieser allein ist es wohl zuzuschreiben, daß ich liegen blieb, ja sogar ernsthaft wurde. Ferdl wurde plötzlich ruhig und sprang auf. Ich erhob mich gleichfalls, und er zeigte mir jetzt seinen »Zipfl«, den ich ruhig in die Hand nahm. Ein kleiner heller Tropfen war auf der Spitze zu sehen. Dann zog Ferdl die Vorhaut zurück, und ich sah die Eichel zum Vorschein kommen. Ich schob nun die Vorhaut ein paarmal hin und her, spielte damit, und freute mich, wenn die Eichel, wie der rosige Kopf eines kleinen Tieres hervorspitzte. Anna und mein Bruder lagen noch auf dem Boden, und ich sah, wie Franz ganz aufgeregt hin und her wetzte. Er hatte rote Wangen und keuchte, ganz wie Ferdl vorhin. Aber auch Anna war ganz verändert. Ihr bleiches Gesicht hatte sich gefärbt, ihre Augen waren geschlossen, und ich glaubte, ihr sei schlecht geworden. Dann wurden die beiden auch plötzlich still, lagen ein paar Sekunden aufeinander, und standen dann auf. Wir saßen eine Weile zusammen. Ferdl hielt mich unter den Röcken mit der Hand an der Mitte, Franz tat dasselbe mit Anna. Ich hatte Ferdls Schwanz in der Hand, Anna den meines Bruders; und es war mir ganz angenehm, wie Ferdl bei mir herumfingerte. Es kitzelte mich, aber nicht mehr so, daß ich lachen mußte, sondern so, daß mir ein Wohlgefühl durch den ganzen Körper lief. Diese Beschäftigung wurde von Anna unterbrochen, die jetzt die beiden Puppen nahm, von denen sie die eine sich selbst unter das Kleid auf den Bauch legte, die andere mir. »So«, sagte sie. »Jetzt sind wir in der Hoffnung.« Wir zwei gingen nun im Zimmer herum, streckten unsere ausgestopften Bäuche heraus und lachten darüber. Dann brachten wir unsere Kinder zur Welt, wiegten sie in den Armen, gaben sie unseren Ehemännern, damit sie sie halten und bewundern sollten, und spielten eine Weile wie unschuldige Kinder. Anna kam auf die Idee, daß sie ihr Kind säugen müsse. Sie knöpfte ihre Jacke auf, zog das Hemd herab und tat so, als ob sie einem Kind die Brust reichen würde. Ich bemerkte, daß sie schon leise anschwellende Warzen hatte; und ihr Bruder trat hinzu und spielte damit; auch Franz machte sich bald an Annas Brust zu schaffen, und Ferdl meinte, es sei schade, daß ich keine Duteln habe. Dann kam eine Erklärung vom Kindermachen. Wir erfuhren, daß das, was wir eben getan hatten vögeln heiße, daß unsere Eltern dasselbe tun, wenn sie miteinander im Bett liegen, und daß die Frauen davon die Kinder bekämen. Ferdl war schon ein Ausgelernter. Er sagte uns Mädchen, daß unsere Fut noch zugewachsen sei, daß man deshalb nur von außen daran herumwetzen könne. Er sagte ferner, daß wir einmal, wenn wir größer werden, Haare darauf bekommen, daß dann unser Loch sich öffnen wird, und daß man dann mit dem ganzen Schwanz hineinfahren können wird. Ich wollte es nicht glauben, aber Anna erklärte mir, Ferdl wisse das ganz genau. Er habe auf dem Boden die Frau Reinthaler gevögelt, und da sei sein Schwanz ganz in ihr Loch hineingegangen. Die Frau Reinthaler war die Frau eines Tramwaykondukteur[6]s, der in unserem Haus im letzten Stock wohnte. Es war eine dicke, schwarze Frau, klein und hübsch und immer sehr freundlich. Ferdl erzählte uns die Geschichte: »Die Frau Reinthaler ist vom Waschen 'kommen. Ein' ganzen Korb voller Wäsch' hats 'tragen, und ich bin g'rad auf der Stieg'n g'wesen. Na, und wie ichs grüßt hab' sagt sie zu mir: ›Geh Ferdl, bist ein starker Bub, könntst mir wirklich helfen, den schweren Korb am Boden tragen.‹ So bin ich halt mit ihr auffi gangen, und wie wir droben sein, fragt sie mich, ›was willst denn jetzt dafür, daß du mir g'holfen hast?‹ – ›Nix‹, sag ich drauf. ›Komm, ich zeig' dir was‹, sagt sie, packt mich bei der Hand und legt sich's auf die Brust. ›Gelt ja, das ist gut?‹ Da hab' ich schon g'wußt, was los ist, denn mit der Anna hab' ich ja schon oft früher gewetzt – was?« – Anna nickte bekräftigend, als ob sich das alles ganz von selbst verstünde, Ferdl fuhr fort: »Aber ich hab' mich doch nicht getraut, und hab' nur ihre Brust fest z'sammendruckt. Sie hat sich gleich ihr Leibl aufg'macht, und hat mir's alser nackter herausgeben, und hat mich spielen lassen, und dann hat's mich bei der Nudel packt, und hat alleweil gelacht, und hat g'sagt: ›Wenn's d' niemanden was ausplauschen möchst, derfest noch was andres tun …‹ – ›Ich red' nix‹, hab' ich drauf g'sagt, – ›g'wiß nix?‹ fragt sie noch amal. ›Nein, g'wiß nix.‹ Na da hat sie sich übern Wäschkorb g'legt, und hat mich auf sich g'nommen, und hat mir den Schwanz mit der Hand hineingesteckt in ihre Fut. Ganz drinn war er, ich hab's ganz genau g'spürt. Und die Haar, was sie drauf hat, hab' ich auch g'spürt.«
Anna wollte noch nicht, daß die Erzählung aus sei. »War's gut?« forschte sie weiter. »Sehr gut war's«, antwortete Ferdl trocken, »und g'stoßen hat sie, wie nicht g'scheit, und druckt hat's mich, und mit ihre Duteln hab' ich spielen müssen. Und wie's dann aus war, is sie rasch aufg'sprungen, hat sich ihr Leibl zuknöpfelt und hat ein ganz böses Gesicht g'macht. ›Schau, daß d' weiterkommst, du Lausbub‹, hat's zu mir g'sagt, ›und wenn du dich verplauscht, reiß' ich dir dein Schädel aber …‹« Ferdl machte ein ganz nachdenkliches Gesicht. Anna aber meinte plötzlich: »Glaubst du nicht, daß er bei mir schon hineingeht?« Ferdl sah sie an, sie hielt noch immer ihr Puppenkind an der bloßen Brust, und er griff sie an, strich wie versuchend daran herum, und sie entschied endlich: »Versuch's ein bißl …« – »Alsdann spielen wir wieder Vater und Mutter«, schlug Anna vor. Franz ging gleich zu ihr, und auch ich nahm jetzt, nach all den Belehrungen, die ich empfangen hatte, und nach der Geschichte, die ich eben vernommen, diesen Vorschlag bereitwillig an. Aber Anna wies Franz von sich. »Nein«, sagte sie, »jetzt soll der Ferdl mein Mann sein, und du bist der Pepi ihrer.« Damit rückte sie ihrem Bruder an die Seite, schob ihre Hand in seinen Hosenspalt, und er griff ihr sogleich unter die Röcke. Ich packte Franz und erinnere mich, daß ich das mit einer starken Aufregung tat. Als ich seine kleine bloße Nudel aus der Hose nahm, und die Vorhaut auf- und niederschob, spielte er mit seinen Fingern an meinem Loch, und da wir jetzt beide wußten, wie's gemacht wird, lagen wir in der nächsten Sekunde auf dem Boden, und ich regierte mit der Hand seinen Zapfen so genau, daß er mir nicht den Bauch hinauffuhr, sondern mich genau in meiner Spaltung bestreichelte. Dies machte mir ein Vergnügen, von dem ich im ganzen Körper eine wohlige Spannung verspürte, so daß auch ich mich gegen ihn rieb und wetzte, wann ich nur konnte. Das dauerte eine Weile, bis Franz erschöpft auf mich fallend niedersank und sich nicht rührte. Wir lagen ein paar Momente so, dann hörten wir einen Disput zwischen Ferdl und Anna, und schauten nach, was sie machten. Sie lagen noch immer aufeinander, aber Anna hielt ihre beiden Beine so hoch, daß sie über Ferdls Rücken sich berührten. »Er geht schon hinein …« sagte Ferdl, aber Anna meinte: »Ja, hinein geht er, aber weh tut's – laß gehn, es tut weh.« Ferdl beruhigte sie: »Das macht nix, – das ist im Anfang – wart nur, vielleicht geht er ganz hinein.« Wir legten uns flach auf den Boden, rechts und links von den beiden, um festzustellen, ob Ferdl drin sei oder nicht. Er war wirklich ein wenig drin. Der untere Teil von Annas Fummel war breit geöffnet, wie wir mit Staunen wahrnahmen, und da drinnen steckte Ferdls Schwanz bis über den Kopf und fuhr unbeholfen hin und her. Wie Ferdl eine heftige Bewegung machte, glitt er ganz hinaus, aber ich ergriff ihn sofort und fügte ihn wieder in Annas Eingang, der mir schon ganz rotgerieben vorkam. Ich hielt ihn fest, und versuchte ihn tiefer hineinzudrängen. Ferdl selbst stieß in der Richtung, die ich ihm gab, kräftig nach, aber Anna fing auf einmal laut zu schreien an, so daß wir erschrocken auseinanderfuhren. Sie weigerte sich, das Spiel fortzusetzen, und ich mußte Ferdl noch einmal auf mich nehmen, weil er sich nicht beruhigen wollte. Nun war aber auch ich einigermaßen rot gerieben, und weil es inzwischen schon Zeit wurde, gingen wir heim. Mein Bruder und ich sprachen auf dem Weg in unsere Wohnung kein Wort. Wir wohnten auch im letzten Stockwerk dieses Hauses, Tür an Tür mit der Frau Reinthaler. Als wir oben auf dem Gang ankamen, sahen wir die kleine dicke Frau im Gespräch mit einer anderen Nachbarin stehen. Wir gafften sie an und begannen laut zu lachen. Als sie sich nach uns umdrehen wollte, flüchteten wir in unsere Tür.
Seit jenem Tage betrachtete ich Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen mit völlig veränderten Blicken. Ich war erst sieben Jahre alt, aber meine Geschlechtlichkeit kam voll zum Ausbruch. Sie muß in meinen Augen zu lesen gewesen sein, mein ganzes Gesicht, mein Mund, mein Gang muß eine einzige Aufforderung gewesen sein, mich anzupacken und hinzuschmeißen. Nur so kann ich mir die Wirkung erklären, die damals schon von mir ausging, die ich in der Folge übte, und die es zustande brachte, daß fremde und wie mir scheint, besonnene Männer gleich bei der ersten Begegnung mit mir alle Vorsicht außer Acht ließen und unbedenklich alles wagten. Diese Wirkung kann ich auch jetzt noch bemerken, wo ich weder jung bin noch schön und wo mein Körper welk geworden und die Spuren meines Wandels greifbar zu erkennen gibt. Trotzdem gibt es noch Männer, die auf den ersten Blick von mir in Flammen geraten und sich dann in meinem Schoß wie die Rasenden gebärden. Diese Wirkung mag schon viel früher tätig gewesen sein, als ich noch wahrhaft unschuldig war, und vielleicht ist sie es gewesen, die den Schlossergesellen dazu trieb, die Scham der Fünfjährigen zu entblößen.
Ein paar Tage später waren wir Kinder allein zu Hause, und da begann der Franz den Lorenz zu fragen, ob er denn wisse, woher die Kinder kommen und wie sie gemacht werden. Lorenz meinte: »Weißt du's vielleicht?« Franz und ich lachten, und ich holte Franzens kleinen Stift aus dem Hosentürl, streichelte ihn ein wenig, während Lorenz mit ernster Miene zusah, wie Franz mich an meiner Spalte kitzelte. Dann legten wir uns aufs Bett und spielten unser Stückchen, das wir von Anna und Ferdl gelernt hatten, mit allem Talent herunter. Lorenz sprach kein Wort, auch nicht, als wir fertig waren, aber als ich mich ihm näherte, und die Hand in seine Hose stecken wollte, indem ich ihm sagte: »Komm, jetzt mußt du's auch probieren …« stieß er mich weg und zu unserem großen Erstaunen erzählte er: »Das Vögeln kenn' ich schon längst. Glaubt's ihr vielleicht, ich werd' auf euch warten? Aber das darf man nicht. Das ist eine schwere Sünd', Unkeuschheit ist das, und wer vögelt, kommt in die Höll'.« Wir erschraken nicht wenig, aber dann bestritten wir die Behauptung. »Glaubst du am End'«, fragten wir ihn, »daß der Vater und die Mutter auch in die Höll' kommen?« Er war fest überzeugt davon, und gerade deshalb gaben wir alle Angst auf und verhöhnten ihn. Lorenz aber drohte, er werde uns beim Vater, beim Lehrer und beim Katecheten verklagen, und seitdem haben wir unsere kleinen Vergnügungen niemals wieder in seiner Gegenwart vorgenommen. Er wußte trotzdem, daß Franz und ich fortfuhren, aufeinander zu liegen, oder uns mit anderen Kindern abzugeben; aber er schwieg und wich uns aus.