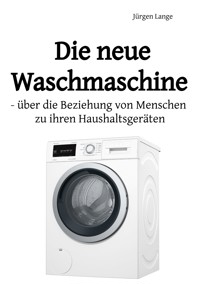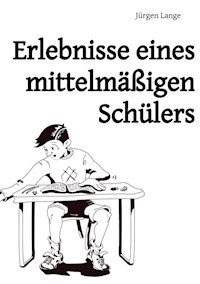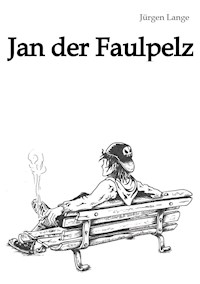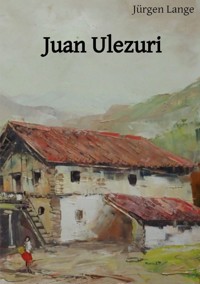
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wir befinden uns in einem Dorf in Bizkaia im 18. Jahrhundert, als eine schwere Hungersnot die althergebrachten Lebensbedingungen verändert. Die neuen Wirtschaftsbedingungen nach der Aufgabe der Dreifelderwirtschaft verunsichern die konservative Dorfbevölkerung. Als dann auch noch die kleine Maria tot aufgefunden wird, scheint die göttliche Ordnung vollständig außer Kontrolle zu geraten. Einige Bauern vermuten in den zahlreichen Veränderungen sogar das Werk des Antichristen. Die Serie von brutalen Verbrechen bedroht das gesellschaftliche Zusammenleben zunehmend, als unser Protagonist wider Willen zum Dorfvorsteher ernannt wird. Zusammen mit dem Richter und dem Barbier versucht er, Licht ins Dunkel zu bringen. Juan Ulezuri erzählt uns in seinen Memoiren von seinen Erfolgen und Rückschlägen. Der vorliegende Band ist nicht nur ein Kriminalroman, sondern darüber hinaus auch eine gelungene Beschreibung bäuerlicher Lebens- und Arbeitsweisen in der Zeit vor der Industrialisierung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VORWORT
Eigentlich wollte ich Historiker werden, doch leider wurde nichts daraus. Als ich im Sommer 1990 erstmals das Baskenland besuchte, wusste ich das aber noch nicht. Der Aufenthalt fern der Heimat sollte dazu dienen, eine Abschlussarbeit über die Agrarrevolution im XVIII. Jahrhundert zu schreiben. In Bizkaia wird diese Revolución del Maíz genannt und beschreibt die landwirtschaftliche Transformation, welche die Industrialisierung der Region 100 Jahre später erst ermöglichte. Auf der Suche nach einem geeigneten Dorf mit einem möglichst umfangreichen Archiv verirrte ich mich in eine Gemeinde, die vor 300 Jahren noch Santo Tomás de Olabarrieta hieß.
Wenn ich behaupte, dass hier der Hund begraben ist, dann ist das eine glatte Untertreibung. Zwar erscheint der Name dieser Gemeinde auf der Provinzstraßenkarte - man kann dort erkennen, wie sich die einzige Straße weit und breit als weißer Strich durch das ansonsten weite Grün zieht. - Doch ist der Ort geradezu märchenhaft verschlafen, obwohl er nur 25 km von der Metropole Bilbao entfernt ist.
Der erste Eindruck war ernüchternd: Die einzige Industrie in diesem Ort sind drei Sägewerke. Der Rest der berufstätigen Bevölkerung arbeitet entweder in der Land-, Vieh- oder Forstwirtschaft oder fährt zur Arbeit in die Stadt. Gleichzeitig finden sich an jeder Ecke Reste der Architektur aus dem 18. Jahrhundert wie Kapellen und Bauernhöfe. Die steinernen Bogenbrücken ohne Geländer sind wunderschön, allerdings verlieren sie schlagartig ihren Charme, wenn man sie mal benutzen muss. Alles in allem scheint das Dorf die letzten 300 Jahre in einer Art Dornröschenschlaf verbracht zu haben; ideale Bedingungen für einen Historiker.
Der Dorfplatz war bald gefunden. Wie sollte ich mich bei nur einer Straße auch verfahren? Und das Rathaus als solches war bereits von weitem zu erkennen. Ein großes Bauernhaus mit zwei Bögen aus Kalkstein im Erdgeschoss und schmiedeeisernen Balkongeländern im ersten Stock. An einem der letzteren wehte eine baskische Fahne: ein weißes Balkenkreuz auf einem grünen Andreaskreuz auf rotem Grund.
Der zweite Eindruck war anders als der Erste geradezu berauschend: Ich betrat das Dorfarchiv, und traute meinen Augen nicht. Zur Erklärung muss ich hier etwas weiter ausholen. Deutschland ist für viele aufgrund seiner wirtschaftlichen Leistungen eine Weltmacht; Spanien dagegen ist Empfänger von Hilfsgeldern zur Förderung der Infrastruktur, Produzent von leckerem Rioja und nicht so leckerem Sangría-Wein. Das war aber nicht immer so. Vor dreihundert Jahren war Spanien eine Weltmacht, was man weder vom deutschen Reich des 18. noch von den deutschen Kleinstaaten des 19. Jahrhunderts behaupten kann. In der Folge war die Verwaltung im europäischen Norden nicht so weit entwickelt wie im Süden. Der Bestand an Akten aus jener Zeit ist in den meisten deutschen Archiven überschaubar und die Serien jährlich erscheinender Dokumente wie Haushaltsrechnungen oder Notariatsprotokolle sind eigentlich immer lückenhaft. Wir hatten eben nie sehr viele schriftliche Zeugnisse aus jener Zeit, und die wenigen Dokumente haben wir dann auch noch durch zwei Weltkriege dezimiert.
In meinem baskischen Archiv fiel mir auf, dass die Rechnungsbücher der Gemeinde für das 18. Jahrhundert vollständig waren: Über einhundert Jahre in Leder gebundene Haushaltsabschlüsse, von denen nicht ein einziger Jahrgang fehlte!
Fairerweise muss hier angefügt werden, dass weder der komplette Bestand katalogisiert war, noch die Lagerbedingungen dem neusten Stand entsprachen. Ein Teil der Akten lagerte seit Jahrhunderten in einem uralten Eichenschrank mit drei Schlössern. Die Schlüssel dieses Holztresors wurden damals zum Zweck der gegenseitigen Kontrolle drei verschiedenen Mitgliedern der Gemeindeverwaltung anvertraut.
Mit meinen Glücksgefühlen im Dorfarchiv stand ich allerdings ziemlich allein. Mehr noch, die Mehrheit der in der Dorfkneipe versammelten Bauern zweifelte an meinem Verstand, als sie hörten, dass ich die Tage im Archiv und die Nächte lesend im Bett verbrachte. Der Rest der Dorfbevölkerung stimmte ihnen zu, als ich zugeben musste, dass ich dafür kein Geld erhielt, denn alle meine Stipendienanträge waren abschlägig beschieden worden.
Bei meinen Besuchen in der Dorfkneipe wurde der Gegensatz der Kulturen besonders offensichtlich. Sobald ich in das dunkle und verrauchte Loch eintrat, herrschte plötzlich Totenstille. Also bestellte ich bei der Wirtin mein Bier, musste meine Bestellung aber jedes Mal wiederholen. Es waren mehrere Besuche und eine ganze Anzahl Biere nötig, bis ich endlich begriff, dass die Dame gar nicht schwerhörig war. Der Grund für ihr sonderbares Verhalten war meine fehlerhafte Aussprache. Und zwar war ich einfach nicht in der Lage, das gerollte spanische R - ein stimmhafter alveolarer Vibrant, [r] - korrekt auszusprechen. Dies bereitete allen Anwesenden mehr Vergnügen als der permanent laufende Fernseher, sodass ich meine Bestellungen stets zweimal vortragen durfte. Gerechterweise muss ich zugeben, dass das spanische Zungen-R auch recht wenig mit dem von mir benutzten deutschen Zäpfchen-R zu tun hat - einem stimmhaften uvularen Frikativ, [ʁ]. - Um mich aber nicht länger zum Gespött der Wirtin und ihrer Klientel zu machen, veränderte ich meine Bestellungen in der Taverne sofort von „cerveza“ und „sidra“ zu „una taza de café“ und „un chiquito de vino tinto“. Kein R, kein Problem!
Da ich den Bürgermeister nichts kostete, ließ er mich im Archiv arbeiten; und da ich kein Stipendium hatte, wohnte ich beim Dorfpfarrer. Als Miete akzeptierte er gelegentliche Botengänge und samstags Hilfe beim Renovieren baufälliger Dorfkapellen. Davon gab es über ein Dutzend und, ja, sie waren alle baufällig!
Mit meinem Projekt kam ich schnell voran und nach nur drei Jahren stand meine Arbeit in diesem verschlafenen Dorf kurz vor ihrem erfolgreichen Abschluss - wenn wir mal vom rollenden „R“ absehen. Für das letzte Kapitel meiner Untersuchung suchte ich nach einem Arbeitsvertrag über den Bau der Dorfstraße, den Camino Real. Plötzlich fiel mir auf, dass der Kopfteil des alten Eichenschranks im Dorfarchiv gar nicht wie sonst üblich ein nur aufgesetztes Zierelement war. Im Gegenteil, dort versteckte sich ein weiteres Fach, das ich all die Jahre völlig übersehen hatte. Von Neugierde getrieben stieg auf meinen Stuhl, um die Hand in das Geheimfach zu stecken, und fiel vor Schreck fast vom Hocker, als ich feststellte, dass es wider Erwarten nicht leer war. Auf diese Weise fand ich die Handschrift, die ich nun vorstellen möchte. Nachdem ich das dunkle Leder mit einem Tuch vom Staub befreit hatte, kam auch sein Titel zum Vorschein:
Juan Ulezuri
❦
Inhaltsverzeichnis
I – Die Vier Reiter (1710 – 1714)
II – Beti Nagusia (1715 – 1725)
III – Die Kapelle von Elesbaso (1726 – 1752)
IV – San Juan Bagilea (1753 – 1755)
V – Der Herr der Bögen (1756 – 1758)
VI – Der Überfall auf den Hof von Pedro de Gesala (1759 – 1764)
VII – Das Ende des Weges (1765 – 1804)
❦
I – DIE VIER REITER (1710 - 1714)
„Da sah ich ein fahles Pferd; und der, der auf ihm saß, heißt «der Tod»; und die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde, Macht, zu töten durch Schwert, Hunger und Tod die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren, riefen mit lauter Stimme: «Wie lange zögerst du noch, Herr, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen?»”
Johannes’ Offenbarung, 6, 8-10
„Die vorherrschende Farbe auf unseren Feldern war das Hellbraun des ausgetrockneten Bodens und nicht das blasse Gelb der Weizenähren, welches sonst um diese Jahreszeit so dominant war. So ähnlich beide Farben auch sein mögen, wenn du sie auf deinem Acker siehst, liegt eine Welt zwischen ihnen: letztere verspricht dir und deiner Familie etwas Sicherheit für einige Monate, erstere dagegen repräsentiert Mangel, Entbehrung und Hunger.
Der Weizen war größtenteils nicht aufgegangen und die wenigen Halme, die aus dem Boden ragten, waren kümmerlich gewachsen. Sie waren nicht nur insgesamt kleiner als normal, sondern trugen auch nur wenige, winzige Körner. Dasselbe tragische Bild wiederholte sich überall im Tal: in den höher gelegenen Vierteln mit ihren guten Böden in bester Lage ebenso wie hier unten in der Nähe des Flusses, wo die Erträge selbst in normalen Jahren wegen der schlechten Bodenqualität schon geringer ausfielen.
Garila, „Monat des Weizens“, so nennen wir hier die Jahreszeit, wenn die Ähren aufgrund ihres Gewichtes an den Halmen herabhängen sollten und nicht aufgrund fehlenden Wassers. Im Juli sollte der Weizen die Landschaft gold anmalen, so dass, wenn der Wind in die Ähren greift, diese sich in Harmonie mit dem Luftstrom bewegen. Doch in diesem Sommer gab es keine Harmonie, keinen zärtlichen Luftstrom im Rhythmus einer himmlischen Musik … , nichts von alledem.
Die Natur gab kein Lebenszeichen von sich. Man nahm überhaupt keine Bewegung wahr. Und die einzige Bewegung, die ich wahrnahm, war eine Täuschung: die heiße Luft auf den rosaroten Dachpfannen schlängelte sich nach oben, so dass die Bäume im Hintergrund sich von Zeit zu Zeit nach links und dann nach rechts zu bewegen schienen. Selbst die Luft schien zu fliehen, weg vom Elend hier unten.
Es war nicht notwendig, den Kopf zu heben, um sich zu überzeugen, dass sich keine einzige Wolke am Himmel befand. Es bestand absolut keine Aussicht auf Regen. Wer nun doch den Kopf hob, der sah ein grenzenloses Blau und die alles versengende Sonne. Doch die Nachbarn schauten längst nicht mehr nach oben, sei es nun, um eine nutzlose Bewegung einzusparen, oder weil sie schon längst alle Hoffnung auf besseres Wetter verloren hatten. Sie ertrugen die Hitze mit hängenden Köpfen, ganz so wie die Ähren auf dem Acker. Und das war auch nicht weiter erstaunlich, denn diese unglaubliche Hitze lähmte jede Art von Bewegung.
Meist war es windstill, und wenn doch einmal ein Lüftchen durch unser Tal ging, dann brachte einem dieses kaum die erhoffte Abkühlung. Eigentlich passierte genau das Gegenteil, denn die Luft war voller Staub. Es war ein sehr feiner Staub, der sich auf dein Gesicht legte, und wenn du gerade den Mund offen hattest, dann bedeckte er dir auch noch die Zunge. Der Staub drang in die Kleidung, er vermischte sich mit dem Schweiß auf der Stirn, er biss in den Augen und beschmutzte dein Gesicht. Derselbe Staub machte das weiße Hemd dunkler und das schwarze Hemd heller, bis alles hellbraun war. Dasselbe Hellbraun zeigte sich auf unseren Jacken und Hosen.
Wenn du dir am Morgen die Kleidung abgeklopft hattest, um anständig auszusehen, dann hatte der Staub dich bis zum Mittag bereits wieder in eine hellbraune Person verwandelt. Alle Unterschiede zwischen den Dorfbewohnern wurden vom gleichmachenden, hellbraunen Staub überdeckt. Wir sahen aus wie uniformierte Soldaten. Ja, in jenem Sommer sahen wir aus wie ein Herr von Soldaten, ein geschlagenes Heer, das den Willen zu kämpfen verloren hatte.
Im Jahre des Herrn 1710 war unser Herr und König bereits mehrere Jahre tot und niemand regierte uns. Die vergangenen zehn Jahre ritt ein Reiter durch das Königreich, er entbrannte Kriege, säte den Tod und vergoss Ströme von Blut. Und das war der Grund, weshalb man ihn den Reiter auf dem roten Pferd nannte. Wir erhielten grausame Nachrichten, dass bedeutende Städte erobert worden waren. Es gab keine Sieger, nur Besiegte. Und so interessierte es uns auch längst nicht mehr, welche Partei gewinnen würde, sondern nur wann dieser Krieg endlich endete. Doch genau das geschah nicht.
Je länger dieser Krieg andauerte und je mehr Gräueltaten zu uns drangen, desto weniger interessierten sie uns noch. Ja! Wir verloren unser Mitgefühl, und immer größere Schrecken berührten uns immer weniger. Außerdem geschah dies alles ja weit weg von unserem Dorf, denn die Kriegstruppen waren noch nicht in unsere Heimat gedrungen, das Señorío de Bizkaia. Was sollte es mich auch groß kümmern, wenn ein mir unbekannter Teil des Königreichs zugrunde ging, der so weit entfernt war, dass ich ihn nie im Leben besuchen würde? Keine Ahnung, mein Sohn, ich habe keine Ahnung! Wir sind so unwissend!
Für den Rest der Welt mag unser Dorf unbedeutend sein, doch für uns, die wir in diesem Tal leben, bedeutet es einfach alles, denn wir haben sonst nichts. Es sind diese Bauernhöfe, die uns einen Namen geben und uns Sinn und Bedeutung verleihen. Hier erblicken wir das Licht der Welt, hier leben und arbeiten und hier sterben wir auch: Das ist unsere Welt im Diesseits, das ist alles. Außerdem befanden wir uns ja zu dieser Zeit selbst im Elend. Wenn du Hunger leidest, ersparst du dir die Nächstenliebe. Kannst du das verstehen?
Wir führten unser sündiges Leben fort, und so stellte uns der Herr erneut auf die Probe. 1710 litten wir schon das zweite Jahr unter Wassermangel. Zwei lange, so immens lange Sommer mit Trockenheit, und zwei aufeinander folgende schlechte Ernten. Die Ernte 1709 war nicht gut, doch wir konnten den Mangel ausgleichen, indem wir Weizen von der Meseta einführten. Dadurch stieg zwar der Getreidepreis, aber, nun, wir überstanden das Jahr irgendwie. Das Jahr 1710 war viel schlimmer, denn unsere Industrie kam zum völligen Stillstand. Ohne zusätzliche Einkünfte aber fehlten uns die Mittel, um Getreide dazu zu kaufen, unabhängig davon, wie viel es kostete.“
❦
Der Großvater schwieg, doch sein Mund stand noch offen. Seine weit geöffneten Augen und sein in die Ferne starrender Blick zeigten mir an, dass sein Geist in diesem Moment abwesend war. Von Zeit zu Zeit murmelte er Sätze wie:
„Das ist mehr, als eine Person aushalten kann!“
und
„Herr, sei barmherzig!“
Es ist richtig, dass der Großvater nicht so gebildet war wie unser Schulmeister. Genauso richtig ist es aber auch, dass ich von Opa Txomin viel mehr als von Don Antonio lernte, denn was der Großvater sagte, kapierte ich in der Regel sofort. Seine Art und Weise, Dinge zu erklären, bestand immer im Erzählen von Geschichten in einer verständlichen Sprache voller Bilder. So gab mir der Großvater, was der Vater mir nicht geben konnte. Auf unserem Hof Beti Nagusia obliegt nämlich die Ausbildung der Kleinsten der ganzen Familie.
Als der Großvater auch nach einer ganzen Weile keine Anstalten machte, mit seinen Ausführungen fortzufahren, entschied ich mich dafür, ihm eine Pause zu gönnen. Dies scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, mich selbst erstmal vorzustellen.
Mein Name ist Juan de Beti. Mein Vater heißt genauso wie ich, und das ist exakt, wie mein verstorbener Großvater Juan de Beti hieß. Die erstgeborenen, männlichen Nachkommen unserer Familie wurden alle auf denselben Namen getauft. Wahrscheinlich ist dieser Umstand der Grund dafür, dass in unserer Gemeinde die Spitznamen so beliebt sind. Sie sind zur Identifizierung einer Person einfach notwendig. Wenn ich außer meinem ersten Nachnamen auch noch den meiner Mutter, Marina de Egia, anfüge, lautet mein kompletter Name Juan de Beti Egia. Auf diese Weise schließlich erhält jeder männliche Vertreter unserer Saga vom Opa bis zu mir seinen eigenen Namen: Juan de Beti Olatzar, Juan de Beti Arandia und letztlich auch ich, Juan de Beti Egia.
Bei den Frauen sieht die Sache mit den Namen anders aus. Wo es keine männlichen Nachkommen gibt und eine Tochter den Hof erbt, verliert die Familie in der nächsten Generation ihren und den Namen ihres Bauernhofes. Schließlich erhalten alle Kinder als ersten Nachnamen den ihres Vaters. Wenn Beti auch weiterhin existieren sollte, dann brauchte es einen Mann als Nachfolger. Und das war ich.
Mit 25 wurde ich volljährig, wodurch sich aber nichts Wesentliches in meinem Leben änderte. Auf der Straße nannten mich die Leute auch weiterhin txikia, etwa „der Kleine“, nicht etwa, weil ich von kurzer Statur war, sondern weil dieses Anhängsel an den Nachnamen die erstgeborenen Söhne bezeichnet, die wie ich denselben Namen und Nachnamen ihres Vaters trugen und gleichzeitig noch nicht Bauern und Besitzer eines Hofs waren. Und Letzteres war gar nicht so leicht.
Eigentlich gab es nur zwei Möglichkeiten Labrador, also Bauer mit einem eigenen Hof, zu werden. Die Erste bestand in der Heirat, die den künftigen Erben sofort zum Familienvorstand machte. Diese Möglichkeit erfuhr aber in den meisten Fällen nicht die notwendige Unterstützung der Eltern, weshalb die gängige Art der Übergabe des Hofes darin bestand, zu warten, bis ein oder beide Elternteile verstorben waren. Das Ableben der Eltern war also die allseits bevorzugte Form der Übergabe des Hofes.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch! Es ist keineswegs so, dass die jungen, gesunden und kräftigen Männer unserer Dorfgemeinschaft nicht etwa heiraten wollten. Es ist auch überhaupt nicht der Fall, dass es in unserem Tal oder den Nachbargemeinden keine tüchtigen und sparsamen Kandidatinnen zu diesem Zweck gäbe. Es ist vielmehr so, dass beide Vorkommnisse in den meisten Fällen zusammenfielen: Da sie zu Lebzeiten der Eltern keine Heiratserlaubnis erhielten, heirateten die meisten jungen Männer unseres Viertels, sobald die vorherige Generation das Zeitliche gesegnet hatte. Auf diese etwas merkwürdige Regelung komme ich aber noch genauer zu sprechen.
Der Pfarrer, der Dorfschreiber und auch der Dorfvorsteher nennen mich gelegentlich Juan de Beti menor. Menor ist dasselbe wie txikia, aber derart herausragende Persönlichkeiten haben eben ihre eigene Ausdrucksweise. Mein offizieller Name ist also Juan de Beti Egia, aber meine Freunde nennen mich nur bei meinem Spitznamen: Juan Ulezuri. Das ist baskisch und heißt übersetzt etwa Johannes Weißhaupt. Der Ursprung meines Spitznamens ist offensichtlich: Bereits bevor ich zwanzig Jahre alt war, leuchtete mein weißes Haupthaar wie der Schnee auf dem Gipfel des Gorbeia an einem sonnigen Tag im Februar.
Ansonsten unterschied ich mich nicht so sehr von den anderen jungen Männern in unserem Viertel. Ich war eigentlich immer schon schlank, etwas weniger muskulös als Juan de Goti, der im Hof gegenüber lebte, dafür war ich schneller und hatte mehr Ausdauer als er. Francisco de Amigorena war der größte Junge in der Nachbarschaft. Der ragte wirklich aus der Gruppe heraus!
Wir anderen dagegen trugen dieselben kurzen Hosen, bis wir aus der Grundschule entlassen wurden. Im Winter gab es dazu lange Wollstrümpfe, die im selben Maß durch kürzere ersetzt wurden, wie die Temperaturen im Frühling stiegen. Im Sommer schließlich trugen wir gar keine Strümpfe mehr, sondern nur noch Albarcas, Sandalen, die aus einer Ledersohle und einer langen Lederschnur bestanden.
Wenn wir uns schon körperlich nur wenig voneinander unterschieden, so war dies noch weniger der Fall, was unsere Kleidung anging. Alle Jungen unseres Viertels trugen die Albarcas desselben Schuhmachers, wir hatten sogar dieselbe Schuhgröße. Die einzigen Ausnahmen in Bezug auf die Schuhmode waren Pedro Aloa, der immer sehr abgetragene und löchrige Sandalen trug, und Francisco Amigorena, der schon immer größere Schuhe als der Rest von uns benötigte. Ansonsten glichen wir uns wie eine Maus der anderen, denn dasselbe Spiel wiederholte sich bei den Hosen, Hemden und Jacken. Unsere gesamte Kleidung war aus derselben Latxa-Wolle der Schafe unserer Heimat gefertigt, und zwar vom selben Schneider, und der kannte nur ein Schnittmuster, und so war nicht nur die Anzahl der Jacken- und Hosentaschen gleich, sondern auch ihre dunkelgraue Farbe, wenn man das denn überhaupt Farbe nennen will.
Auf dem Land zählt die körperliche Stärke; Charakter, Geschmack oder die Vorliebe für die eine oder andere Kleidung waren für uns dagegen nebensächlich. Doch ich fühlte mich schon besonders, seit ich denken konnte. Dieses Besondere kam unter anderem in meiner Redegewandtheit zum Ausdruck. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ich diese Eigenschaft von meinem wortkargen Vater ererbt hatte. Vater konnte sprechen, machte aber kaum Gebrauch von dieser Fähigkeit. Wenn ich mich diesbezüglich mit ihm vergleiche, dann war ich ein geschickter Redner, obwohl die meisten Mädchen unseres Viertels mich in dieser Disziplin mit Leichtigkeit geschlagen hätten. Meine besondere Gabe befähigte mich zu den typischen Gesprächen eines Jungen meines Alters, aber mehr als dies ermöglichte sie mir, den Menschen meines Umfeldes zuzuhören und sie zu verstehen. Diese Eigenschaft war bei den übrigen Jungen unseres Viertels eher nicht vorhanden.
❦
Ich berührte den Arm des Großvaters, was, obwohl es eher ein Streicheln als ein Stoßen war, bei ihm ein kurzes Schütteln verursachte. Er setzte seine Ausführungen ohne jede Einleitung fort, als ob gar nichts passiert wäre.
❦
„Es herrschte Mangel an allen Arten von Lebensmitteln und die Teuerung war enorm. Da die Menschen sich nicht mehr von ihren Feldern ernähren konnten, begannen sie, im Wald nach Essbarem zu suchen. Sie aßen Kastanien, Eicheln und sogar Bucheckern, auch wenn sie noch gar nicht reif waren. In jener Zeit brauchte es nicht mehr als einen Blick in das Gesicht deines Nachbarn, um seine Kraftlosigkeit festzustellen, denn die Entbehrung stand ihm gleichsam auf die Stirn geschrieben: Blasse Gesichter, hohle Wangen und leere Blicke bei Jung und Alt.
Die Armen und kleinen Pächter wurden als erste krank. Fieber, Husten und Erbrochenes markierten die verschiedenen Stadien der Epidemie. Krankheiten befielen die Einwohner aller Dorfviertel, und von Woche zu Woche waren mehr Tote zu beklagen. Der Reiter auf dem roten Pferd, der den Krieg brachte, war in großer Entfernung an unserem Dorf vorbeigezogen, doch der Reiter auf dem gelben Pferd, der Krise und Krankheit verbreitete, hatte den Weg in unser Tal gefunden.
Wir Bauern leben in ständiger Angst vor der Katastrophe. Das ist ein Gefühl, wie wenn des Nachts deine Kuh stirbt und am nächsten Morgen das Kalb daneben liegt. Bei diesem Anblick fürchtest du das Schlimmste. Das ist kein Schrecken, der gleich wieder vorbei ist. Das ist die pure Angst, dass dein Ende nahe ist. An diese Angst gewöhnst du dich deinen Lebtag nicht. Und den Ausdruck dieser Angst nahm ich in den Gesichtern der Nachbarn und denen meiner eigenen Familie wahr.
Diese Angst war nicht nur sichtbar, nein, sie war sogar hörbar. Und ihr Ton durchfuhr deinen Körper, jedes Mal, wenn du ihn hörtest. Er schlug dich regelrecht nieder! Der Ton erklang gerade von dem einzigen Ort, von dem wir uns in jenem Chaos Frieden, Trost und Hoffnung versprachen.
Das Geläut aus dem Glockengiebel der Pfarrkirche von Santo Tomás hallte durch das Tal: ein langgezogener Ton mit ausgedehnten Pausen zwischen den Glockenschlägen. Sobald die Nachbarn diesen Ton hörten, unterbrachen sie ihr Gespräch und ihre Tätigkeit. Unmittelbar wandten sich ihre Köpfe in Richtung der Pfarrkirche, auch wenn sie sie von dort, wo sie gerade standen, diese gar nicht sehen konnten. Und wie immer, wenn etwas Schreckliches passierte, bekreuzigten sie sich, ganz so als ob sie das drohende Unheil dadurch verhindern könnten.
Für das Clamor oder Totengeläut läutet der Küster die große Glocke, die einen ziemlich tiefen Ton gibt, der je nach Windrichtung durch weite Teile des Tals zu hören ist. Nach einer Anzahl von Schlägen auf der großen waren zwei kurze trockene Schläge auf der kleinen Glocke zu hören. Dieses Mal war also ein Mann gestorben.
Die Hungerkrise des Jahres 1699 hatte den Tod vieler geliebter Angehöriger verursacht. Damals verdoppelte sich der Getreidepreis von 20 Reales 1697 auf über 40 Reales 1699. Im Juli jenes Jahres kletterte er sogar kurzzeitig auf 77 Reales! Einige Monate später fiel er zunächst wieder auf 35 Reales, um sich allmählich wieder zu normalisieren. Diese Hungerkrise war kurz und heftig. Bei jener Gelegenheit starben die meisten Menschen nicht sofort an Hunger, sondern ein halbes oder ein Jahr später an unterschiedlichen Krankheiten.
Nach dem Hunger des Jahres 1699 gab es wieder ertragreiche Ernten, so dass der Getreidepreis während der ersten Jahre des neuen Jahrhunderts um die zwanzig Reales pro Fanega schwankte. Das war in jenen Jahren der gewohnte oder der gerechte Preis. Doch das endete bereits im Sommer des Jahres 1709, als die Fanega plötzlich dreißig Reales kostete und sich viele Gemeindemitglieder über die hohen Preise beklagten.
Die große Krise begann erst im darauffolgenden Jahr, als aus der Teuerung eine Hungerkrise wurde. Der Sommer 1710 war der längste meines Lebens, und der Winter dieses Jahres schien überhaupt nicht zu existieren. Die göttliche Ordnung der Jahreszeiten war völlig außer Kontrolle. Das eigentliche Problem war aber weniger die enorme Hitze als vielmehr das fehlende Wasser. Der Regen blieb aus und der Fluss, der unser Tal durchquert, verkümmerte zu einem Rinnsal.
Der Wassermangel betraf aber nicht nur die Landwirtschaft, sondern die gesamte Produktion im Tal. Die Eisenhütten schränkten ihren Betrieb zunächst ein, da nicht mehr so viel Wasser zum Antrieb der Hämmer und Blasebälge vorhanden war. Bald darauf stellten sie den Betrieb vollständig ein. Dasselbe Schicksal erlitten auch die Mühlen. Zuerst traf es die kleineren Mühlen an den Zuläufen des Flusses und im oberen Teil des Tals und dann auch die weiter unten am Fluss gelegenen.
Die kräftigen Hammerschläge der Eisenhütten waren nun nicht mehr im Tal zu hören. Der süße, Reichtum versprechenden Duft, den die Meiler sonst im Herbst verbreiteten, war nirgends mehr wahrzunehmen. Ja, selbst wer sich in die Nähe der Mühlen begab, konnte das eintönige Tok-Tok der hölzernen Getreidezuführung über dem oberen Mahlstein nicht mehr vernehmen. Die gesamte Industrie des Tals lag darnieder, und die einzige Erklärung war, dass nun auch der zweite Reiter auf einem gelben Pferd mit Krise und Krankheit in seinem Gefolge durch unser Land zog. Zwei Reiter hatte der Herr bereits ausgeschickt! Wohin sollte das noch führen?
Es leuchtet ein, dass der erzwungene Stillstand der Mühlen nachteilig war, andererseits gab es wiederum kaum Getreide zu mahlen. Schwerwiegender war die Unterbrechung der Aktivität der Eisenhütten. Da die Böden in Bizkaia nicht sehr fruchtbar sind, bedürfen fast alle Bauern zusätzlicher Einkommen. Nicht nur Pächter und Schuldner mussten ihre Mieten und Kredite mit Kupfer- und Silbermünzen bezahlen, sondern auch alle kleineren und mittleren Eigentümer benötigten Geld, um Lebensmittel auf dem Markt in der Stadt zu kaufen. Niemand aus dieser Gruppe verfügte über Felder, Weiden und Wälder, die groß genug waren, um ausschließlich von ihrem Ertrag leben zu können.
Für einen normalen Bauern unserer Gemeinde war der Betrieb der Eisenhütten überlebenswichtig. Viele größere Eigentümer verkauften den Betreibern der Hütten im Tal das Holz ihrer Wälder „am Stamm“. Wer nur einen mittleren Wald sein Eigen nannte, erntete und verkohlte die Äste meist selbst und transportierte sie zu einem entsprechend höheren Preis bis ans Tor der Eisenhütte. Wer keinen Wald besaß, verdingte sich als Waldarbeiter, Holzfäller, Köhler oder Eseltreiber. Und so arbeitete der größte Teil der Dorfbevölkerung den vier Eisenhütten im Tal zu. Entsprechend allgemein war der Verdienstausfall durch den Stillstand der industriellen Aktivität.
Angesichts dieser drastischen Konsequenzen lässt sich die Agonie im Dorf nachempfinden. In den Vierteln verstummten das Lachen und Singen der Kinder. Jetzt weinten sie und niemand konnte die Kleinen trösten, denn niemand konnte ihren Hunger stillen. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Dorfbewohner gleich: Jung und Alt, Arm und Reich litten unter den Folgen zweier Ernteausfälle in Folge.
Der Getreidepreis stieg unaufhaltsam und die Einwohner, die sich das Brot nicht mehr leisten konnten, verlangten, dass die Gemeindeverwaltung den gerechten Preis durchsetze. Doch alles war vergeblich, denn kein Bäcker und kein Händler war bereit, mit Verlust zu verkaufen. Und so stiegen die Preise weiter. Das Jahr 1710 hatte gerade erst begonnen, da kletterte der Preis für eine Fanega Weizen auf 40 Reales. Die Bewohner unseres Tals befürchteten also, dass die Hungersnot fortdauern würde. Und sie sollten Recht behalten!
Wir redeten uns ein, dass die Krise irgendwann einmal enden müsse und mit der nächsten Ernte alles wieder gut werden würde. Doch auch die nächste Ernte war schlecht, und der Weizenpreis stieg und stieg. Während des Jahres 1711 fiel der Getreidepreis zeitweise unter die 40 Reales, nur um danach wieder auf 50 Reales zu steigen. In jenem Moment hatten wir bereits drei Ernten erlebt, die alle schlecht oder sogar miserabel waren. Außerdem fehlten uns die Mittel, um Getreide zuzukaufen. Es gab keinen Dorfbewohner, der nicht im Wald Kastanien sammelte, um sich und den Seinen daraus das „Brot der Armen“ zu kochen. Unter normalen Umständen hätte ich etwas so wenig Nahrhaftes wie Kastanienbrei nicht probiert, aber damals konnte ich mich längst nicht mehr an normale Zeiten erinnern. Überdies waren wir durch die unglaublichen Weizenpreise alle zu armen Bauern geworden, und so sammelten wir Kastanien im Wald und aßen das „Brot der Armen“.
Durch die Trockenheit gab es in diesem Herbst weniger Kastanien als sonst, und die wenigen verschwanden vor ihrer Zeit von den Bäumen. Die bedürftigsten Bauern pflückten zunächst die Kastanien aus dem Gemeindewald, doch nachdem der abgeerntet war, fragten sie nicht weiter, wem der angrenzende Wald gehörte. In jenem Jahr holte ich nicht mal einen Sack Kastanien aus unserem Kastanienhain Arkulandabasoa. Und die schiere Not trieb mich zu demselben unchristlichen Verhalten wie meine Nachbarn.
Zwei Reiter durchquerten bereits unser Land und trotzdem wollten wir die Botschaft des Herrn nicht hören, sondern beleidigten ihn durch unser sündiges Leben. So ereignete sich die schwerste Hungersnot in der Geschichte unserer Heimat. Nach zwei trockenen Sommern und zwei ungenügenden Ernten besaß kein einziger Bauer mehr Korn auf dem Dachboden seines Bauernhauses. Und der aus dem Süden importierte Weizen wurde Ende 1710 für unglaubliche 70 Reales angeboten!
Die Nachbarn versuchten verzweifelt auf dem Markt in der Stadt Lebensmittel zu erstehen, in langen Schlangen bewegten sich ihre Ochsenkarren flussabwärts. Dort boten sie ihr Hab und Gut an, um vom Erlös ein paar Wochen zu überleben. Holzwerkzeuge, Leinenbettwäsche, Tonkrüge, Kleidung und sogar Möbel wurden feilgeboten. Doch in der Krise waren all diese Güter genauso wertlos wie das Korn teuer war, und so fuhren die meisten Karren wieder unverrichteter Dinge zurück ins Tal.
Mancher Bauer verpfändete 1711 seinen Hof und nahm einen Kredit auf. Das war das letzte Mittel, um das nackte Überleben zu sichern. Eigentlich war das Geldleihen nur für besondere Anlässe reserviert, wenn zum Beispiel die Tochter heiratete und du ihr durch eine Mitgift bei ihrem Vorhaben helfen wolltest. Wenn der Vater oder die Mutter starb, konntest du ihren Weg in das Himmelreich durch eine Misa Perpetua ebnen. Für derartige außerordentliche Anlässe lieh sich der Bauer Geld, und die große Krise war selbstverständlich ein solcher außerordentlicher Anlass. Und so war die Zahl der Bauern groß, die nicht nur den von ihren Vorfahren ererbten Hof belasteten, sondern alles, was dazugehörte: Gärten, Äcker, Obsthaine, Wälder, Weiden sowie Wege- und Begräbnisrechte.
Persönlich bin ich davon überzeugt, dass der Kredit uns aus einer momentanen Not befreit, nur um diese in eine fortdauernde umzuwandeln. Sei es drum! Nur wenige retteten sich auf diese Weise, und die wenigen, die sich glücklich wähnten, wussten doch nur zu gut, dass sie den Kredit nicht zurückzahlen konnten. Der Mangel an Münzen war so groß, dass im besten Fall ihre Kinder einmal die Schuld begleichen würden.
Noch schlimmer waren diejenigen dran, die keinen eigenen Hof besaßen. Da sie keine Garantien für die Rückzahlung bieten konnten, wollte ihnen niemand Kredit gewähren. Lerne dies, mein Sohn: In der Krise schwindet die Nächstenliebe.
Aus den Ställen der Höfe im Tal verschwand das Vieh; zuerst ging es nur dem Kleinvieh an den Kragen. Aber nachdem die Hühner, Schafe und Ziegen dezimiert waren, kamen auch die Schweine an die Reihe, und schließlich war die Verzweiflung so groß, dass auch Ochsen und Kühe geschlachtet wurden. Nun war allen klar, dass die Krise länger dauern würde, denn ohne Rinder gab es keinen Dung und ohne Dung musste auch die nächste Ernte fehlschlagen.
1712, im dritten Jahr der Not, hatte auch der letzte Dorfbewohner die Zeichen des Herrn verstanden, nunmehr waren alle zum Handeln bereit. Anfangs wurde die Zahl der Gottesdienste für ein gutes Wetter in der Pfarrkirche und der Hospitalskapelle am Dorfplatz verdoppelt. Der Pfarrer rief zur Messe, und die Leute kamen in Scharen. Die Predigten nahmen einen immer bedrohlicheren Ton an und bewegten Männer wie Frauen.
Anfang August sah sich dann auch die Gemeindeverwaltung zum Handeln genötigt. Der Dorfvorsteher ordnete die Durchführung einer Prozession an, um unsere Jungfrau Maria um Beistand für ein Ende der Trockenheit zu bitten. Die gesamte Bevölkerung wurde zur Mitwirkung aufgerufen. Auch der Pfarrer Don Venancio ermahnte die Gläubigen während des Gottesdienstes zur Teilnahme. Die Prozession war für den 15. August, Maria Himmelfahrt, angesetzt und der Ort war die Kapelle Nuestra Señora de Andra Mari. Zwei Frauen waren bereit, die Büste der Mutter Gottes mit Weißwein zu reinigen, und der Schneider Lorenzo de Larrea Larrakoetxea wurde beauftragt, ihr Kleid auszubessern. Alle Vorbereitungen liefen, und zum ersten Mal seit Ausbruch der großen Not war wieder so etwas wie Hoffnung unter den Dorfbewohnern zu spüren.
Am besagten Tag versammelte sich eine große Menschenmenge vor der Kapelle unserer Jungfrau Maria. Die Sitzplätze im Inneren waren den Vertretern der geistlichen und weltlichen Verwaltungen sowie den größten Grundbesitzern des Tals vorbehalten. Die gemeine Dorfbevölkerung musste im Tempel an den Seitenwänden stehen, mit den Bänken im Portikus vorliebnehmen oder abseits der Kapelle auf das Erscheinen der Mutter Gottes warten. Nach dem Gottesdienst trat Don Venancio in Begleitung zweier Messdiener aus der Kapelle ins Freie. Er trug ein festliches Messgewand und versuchte nach Kräften, die Prozession zu leiten. Schließlich ging der erste der beiden Ministranten mit einem langen Kreuz aus Bronze voran. Ihm folgte der Priester mit dem zweiten Messdiener an seiner Seite und endlich erschien die Jungfrau auf ihrem Thron.
«Wunderbar! Wie schön!»
Die Bauern kreuzigten sich und riefen pausenlos:
«Ave Maria Purísima! Ave Maria, die ganz Reine!»
Acht Mitglieder der Laienbruderschaft der Kapelle Andra Mari waren auserwählt, die Skulptur zu tragen. Sobald sie unter dem Vordach der Kapelle heraustraten, erhoben sie die langen Stangen des Prozessionsgestells auf ihre Schultern, und nun war das winzige Bild der Jungfrau auch von den billigen Plätzen aus zu sehen. Sie trug einen mit Stickereien verzierten neuen Umhang und eine glänzende Blechkrone. Ihr Anblick verzückte die Anwesenden, die ihre Augen nicht von der kleinen Statue lassen konnten.
«Ave Maria Purísima! Ave Maria, die ganz Reine!»
schrien sie und vergaßen für einen Augenblick ihre Sorgen.
Langsam formte sich der Prozessionszug hinter der Mutter Gottes mit den Würdenträgern an seiner Spitze. Als die Menschenrtraube sich gemächlichen Schrittes von der Kapelle entfernte, stimmte der Pfarrer das erste Lied an:
«Ama Birjina zeruetako»
«Jungfrau Maria im Himmel»
Die Gemeindemitglieder warteten in Zweier- und Dreierreihen zu beiden Seiten des Weges, der von Ametzola nach Ereñotza führt, um einen Blick auf die Jungfrau werfen zu können und sich dann am Ende in die Prozession einzureihen. Da stimmte der Pfarrer auch schon das zweite Lied an, obwohl es unter diesen Umständen mehr ein Schreien als Singen war:
«Barka jauna, barka, barkamendu, gure huts guztiez doilu dugu.»
«Hab Erbarmen Herr, verzeih uns! Wir haben uns durch unsere Sünden entwürdigt.»
Es dauerte eine ganze Weile, bis sich alle Teilnehmer in den Prozessionszug eingereiht hatten, da die Menschenmenge so unglaublich groß war. Und so gelangte die Gruppe singend bis zum ersten Hof des Viertels Ereñotza, wo der Pfarrer Halt machen ließ. Geduldig wartete er auf die letzten Gläubigen, um schließlich eine sehr bewegende Predigt zu halten:
«In der Tat sind diese schlechten Zeiten eine Strafe Gottes für unsere Sünden, doch gleichzeitig stellt er damit unseren Glauben und unsere Liebe zu ihm auf die Probe. Und diese Probe wird andauern, bis auch der Letzte von uns seine Sünden gebeichtet und seinen Glauben an Gott, unseren Herrn, erklärt hat.»
Don Venancio war ein Meister darin, an das Gewissen seiner Gemeindemitglieder zu appellieren, und auch dieses Mal erreichten seine Worte unfehlbar ihr Ziel: die Anwesenden waren betroffen, einige weinten sogar. Als die Predigt schließlich zu Ende war, fühlten wir uns alle wie befreit.
Nach einem Moment der Stille begannen wir singend den Rückweg zur Kapelle. Vielleicht war es nicht wirklich Freude, die ich in jenem Moment verspürte, doch ich fühlte die Erleichterung und erstmals seit Langem wieder etwas Hoffnung.
Aus nachvollziehbaren Gründen wurden das Festessen der Laienbruderschaft wie auch alle weiteren Festveranstaltungen in Ametzola abgesagt. Lediglich der Dorfvorsteher, der Pfarrer und die Männer, die die Jungfrau während der Prozession getragen hatten, trafen sich auf ein Glas Wein zur Erfrischung. - Kein Teilnehmer der Hoffnung spendenden Prozession konnte sich vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt gerade mal die Hälfte der großen Not vorbei war und dass die meisten Opfer des Hungers erst noch zu beklagen waren.
Zunächst schien es so, dass die Jungfrau in unserem Anliegen erfolgreich vermittelt hatte, denn die Situation verbesserte sich im nächsten Jahr etwas, als der Weizenpreis erst auf 50 und später auf 40 Reales fiel. Das war zwar weniger als in den beiden Jahren zuvor, doch immer noch doppelt so viel wie in den Jahren vor der Krise. Das eigentliche Problem der großen Not war, dass der Weizenpreis in diesen Jahren nie wieder seinen gewohnten und gerechten Preis erreichte. Er lag drei weitere Jahre lang um die 40 Reales. Drei weitere Jahre lang! Insgesamt fiel nicht eine Ernte zwischen 1710 und 1714 gut aus. Die große Krise dauerte sage und schreibe fünf Jahre!”
❦
Der Großvater sah mir tief in die Augen, und ich konnte meine Angst nur schlecht verbergen. Wie war es möglich, dass überhaupt ein Dorfbewohner die Hungersnot überlebte, wenn diese fünf Jahre lang andauerte? Fünf Jahre! Ich war zu diesem Zeitpunkt gerade erst mal zehn! Wie unglaublich!
Ich bin die Hauptfigur in dieser Geschichte, denn ich selbst schreibe sie gerade nach einem langen Leben voller glücklicher und weniger glücklicher Ereignisse nieder. Diese Tatsache mag verwundern; können doch die meisten Absolventen unserer Dorfschule zwar hervorragend singen und auch die Lebensgeschichte der glorreichen Märtyrer aufsagen, doch kaum mehr als ihren eigenen Namen schreiben. Diejenigen aber, die nicht zu Schule gegangen sind, beherrschen die Schriftzeichen gar nicht und müssen also gezwungener Maßen ihr Einverständnis zu ihrem Ehevertrag an der Stelle, wo es ihnen der Dorfschreiber anzeigt, mit einem Kreuz bekunden.
Der Umstand, dass ich mehr als nur meinen Namen schreiben kann, macht mich zu etwas Besonderem unter den Talbewohnern. Das soll nicht etwa heißen, dass diese Befähigung etwas Schlechtes sei. Ganz im Gegenteil, der Mayordomo der Pfarrkirche und auch der Dorfschreiber füllen ganze Bücher mit Tinte, und beide sind hochangesehene Persönlichkeiten im Dorf. Was die meisten meiner Nachbarn nicht verstehen können, ist, warum jemand so viel Aufwand in die Erlernung einer Tätigkeit von so geringem Nutzen steckt. Das widerstrebt ihrem ausgeprägten Sinn für das Praktische. Im Laufe seines Lebens unterschreibt ein reicher Dorfbewohner genau zwei Schriftstücke: seinen Heiratsvertrag und seinen letzten Willen. Ein armer Dorfbewohner unterzeichnet diese Dokumente nicht, weil er ja weder nennenswerte Güter mit in die Ehe bringt noch welche vererben kann. Wenn Letzterer auch noch Pech hat, dann können die Umstände ihn zwingen, einen Kreditvertrag zu unterschreiben. Jedenfalls erhalten die meisten Dorfbewohner nur wenige Gelegenheiten, im Laufe ihres Lebens ihren Namen auf Papier zu schreiben. Und so gesehen ist Schreiben zu lernen verlorene Zeit.
Mein Name ist Juan Ulezuri und meine Lebensumstände haben mich zu einem besonderen Menschen gemacht. Im fortgeschrittenen Alter fühlte ich die Notwendigkeit, das Abc zu lernen, um meine Lebenserfahrung aufzuzeichnen. Durch das Schreiben verfolge ich weniger die Absicht, jemanden zu loben oder zu beschuldigen, sondern vielmehr das Geschehene selbst zu verstehen. Denn diese Ereignisse, die ich im Folgenden schildern werde, bestimmten nicht nur mein Geschick und das meiner Familie, sondern sie machten mich zu dem, was ich heute bin.
Auch wenn diese Notizen aussehen wie meine Lebensgeschichte, so handelt es sich doch bloß um die Anmerkungen eines baskischen Bauern. In ihnen beschreibe ich die Ungerechtigkeiten, die wir erleiden mussten, und diese kann man wiederum nur im Zusammenhang mit unserer Lebens- und Arbeitsweise verstehen. Letztere sind aber durchaus Teil der Geschichte meines Lebens. Beginnen wir also mit dem Anfang.
Im Jahr des Herrn 1726 erblickte ich das Licht dieser Welt. Der Schulmeister erzählte uns später, dass damals Philipp V spanischer König und Herr von Bizkaia in einer Person war. Das muss man sich so vorstellen, wie Gott und der Heilige Geist, also eigentlich zwei aber doch ein und dasselbe. In diesem Jahr wurde ich im Monat Garila geboren. Garila heißt in unserer Sprache Juli und ist die Zeit des Jahres mit der meisten Arbeit auf dem Feld. Also ich habe ja keine eigenen Erinnerungen an diese Zeit, aber meine Familie erzählte sie mir mehr als einmal in allen Einzelheiten, und jetzt notiere ich sie genau so, wie sie sie mir erzählt haben, ohne etwas hinzuzufügen oder etwas zu verschweigen.
So beginne ich also meine Erzählung mit meiner Geburt im Monat Garila, und ich hätte mir gerne einen anderen Monat aussuchen können, sagten sie mir. Aber nein, ich wählte gerade den Monat für meinen Geburtstag, in dem der Weizen geerntet wird, und das ist auch der Grund dafür, dass die Großmutter mir stets sagte, dass ich immer schon dickköpfig gewesen bin, sogar schon vor meiner Geburt. Und die Großmutter Catalina hatte immer recht.
Alle Hände wurden bei der Weizenernte gebraucht, und so musste auch meine Mutter Marina mithelfen, obwohl sie mit mir im achten Monat schwanger war. Mein Vater Juan wollte die Tage mit schönem Wetter ausnutzen, um die Ernte ins Trockene zu bringen.
An jenem Tag brannte die Sonne hernieder, dass man auch ohne sich zu bewegen schwitzte. Daher war die Mutter mit ihrem dicken Bauch bei der Ernte auch keine große Hilfe. Sie beklagte sich nicht einmal, aber Juan merkte doch, dass sie den Rhythmus der anderen nicht mithalten konnte. Mein Onkel Txomin, der größere Bruder meines Vaters, den ich immer Opa nenne, weil er ja älter als mein Vater war und ich doch keinen Großvater mehr hatte, sagte kein Wort. Catalina dagegen konnte nicht an sich halten, zu sehr war sie um das Wohl ihrer Schwiegertochter und ihres ersten Enkels besorgt.
Es fehlte nicht mehr viel bis zur Niederkunft und Marinas Bauch war beeindruckend groß. Unter diesen Umständen tat es ihr nicht gut, sich der Sonne auszusetzen, und noch viel weniger zu arbeiten.
Mein Vater hatte seine eigene Sicht der Dinge. Er machte dauernd Kommentare wie:
„Hoffentlich bringen wir den Weizen noch rechtzeitig ein.“
oder:
„Wenn das gute Wetter doch nur noch einige Tage anhalten würde!“
Dabei blickte er immer nervös zum Himmel, doch es war keine Wolke in Sicht, nur die brennend heiße Sonne.
❦
Wer kein Bauer ist, wird dessen Sorge um das Wetter schwerlich begreifen. Unter uns dagegen war diese Befürchtung ständig spürbar. Nicht nur während der Ernte, sondern das ganze Jahr über waren genügend Sonnenstunden, die richtigen Temperaturen und ausreichend Niederschläge notwendig, um das Beste aus dem Boden zu holen. Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt wurden, dann verwandelten sich die Sorgen schnell in schiere Angst. Im Winter waren Fröste erforderlich, um eine Insektenplage im Sommer zu vermeiden. Im Frühjahr musste es ausreichend regnen, wenn sich das Korn voll ausbilden sollte. Und wenn es zur Ernte nicht ordentlich warm war, dann konnte man das Korn nicht einholen und es drohte, auf dem Feld zu verderben.
Der Bauer sah stets mit einem Auge auf den Boden und mit dem anderen zum Himmel, denn er war sich der Bedeutung des Wetters für seine Ernte bewusst. Die unbestrittenen Meister der Wettervorhersage waren die Schäfer, die die meiste Zeit des Jahres auf den Sommerweiden im Gorbeiagebirge verbrachten. Dort verfügten sie über eine bessere Aussicht als ihre Nachbarn unten im Tal. Sie konnten den Himmel lesen wie niemand sonst, und ihre Vorhersagen wurden im Laufe der Jahre in Form von Sprichwörtern zum Allgemeinwissen.
Sie waren in der Lage, zum Beginn einer Jahreszeit, oder wie sie es nannten Témpora, das Wetter der kommenden drei Monate vorherzusagen. Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag einer Témpora beobachteten sie die Dauer des Sonnenlichts, die Stärke des Regens und des Windes sowie die Form und Größe der Wolken, um auf dieser Grundlage eine Vorhersage für die nächsten drei Monate zu machen. Außerhalb der Témpora waren ihre Vorhersagen kürzer. Wenn sie zum Beispiel im Winter Schnee in den Bergen sahen und Frost im Tal, dann war das ein Anzeichen für Schnee während der nächsten Tage:
„Mendian elurra, zelaian leie, edur gehiagoren deie.”
„Schnee in den Bergen und Frost auf den Feldern sind Anzeichen für noch mehr Schnee.“
Außerdem gaben sie wiederkehrenden Erscheinungen am Himmel Namen aus dem Heiligenkalender. Die Laurentiustränen sind zum Beispiel ein Sternenregen, der sich jedes Jahr um den zehnten August ereignet. Der Himmel ist in dieser Nacht so sehenswert, wie das Martyrium des Heiligen qualvoll war. Nicht umsonst ist Sankt Laurentius einer der beiden Heiligen unserer Pfarrkirche.
Manchmal war es aber nicht genug, einer Erscheinung am Himmel einen Heiligennamen zu geben, und in diesen Fällen erzählten die Schäfer ganze Geschichten, um sie in die zeitliche Folge einzuordnen. So geschehen mit dem Olentzero. Der sagenhafte Köhler stieg von den Bergen hinab, sobald dort oben der erste Schnee fiel, und bot seine Holzkohle im Tal zum Verkauf an.
Ähnlich liegt der Fall der Anbotoko Señorea, der Dame vom Ambotogebirge. Mehrmals im Jahr wechselte sie ihren Aufenthaltsort vom Amboto, zum Aloña und zum Gorbeia. Bei diesen Gelegenheiten flog sie auf ihrem Besen durch die Luft und zog sie einen Funkenregen hinter sich her. Je nach der Richtung, in die sie flog, brachte sie entweder Regen, Dürre oder reichhaltige Ernten.
Wenngleich Schäfer und auch viele Bauern das Wetter erklären und sogar vorhersagen konnten, es zu verändern blieb ihnen versagt. Diese Tatsache zusammen mit der großen Bedeutung, die das Wetter für ihr Leben und Arbeiten hatte, erklären die ständige Sorge des Bauern. Er fürchtete sich davor, was passieren könnte. Und er hatte allen Grund dazu, denn vor der großen Not waren Hungerjahre, Überschwemmungen, Dürren und Ernteausfälle durch Hagel ständig wiederkehrende Ereignisse. Diese drastische Sicht der Dinge kennzeichnet den Bauern.
❦
Marina arbeitete weiter, bis sie schließlich nicht mehr konnte und plötzlich vor Schwindel umfiel. Ohne dass Marina etwas sagte, knickten ihre Knie unter ihrem riesigen, schwarzen Rock ein, und ihr Kopf versank zwischen den Ähren. Alles ging sehr schnell und beinahe geräuschlos vor sich.
Sobald sich die Männer von dem Schreck erholt hatten, hoben sie sie auf und legten sie vorsichtig auf den Ochsenkarren. Catalina nahm Marinas Kopf in ihre Hände, während Juan den Karren in Richtung der Höfe Olatzars lenkte. Er schlug mit dem Stock auf die armen Tiere ein und feuerte sie durch laute Rufe an, gleich so als ob sie Schuld an dem Vorfall hätten. Die Ochsen brüllten ohne Unterlass und Juan schlug stetig auf sie ein, bis sie endlich den Hof Beti erreichten.
Das war vielleicht ein Aufsehen in unserem Viertel! Von den Balkonen und aus den Fenstern blickten neugierige Gesichter. Die Nachbarn eilten so schnell herbei, wie sie nur konnten. Auf den angrenzenden Feldern ließen die Bauern ihre Sicheln fallen und kamen angelaufen. Als die Nachbarn sahen, dass es Marina unwohl war, fasste sich der eine oder andere Bauer an seine Mütze, und die eine oder andere Bäuerin rieb sich ihre Hände an der Schürze.
Juan hörte nicht auf zu erwähnen, dass die Hilfe seiner Frau unabdingbar sei, um die Weizenernte einzubringen. Das war der Moment, in dem Catalina, die es nicht gewohnt war, ihren Sohn in aller Öffentlichkeit zu schelten, weil dieser auch so immer das machte, was sie wollte, uns mit den folgenden Worten überraschte:
„Du bist unverschämt, Juan, ein Lump! Was hast du bloß getan? Immer denkst du nur an dich. Kannst du denn nicht sehen, dass deine arme Frau nicht mehr kann? Wie konntest du nur zulassen, dass sie mit uns aufs Feld geht?“
Die Großmutter schalt ihn noch eine geraume Weile in Anwesenheit der versammelten Nachbarn. Sie wollte unbedingt, dass jemand nach der Hebamme schickte, aber Juan ließ das nicht zu, denn die Hebamme muss man mit Geld oder Naturalien bezahlen. Mit weniger als einem Huhn oder einem Korb Äpfel lässt sie sich nicht abspeisen. - Und jetzt war es Juan, dem schwindelig wurde.
„Aber, was sagst du da? Es war doch gar nicht so schlimm! Sieh nur, es geht ihr doch schon wieder besser. Heute Nachmittag ruht sie sich aus, und morgen kann sie wieder reinhauen.“
Die Nachbarn sahen verlegen zum Himmel, die Spannung war greifbar, doch niemand korrigierte Juan. Marina war inzwischen wieder zu Bewusstsein gekommen und Großvater Txomin hatte sofort den Weinschlauch aus der Küche geholt. Nach einem guten Schluck erholte sich Marina nun im Schatten des Bauernhauses.
„Was für eine Hitze! Plötzlich wurde mir schwarz vor Augen.“
„Wie geht es dir, Schatz? Geht es dir gut? Seht, es geht ihr schon wieder besser!“
Juan machte noch immer keine Anstalten, seine Meinung zu ändern, und so war es Catalina, die uns erneut überraschte:
„Wenn du nicht Manns genug bist, um die Hebamme zu holen, dann mache ich das selbst! Los jetzt, geh schon!“
Das war wirklich unerhört, dass Catalina den Mut und die Tugendhaftigkeit ihres Sohnes als Haushaltsvorstand infrage stellte. Juan blieb nichts anderes übrig, als sich zu fügen; jetzt war es das Maultier, das seine schlechte Laune ertragen musste:
„Los, du Biest, los jetzt! Nimm das, verdammtes Tier!“
Die Stockschläge auf dem Rücken des Tieres hallten von den Hauswänden zurück, und noch lange nachdem Juan verschwunden war, hörte man noch das Schreien des Maultieres.
❦
Maria de Ocerin Jauregi war eine weise Frau, obwohl ich auch heute noch nicht genau weiß, was das bedeutet. Für mich sind alle Frauen weise, denn sie bringen die Kinder auf die Welt, bereiten das Essen zu, sie wirtschaften mit Geld und halten zu Hause Ordnung. Ich denke, das alles machen die Frauen, und dafür schulden wir ihnen Dank.
Maria de Ocerin Jauregi übte je nach Bedarf mehrere Berufe aus. Sie war die Dorfhebamme und unterstützte die werdenden Mütter, wenn sich die Geburt schwieriger als normal darstellte, oder verstand es, die Väter und Großväter zu beruhigen, wenn diese sich als besonders nervös herausstellten. Sie war auch Heilerin, vor allem, wenn der Dorfarzt und der Barbier nicht zur Stelle waren. Des Weiteren kurierte sie die Patienten, die sich eine Behandlung durch den ordentlichen Arzt aufgrund der hohen Gebühren nicht leisten konnten. Schließlich war der Besuch bei der weisen Frau eine Option, wenn die Behandlung über einen Aderlass, das Ziehen eines Zahnes oder die Amputation eines Körperteils hinausgehen sollte.
Früher hatte es noch eine weitere Möglichkeit der ärztlichen Behandlung in Form des Wanderarztes gegeben. Seit jedoch unsere Gemeinde für ein ansehnliches Gehalt einen Dorfarzt angestellt hatte, weigerte sie sich die Kosten für die Besuche des Saludadores zu tragen, woraufhin dieser seine Besuche in unserem Tal einstellte.
Maria war eine erfahrene Allgemeinmedizinerin. Einem Schäfer verordnete sie, sich täglich die Hände mit Wasser zu waschen, und durch diese Anwendung verschwanden die Flecken auf seiner Haut, die ihn so beunruhigt hatten. Alle Nachbarn unseres Viertels waren schon einmal bei Maria de Ocerin in Behandlung. Dem Einen heilte sie eine offene Wunde mit einer Salbe. Dem Nächsten befreite sie von seinen Kopfschmerzen, indem sie ihm die Hände auf den Kopf legte und dabei etwas auf Latein sagte. Wieder einem Anderen nahm sie seine Albträume durch die regelmäßige Einnahme einer Kräuterinfusion. Man erzählte sich wahre Wunder von der Heilerin, ja es kamen sogar Kranke von außerhalb unserer Gemeinde zu ihr. Aufgrund ihrer Kenntnisse und ihrer sonderbaren Heilmittel war Maria für viele mehr als nur Heilerin oder Kräutermischerin, sie war eine Hexe.
❦
Der Empfang, den die Nachbarn Maria de Ocerin Jauregi in Olatzar bereiteten, zeigt klar, dass sie eine außerordentliche Frau war. Zunächst einmal kam sie nicht zu Fuß, sondern ritt auf dem Rücken unseres Maultieres, das von Juan geführt wurde.
„Halt, Mistvieh, immer musst du deinen Willen durchsetzen!“
Auf dem Rücken unseres Maultieres sitzend empfing Maria die Grüße der Nachbarn unseres Viertels. Eine Frau berührte sanft ihre Hand als Danksagung für den Dienst, den sie ihr seinerzeit geleistet hatte. Catalina wollte weitere Verzögerungen vermeiden und kam bereits die Treppe herabgelaufen, als das Maultier gerade die Steigung vom Camino Real zu unserem Viertel in Angriff nahm.
Dort kam die weise Frau, Maria de Ocerin Jauregi, und stieg mit Juans Hilfe vom Maultier ab. Sie beachtete die übrigen Nachbarn gar nicht, die bereits eine kleine Menschentraube um sie gebildet hatten, und ihr die unterschiedlichsten Körperteile entgegenstreckten: Dort gab es Beulen an den Beinen, Flecken auf der Zunge und Verrenkungen von Armen. Auch beachtete sie Juan nicht weiter, der sie ja hierhergeführt hatte, denn Catalina begann bereits damit, sie über den Zustand der Schwiegertochter zu informieren. Außerdem nahm sie richtigerweise an, dass nicht er, sondern sie ihre Gebühr begleichen würde.
Zuerst entrichtete die Hebamme einen kurzen Gruß, um danach sofort nach der Schwangeren zu sehen. Im Beisein Catalinas betastete sie Marinas Bauch von oben nach unten und kreuz und quer. Sofort stellte sie zur Beruhigung der werdenden Mutter fest, dass die Lage der Kreatur im Bauch die Richtige sei. Catalina empfahl sie mehrere Lebensmittel, die die Schwangere essen sollte, sowie andere, auf die sie für den Moment verzichten sollte.
Sofort danach wurde Juan gerufen, damit auch er den Befund höre. In Anwesenheit beider Frauen verbot sie Juan strengstens, seine Frau zum Arbeiten mit aufs Feld zu nehmen. Die Schwangerschaft sei schon weit fortgeschritten und mit der Geburt sei beim nächsten Vollmond in zwei Wochen zu rechnen. Juan antwortete ihr mit keinem Wort, sodass die Hebamme alles noch einmal wiederholte, bis Juan endlich sagte:
„Einverstanden. Marina soll bis zur Geburt zu Hause bleiben.“
Kaum hatte er dies gesagt, machte er auch schon kehrt, um das Maultier für den Rückweg bereitzustellen.
Die Hebamme empfing von Catalina ein paar Münzen für den Besuch und außerdem noch einige Äpfel dafür, dass sie den werdenden Vater ins Gebet genommen hatte. Doch Catalina war noch immer etwas beunruhigt. Bei der Verabschiedung an der Haustür, noch bevor sie die Holztreppe hinunterstiegen, fasste sie die Hebamme am Arm und fragte halblaut:
„Maria, die Geburt wird doch ohne Probleme verlaufen, nicht? Du weißt schon, es ist ihr erstes Kind.“
„Kannst ganz beruhigt sein, Catalina, mit den Hüften, die deine Schwiegertochter hat, kann sie die Kreatur quer rausdrücken.“
Lachte und verschwand.
Catalina war recht zufrieden mit dem Besuch der Hebamme. Ohne weiteres Zögern ging sie sofort daran, die Anweisungen der Hebamme in die Tat umzusetzen. Aus dem Weinschlauch in der Küche füllte sie eine Tonschale mit Wein für die werdende Mutter.
„Zwei sind besser. Die erfreulichen Ereignisse müssen doch gefeiert werden. Davon gibt es schließlich nur so wenige.“
Sie prostete ihrer Schwiegertochter zu, die nun bereits schon wieder lächeln konnte.
Am nächsten Morgen in der Früh klopfte es an der Tür von Beti Nagusia:
„Catalina, öffne! Catalina!”
Seit dem Hausbesuch der Hebamme hatte die Schwangere das Haus nicht mehr verlassen und Catalina wich keinen Moment von ihrer Seite. So waren die Nachbarn gezwungen, die Treppe raufzukommen, wenn sie auf den neusten Stand der Dinge gebracht werden wollten. Normalerweise kamen sie zu zweit, seltener zu dritt, denn nach alter Gewohnheit waren mehr als zwei oder drei Personen bei so einem Besuch unangebracht.
Catalina ging ganz in ihrer Rolle als Verkünderin der Neuigkeiten auf. Bis zu dreimal täglich berichtete sie in allen Einzelheiten von der Aufnahme der empfohlenen Nahrungsmittel, worin sie mittlerweile eine Expertin zu sein schien, über ihre Verdauung bis zur Ausscheidung derselben.
„Und Brot tut ihr gut?“
„Weißbrot aus Weizen bereitet ihr keine Probleme.“
„Also ich glaube, etwas Schaffleisch würde ihr Kraft geben.“
„Maria hat klare Anweisungen gegeben: Sie soll kein Fett essen. Im Moment bekommt ihr das nicht.“
Die Nachbarn waren zufrieden und zählten die Tage bis zum nächsten Vollmond, denn niemand zweifelte ernsthaft daran, dass ich zu besagtem Termin zur Welt kommen würde. Marina fühlte sich viel besser, seit sie nicht mehr arbeiten musste, und Catalina genoss die Aufmerksamkeit der Frauen unseres Viertels. Lediglich Juan hatte schlechte Laune, weil seine Mutter ihn in aller Öffentlichkeit zurechtgewiesen hatte; außerdem musste er ja jetzt die Arbeit von Catalina und Marina miterledigen.
Doch seine Laune besserte sich aus zwei Gründen. Das gute Wetter hielt an, und so konnten die Bauern, die ihre Ernte schon eingebracht hatten, ihm auf dem Feld mit anpacken. Sie kamen einfach vorbei, denn mittlerweile hatte auch der letzte Nachbar von diesen bedeutenden Ereignissen in Beti Nagusia gehört.
„Komm schon, Juan, wir helfen dir beim Einholen der Ernte. Alle zusammen können wir das in drei Tagen schaffen.”
„In drei Tagen? Meinst du etwa, das trockene Wetter hält noch so lange?“
„Red nicht lange rum! Je eher wir anfangen, desto eher sind wir fertig!“
Mit der Hilfe seiner Nachbarn kam auch Juan mit dem Einholen des Weizens voran, und also war er freundlicher zu den Nachbarn auf dem Feld als zu seiner Familie zu Hause. Aber Catalina war eine erfahrene Frau und hatte sich bereits etwas überlegt, um ihren Sohn auch zu Hause etwas aufzumuntern.
„Ich glaube ja, dass es ein Junge wird.”
„Aber wie kannst du das wissen, Mutter? Hat dir die Hebamme vielleicht etwas verraten?”
„Nein, darüber hat sie kein Wort verloren. Trotzdem bin ich überzeugt, dass es ein Junge wird.”
„Ich weiß es aber genau.”,
warf Marina ein.
„Er tritt mir dermaßen fest in den Bauch, es muss einfach ein Junge sein.”
Das überzeugte nun auch Juan, und ab sofort zeigte er sich auch daheim wieder freundlicher. Und schließlich behielten sie alle recht, denn ich bin ja ein Mann.
Die Geburt selbst war keine große Sache. Alles war schon vorbereitet, da das Datum ja bereits feststand. Im Morgengrauen und beim Licht des Vollmondes über Olatzar war ein langer und kräftiger Schrei zu hören. Kurz darauf war ein etwas leiseres Weinen zu hören. Und ich war auf diese Welt gekommen.
Catalina war die ganze Zeit dabei. Außerdem befand sich die Nachbarin Magdalena vom Hof Goti Txikerra im Schlafzimmer. Sie war im Kinderkriegen sehr bewandert, hatte sie doch nicht weniger als vier Töchter zur Welt gebracht. Aus demselben Grund wollte Juan sie aber nicht dabeihaben, denn er fürchtete, dass ihre Anwesenheit Einfluss auf das Geschlecht seines ersten Kindes haben könnte. Aber wenn es darum geht, die Kinder zur Welt zu bringen, dann haben die Ehemänner in der Regel nicht viel zu sagen, und so schickte ihn Catalina raus aus dem Zimmer.
Juan ging also runter in den Stall, um die Ochsen und die Kühe zu beruhigen, aber wer ihn kennt, weiß, dass es die Rinder waren, die ihn beruhigten, und nicht umgekehrt. Unter dem Krähen des Hahnes, dem Gackern der Hühner, dem erstaunten Gesicht unseres Schweins, das auf Futter wartete, machte Juan seine Runde durch den Stall, bis er diesen lauten Schrei hörte.
Doch auch jetzt ließ Catalina ihn noch nicht ins Schlafzimmer treten. Aber auch so war Juan überglücklich, als er an der Tür erfuhr, dass er nun Vater eines gesunden Sohnes war.
Mein Geburtstag war ein besonderer Tag. Mutter trocknete sich die Tränen, nahm ihre Medizin ein, und weinte erneut, doch jetzt waren es Freudentränen. Auch Juan war glücklich und tat etwas, was danach nicht wieder vorkommen sollte: Er machte alle Nachbarn unseres Viertels wach, nicht nur die, die ihm bei der Ernte geholfen hatten, sondern alle Männer, die er in ihren Höfen antraf. Dann überbrachte er ihnen die frohe Neuigkeit und einige Stunden später traf sich eine stattliche Gruppe von Männern in der Taverne von Arkulanda. Catalina hatte ihrem Sohn etwas Geld gegeben und damit lud Juan die Männer auf einige Krüge Wein ein. Doch die glücklichste Person von allen war Catalina. Die Dinge liefen, wie sie es wollte.
Bis zum nächsten Dorffest, der Feier zu Ehren unserer Jungfrau Andra Mari, dauerte es noch einen Monat. Vorher gab es noch eine Menge Arbeiten zu erledigen. Der Weizen lag noch zu Garben gebunden auf den Feldern und musste zum Schutz vor Feuchtigkeit auf den Dachboden gebracht werden. Wer einen Ochsenkarren besaß, benutzte diesen zum Transport, die übrigen Nachbarn banden zum selben Zweck ein Transportgestell auf den Rücken ihrer Maultiere.
Eine große Zahl von Maultieren und Ochsenkarren bewegte sich aus verschiedenen Richtungen auf Olatzar zu und wieder zurück. Während einige Bauern noch den letzten Weizen ernteten, waren andere bereits damit beschäftigt, Heu zu machen. Die Lebensmittel für die Menschen und das Futter für die Tiere wurden auf die riesigen Dachböden der Bauernhöfe eingebracht. Erst wenn dieser Wettlauf gegen das Wetter gewonnen war, wurde in einem zweiten Schritt das Getreide wieder auf den Platz vor den Hof geworfen, um dort den Weizen von der Spreu zu trennen.
❦
„Im Jahr 1712 wurden unsere schlimmsten Befürchtungen wahr. Die Dachböden waren leer, alle Kredite aufgebraucht und unsere Widerstandskräfte verschwunden. Die Erschöpfung war allgemein und in allen Höfen herrschte Verzweiflung. Mittlerweile starben die Einwohner unserer Gemeinde nicht mehr nur vom Hunger geschwächt an verschiedenen Krankheiten, sondern direkt am Mangel an Lebensmitteln. Alle, selbst die Kinder, wussten, was das zu bedeuten hatte: In der großen Krise war uns der dritte Reiter erschienen, der Reiter auf dem schwarzen Pferd! Nach Krieg und Krankheit erschien in unserem Tal nunmehr der Hunger mit einer Waage in der Hand.
1712 ereigneten sich wahre Tragödien. Zum Beispiel erinnere ich mich gut an Marina Iruharatxeta, denn sie wohnte nicht weit entfernt in Arbildu, das an Santa Cruz grenzt. In der großen Not war Marina aber doch nur ein Beispiel von vielen.
Iruharatxeta war ein bescheidenes Bauernhaus, etwas abgelegen in den Bergen oberhalb von Arbildu. Marina hatte es als einziges Kind von ihrem Vater geerbt. Sie heiratete Juan de Bizkarra, der sich der Landwirtschaft auf den Feldern Iruharatxetas widmete. Letztere waren aber so klein, dass die Familie unmöglich davon leben konnte, und so verdingte sich Juan vor allem im Herbst und Winter als Fuhrmann. Die junge Familie schlug sich so durch, und zu ihrem Glück fehlte nur noch ein Kind. Im ersten Ehejahr wollte Marina nicht sofort schwanger werden, und im zweiten erlitt ihr Mann bei Waldarbeiten einen Unfall.