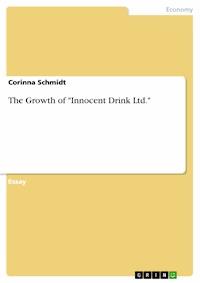Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wenn von einer Million Pflegekräften Einhunderttausend nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen!" wurde Jens Georg Spahn (Bundesminister für Gesundheit) 2018 zitiert und erlebte einen Shitstorm nicht nur von Mitarbeitern des Gesundheitswesens. Anhand der frei erfundenen Story um die Krankenschwester Juliane Dorn zeigt Corinna Schmidt, wie schmal der Grad zum Abgrund ist, wenn der Patient zur Ware wird. Und im Gegensatz zu dem oben genannten Minister weiß die Autorin, wovon sie spricht, verfügt nicht nur über theoretische Kenntnisse, sondern arbeitet seit 1983 "Im Dienste der Gesundheit". Corinna Schmidt, Tochter des Schriftstellers Erik Neutsch, lehnt sich an dessen Buch "Claus und Claudia" an, geht aber mit ihrem Wissen aus der Praxis über diese Geschichte hinaus. "Ein jeder von uns kann innerhalb von Sekunden selbst zum Patienten werden und sollte dann über ein gehöriges Geldpolster verfügen!" Und genau dagegen wehrt sich Juliane Dorn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Corinna Schmidt
Juliane Dorn
Copyright by Primär Verlag Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagsgestaltung: Exakt Werbung, Simone Stolz
Coverfoto 1 © Adobe Stock Geldregen von qkf
Coverfoto 2 © Adobe Stock Äskulapstab von peterschreiber.media
Ebookversion
ISBN 978-3-948414-01-6
Die Handlung und Personen sind erfunden, jede Ähnlichkeit ist rein zufällig. Die Fakten sind jederzeit belegbar, ihre Darstellung allein Sache der Autorin.
Diese Geschichte widme ich hochachtungsvoll
allen Pflegekräften in Deutschland!
Nichts kommt einem doch
teurer in der Welt zu stehen
als die Humanität.
Georg Büchner
(Quelle: Büchner, G., Briefe. An Gutzkow, 1835)
Ein letztes Mal geht Juliane Dorn in die Umkleidekabine auf ihrer Station in der Stadtwaldklinik. Der letzte Dienst liegt bereits zwei Monate zurück, der letzte Dienst in ihrem Arbeitsleben, an den sie nur mit schaudern denkt, nach etwas mehr als fünfundzwanzig Jahren in diesem Haus. Es war ein Frühdienst voller Stress gewesen. Trotz aller Bemühungen konnte kein Patient nur annähernd befriedigend versorgt werden. Ein Zustand, der zur Normalität entartet ist und der Juliane den endgültigen Abschied aus dem Krankenhausdienst mehr als nur leicht macht. Fast genießerisch wirft sie ihre Krankenhausbekleidung nun auf nimmer Wiedersehen in den vorgesehenen Wäschesack. Als Juliane zum Abschied in den Spiegel schaut, spürt sie, wie ihr eine Last von ihren Schultern fällt, als würde sie sich eines schweren Rucksacks entledigen. Dieses Gefühl, hatte sie vor vielen Jahren schon einmal verspürt. In diesem Moment erinnert sie sich daran, als wäre es erst gestern gewesen. Vor etwa dreiunddreißig Jahren, als sie ihre Examensprüfung zur Säuglingsschwester erfolgreich bestanden hatte, da beschlich Juliane genau dieses Gefühl der Erleichterung. Endlich durfte sie damals im Alter von dreiundzwanzig Jahren in ihren Traumberuf starten, der für sie viel mehr als nur eine Tätigkeit zum Verdienen des Lebensunterhalts war. Die ersten Jahre hatte sie auch nie an der Richtigkeit ihrer Berufswahl gezweifelt, ihre Arbeit erfüllte Julianes Leben damals zur vollsten Zufriedenheit. Das lag nun schon so viele Jahre zurück. ,Wie schnell doch nur die Zeit vergeht, denkt sie ein wenig erschrocken und betrachtet dabei ihr Spiegelbild. Die Jahre hatten unübersehbare Spuren hinterlassen, stellt sie etwas wehmütig fest. Die Lider ihrer immer noch mandelförmigen blaugrauen Augen sind inzwischen schlaffer, der Glanz hat an Stärke schon etwas verloren. Und auch sonst war so manches Fältchen in ihrem oval geschnittenen Gesicht zur Falte geworden. Ihr weiches und nicht sehr voluminöses Haar, trägt Juliane noch wie damals, locker auf die Schultern fallend. Derweil allerdings nicht mehr in ihrem natürlichen Mittelblond, sondern etwas heller gefärbt, da ihr Haar im Laufe der Zeit zunehmend ergraut ist. Figürlich hat sie sich all die Jahre nicht wesentlich verändert. War sie früher eher von zierlicher Gestalt, so ist sie auch heute immer noch sehr schlank, worauf sie ein wenig stolz ist. Diese Schlankheit verdankt sie weniger einer gesunden Lebensweise, sondern vielmehr ihrer genetischen Veranlagung. Auch ihrem Kleidungsstil blieb Juliane treu, sie bevorzugt nach wie vor für den Alltag eine bequeme und sportliche Garderobe und fühlt sich immer noch in Jeans und Shirts am wohlsten. Mit sich zufrieden, verlässt Juliane nun die Umkleidekabine und läuft mit schnellen Schritten, fast fluchtartig, die vier Etagen über das Treppenhaus zum Ausgang.
Draußen angekommen, scheint die Sonne bereits mit geballter Kraft am blauen Himmel und sorgt wieder für extrem warme Temperaturen. Ein Tag, den Juliane unbedingt in vollen Zügen auszukosten bereit ist. Sie atmet tief durch und setzt sich auf eine der mehreren Bänke des Klinikgeländes. Die Wärme empfindet sie zunächst an diesem späten Vormittag als sehr angenehm. Dabei schweift ihr Blick über den Parkplatz, der von Bäumen umsäumt ist, bis hin zu dem mehrstöckigen Schwesternwohnheim, in welchem sie damals wohnte, als sie im März 1993 ihre Arbeit in der Stadtwaldklinik aufnahm. Nun versinkt sie in Erinnerungen. Wie ein Film laufen die Bilder vor ihr ab.
Nach Julianes Scheidung 1992, zog sie mit ihren Kindern aus Zwickau zurück in ihre Heimatstadt Merseburg, eine Kreisstadt im Süden von Sachsen-Anhalt. Hier bezog sie zunächst eine kleine Wohnung, unweit ihres Elternhauses. Die Arbeitssuche gestaltete sich allerdings durch die Umstrukturierungen nach der Wende für Juliane schwierig. Eine Freundin, die inzwischen in Köln lebte, gab Juliane den Rat, es in dieser Umgebung ebenfalls zu probieren. So endeten die zahlreichen Bewerbungsschreiben schließlich hier in der Stadtwaldklinik, am Rande von Bonn. Juliane, damals noch mit Familiennamen Liebig, wurde von Herrn Hoffmann, dem derzeitigen Pflegedienstleiter, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Sie empfand dieses Gespräch mit ihm sehr angenehm, da es mehr einer Unterhaltung glich. Er war etwa in ihrem Alter und von sportlicher Gestalt. Herr Hoffmann wirkte auf die junge Frau durch seine etwas längeren Haare und seiner Nickelbrille weniger als Vorgesetzter, sondern eher wie ein Sozialarbeiter. In jenem Gespräch erfuhr Juliane, dass Herr Hoffmann erst einige Monate zuvor die Stelle als Pflegedienstleiter angetreten hatte. Es störte ihn auch nicht, dass sie keinen Taufschein besaß, obwohl die Klinik der evangelischen Kirche unterlag. Bisher hatte Juliane damit andere Erfahrungen gesammelt. Herr Hoffmann erzählte von seinen Ideen, die er hier im Haus in der Pflege umsetzen wolle. Dieser Tatendrang des Mannes gefiel ihr. Eine Stelle auf der Neugeborenenstation war damals leider gerade nicht frei und so fragte er, ob Juliane vorerst bereit wäre auf einer internistischen Station zu arbeiten. Es wäre auch nur für zwei Jahre, dann würde eine Kinderkrankenschwester in den Ruhestand gehen und Juliane könnte problemlos diese Stelle übernehmen. Damit zeigte sie sich einverstanden. Keine drei Wochen später begann ihr Arbeitsverhältnis. Die Geschäfts- führung und Personalabteilung sahen allerdings ein Problem darin, dass Juliane Liebig die Berufsbezeichnung Säuglingsschwester trug. In den alten Bundesländern gäbe es zwar Kinderkrankenschwestern, was die Pflege von Säuglingen bis zu Kindern von sechzehn Jahren beinhalte, aber Juliane habe ja eine Ausbildung, die nur das Säuglingsalter beträfe. Dass eine Säuglingsschwester auch in der Krankenpflege ausgebildet wurde, zusätzlich spezialisiert auf Neugeborene und Säuglinge, konnten die Damen und Herren jener Abteilungen nicht verstehen. Vielleicht wollten sie es auch nicht verstehen. Sie bestanden darauf, dass Juliane auf einer internistischen Station nur mit einem Arbeitsvertrag als Krankenpflegehelferin tätig werden durfte. Dieses bedeutete natürlich auch eine geringere Bezahlung. Da es nur für zwei Jahre sein sollte, fand sich die junge Frau damit ab. In der sechsmonatigen Probezeit wollte sie auch Spannungen gleich zu Beginn vermeiden. Damals wusste Juliane auch noch nichts von der späteren Streichung dieser Stelle auf der Neugeborenenstation. In der internistischen Abteilung wurde sie als neue Mitarbeiterin von ihren Kollegen sehr herzlich aufgenommen. Wenn ihr auch die Einarbeitung mental sehr schwer viel. Hatte sie bisher Patienten, die am Beginn ihres Lebens standen, war sie nun auf der anderen Seite. Viele Patienten befanden sich jenseits der Neunzig und das Sterben gehörte hier zum Arbeitsalltag dazu. Während die - meist weiblichen - Kollegen mit Hingabe pflegten, kostete es Juliane immer wieder Überwindung, die sie sich allerdings nicht anmerken ließ. Auch körperlich war es nicht mit der Arbeit auf einer Säuglingsstation zu vergleichen. Zwar war der Start ins Leben auch nicht für jedes Baby leicht und setzte für eine Säuglingsschwester viel Wissen voraus, war es doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auch das Verhalten vieler Patienten war für Juliane gewöhnungsbedürftig. Sie vermisste oft eine angemessene Wertschätzung gegenüber des Pflegepersonals. Unter ihren Kollegen fühlte sie sich dennoch wohl. Es herrschte im Team eine lockere und angenehme Stimmung.
Im Wohnheim, in welchem Juliane vorerst ein kleines Zimmer bewohnte, glich das Zusammenleben mit einigen Pflegekräften, Pflegeschülern, Zivildienstleistenden und denen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (kurz FSJ-ler) absolvierten, eher einer Wohngemeinschaft. In der großen Gemeinschaftsküche auf der Etage traf man sich oft und auch sonst verabredete man sich zum Grillen oder anderen Freizeitbeschäftigungen. Es wurde gelacht und gefeiert. Dieses ungezwungene Zusammenleben half auch über ihr Heimweh etwas hinweg. Trennten sie doch über 500 Kilometer von ihrem Elternhaus, in dem ebenfalls ihre Kinder, Markus und Katharina, vorerst lebten. Während der Probezeit wollte sie ihrem zehnjährigen Sohn nicht schon wieder einen Schulwechsel zumuten. Auch Katharina hatte sich als Erstklässlerin gut in der Schule eingelebt. Außerdem wusste Juliane nicht, ob ihr Arbeitsvertrag nach der Probezeit verlängert werden würde. Ihrer Freundin wurde nach Ablauf bereits zweimal gekündigt. So war es wohl die beste Entscheidung, die Kinder vorübergehend bei den Großeltern zu lassen. Sollte Juliane später gar einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten, wollten ihre Eltern sich ein Häuschen im Rhein-Sieg-Kreis kaufen, um ihre Tochter bei der Betreuung der Kinder zu unterstützen, weil ein Krankenhaus unweigerlich Schichtdienst erforderte. Julianes Mutter befand sich bereits im Ruhestand und für ihren Vater stellten sich - als freier Journalist - keine Probleme bei der Wahl des Wohnortes in den Weg. Nach bestandener Probezeit erhielt Juliane tatsächlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Doch ein schreckliches Ereignis änderte jäh all ihre Pläne. Katharina und Markus verbrachten gerade ihre Herbstferien bei Juliane im Wohnheim, als jener Telefonanruf an einem späten Abend einging. Es war eine ihrer beiden älteren Schwestern, die ihr mit zitternder Stimme schluchzend die furchtbare Nachricht von einem tödlichen Autounfall der Eltern mitteilte. Ein betrunkener Falschfahrer war frontal in das Auto gekracht. Juliane zog es den Boden unter den Füßen weg. Eine Leere durchzog ihren Körper, sie fühlte sich schlaff und schwindelig. Obwohl sie von tiefster Traurigkeit erfasst wurde, funktionierte sie ab sofort nur noch mechanisch. Zeit für Trauer konnte sie sich nicht leisten. Die Kinder mussten so schnell wie möglich die Schulen wechseln und eine Wohnung musste auch umgehend gefunden werden. Dabei durfte aber auch gleichzeitig die Arbeit im Krankenhaus nicht vernachlässigt werden. Ein Spagat, der keinen Platz für Trauer bot. Alles nur wegen eines rücksichtslosen Mannes, der billigend in Kauf nahm, zwei Menschen skrupellos aus dem Leben zu reißen, sowie dauerhaft deren Familie zu zerstören, weil er sich volltrunken hinter das Steuer seines Autos setzte. Ein Mensch, von dessen Existenz Juliane bis zu diesem Tag nicht einmal ahnte. Ihr wurde sofort Urlaub gewährt. Herr Hoffmann und Monika - die Stationsschwester – zeigten viel Verständnis, darüber war Juliane sehr dankbar.
Andere Erfahrungen hingegen sammelte sie bei der Geschäftsführung, als sie um eine Betriebswohnung bat. Herr von Stein, der stellvertretende Geschäftsführer, gewährte ihr endlich einen Termin, nachdem sie mehrmals bei seiner Sekretärin angerufen hatte. Während er sich behäbig in den Sessel hinter seinen Schreibtisch drückte, ließ er die junge Frau vor diesem stehen, was Juliane das Gefühl eines kleinen Schulmädchens vermittelte. Durchaus von ihrem Gegenüber auch so gewollt, einem Mann, der allein durch sein äußeres Erscheinungsbild eine gewisse Kälte ausstrahlte. Sein Gesicht glich einer Maske, keine Rührung, keine Zuckung - Wie eine Modepuppe aus dem Schaufenster eines Herrenbekleidungsausstatters. Akkurate Haarfrisur, sorgsam geknotete Krawatte, die Bügelfalte in der Anzughose scharfkantig gerade... Nachdem Juliane kurz ihr Anliegen schilderte, erhielt sie eine schroffe und abfällige Antwort. Sämtliche Angestellten würden andauernd ständig irgendwelche Forderungen stellen. Noch einmal versuchte Juliane, ihn zu bewegen, indem sie nur vorübergehend um eine Betriebswohnung bat. Herr von Stein reagierte darauf geradezu spöttisch, wenn nicht sogar verächtlich. Als geschiedene und alleinerziehende Mutter müsse sie sich wahrlich nicht einbilden, hier im Stadtviertel eine Wohnung finden zu können. In diesem Moment wusste Juliane, Herr von Stein war in keiner Weise gewillt, ihr nur die geringste Unterstützung zu gewähren. Der Zorn ging mit ihr durch. Ein Augenblick, in dem ihr jede nachfolgende Konsequenz völlig egal war, sicher durchaus auch bedingt durch ihre angestaute Trauer. Die Worte platzten nur so aus ihr heraus: „Die Angestellten fordern also nur? Haben Sie vergessen, dass diese ach so fordernden Angestellten jeden Tag für ihr geringes Gehalt Menschen pflegen, manchmal bis zur eigenen Erschöpfung? Ohne diese Angestellten könnten sie das Krankenhaus doch schließen! Ich habe nur um ein wenig Verständnis für meine Lage gebeten, mehr nicht. Und dieses Haus nennt sich christlich? Von Nächstenliebe spüre ich bei Ihnen absolut nichts.“ „Das ist hier ein Unternehmen, wie jedes andere. Hier zählt das Geld. Gepflegt wird übrigens auch nur gegen Bezahlung, nicht anders. So läuft nun mal das Leben.“ „An Ihrer Stelle würde ich mich schämen.“ Bei diesem Satz spürte Juliane, wie ihr Herz hämmerte und ihr Blut durch ihren Körper peitschte. Jetzt wurde Herr von Stein lauter: „Überlegen Sie sich, wen Sie hier vor sich haben!“ „Einen Menschen ohne jegliches Mitgefühl! Meine Eltern sind durch einen besoffenen Geisterfahrer gerade ums Leben gekommen. Und Sie behandeln mich..., wie einen unliebsamen Bittsteller!“ „Ich behandle Sie wie einen Bittsteller? Nein, ich vertrete nur die Interessen des Unternehmens. Ihren Namen werde ich mir allerdings merken, Frau Liebig! Und jetzt verlassen Sie mein Zimmer, hier gibt es nichts mehr zu bereden.“ Dieses Gespräch war damit beendet.
Zurück im Wohnheim kauerte sich Juliane in der Küche auf einen Stuhl, stützte sich mit den Ellenbogen auf die Tischplatte und stemmte ihre Stirn zwischen beide Fäuste. Jetzt brach sie in Tränen aus. Ein regelrechter Weinkrampf schüttelte sie. Ein Ausbruch von Trauer, Ohnmacht und Wut.
Als sie einigen ihrer Mitbewohner von diesem Wortgefecht erzählte, erntete sie zwar für ihren Mut Bewunderung, dennoch befürchteten einige, die Sache werde ein übles Nachspiel haben. Diese Befürchtung erwies sich jedoch als unbegründet. Es geschah, zum Erstaunen, nichts.
Mit Hilfe von Schwester Monika, fand Juliane schließlich ziemlich schnell eine kleine Wohnung, in der naheliegenden Gemeinde W.. Als altansässige Rheinländerin kannte sich Monika bestens aus, so waren auch bald die Schulen für Markus und Katharina gefunden...
Es folgten Jahre, die kaum Zeit für Erholung ließen. Noch jung an Jahren, fühlte sich Juliane als alleinerziehende Mutter, mit dem wenigen Gehalt einer Helferin, oft überfordert. Jeden Pfennig musste sie umdrehen und genaustens überlegen, wofür sie das knappe Geld ausgeben könne. Außerdem trug sie die Last jeder Entscheidung des täglichen Lebens allein. Auch ihre Geschwister sah sie sehr selten. Zum einen lag es an der wenigen Freizeit, zum anderen an den finanziellen Mitteln. Ein weiteres Problem für gegenseitige Besuche waren die unterschiedlichen Ferienzeiten der jeweiligen Bundesländer, denn auch Julianes Geschwister hatten schulpflichtige Kinder. So auf sich allein gestellt, fühlte sie sich oft wie eine vom Schiff gefallene Person, mit Gepäck beladen, die sich aber dennoch mit letzter Kraft über Wasser hielt.
Der Krankenhausalltag wurde stufenweise immer härter. Geschäftsführung und Pflegedienstleitung wurden - fast zeitgleich - nach dem Zusammenschluss mit einem anderen Krankenhaus ausgetauscht. Es folgte ein erheblicher Abbau des Pflegepersonals in mehreren Schritten. Nach der bundesweiten Einführung der Fallpauschale, kurz DRG, wurden die Patienten regelrecht zur Ware des Unternehmens, namens Krankenhaus. Und da das auch noch nicht genug war, führte man später noch den Pflegekomplex- Maßnahmen-Score ein. Für diesen sogenannten PKMS flossen nun zusätzliche Gelder in die Krankenhäuser. Ein Dokumentationsmarathon-Zeitalter war erschaffen worden. Und Papier war, ist und bleibt geduldig. Leider aber – berechtigterweise - nicht die Patienten...
Juliane schaut auf ihre Armbanduhr. Erstaunt bemerkt sie, länger auf der Bank gesessen zu haben, als vermutet. Sie erhebt sich und geht zu ihrem Auto, das zum Glück im Schatten eines Baumes steht. Sie dreht sofort nach dem Starten die Klimaanlage auf und fährt los. Neben der Einlass-Schranke des Krankenhauses steht ein Fahnenmast, mit einer Flagge am oberen Ende versehen, weht das Logo des Krankenhauses: >WEIL DER MENSCH UNS WICHTIG IST - Die Stadtwaldklinik< einem jeden unausweichlich entgegen. Das ist so heuchlerisch und verlogen, schießt es Juliane durch den Kopf, als sich unweigerlich auch ihr wieder diese Fahne vor die Augen drängelt. Eine Aufschrift mit den Worten. >WEIL DAS GELD UNS WICHTIG IST< wäre - ihrer Meinung nach - passender. Nur schnell weg, sind ihre Gedanken. Das Autoradio stellt sie auf ihren eingelegten Musikstick ein. Es ertönt der Song >Monopoly<, den sie im Refrain lauthals mitsingt. Treffender sind ihre Gefühle und Gedanken des Augenblickes nicht zu beschreiben.
Auch wenn Julianes Kündigung ein bitteres Schicksal zugrunde liegt, ist sie nur noch froh, nie mehr in diesem Irrenhaus, wie sie es nennt, arbeiten zu müssen. Immer mehr fragwürdige Dienstanweisungen und Bestimmungen, die leider nur von einigen wenigen (nicht nur hinter vorgehaltener Hand) hinterfragt werden. Ist doch die Angst zu groß, Unannehmlichkeiten zu bekommen. Besonders bei denen, die nur einen befristeten Arbeitsvertrag besitzen oder bei älteren Angestellten, die bereits durch gesundheitliche Probleme mit längeren Krankheitsausfällen für Unmut bei der Leitung des Hauses sorgen.
Selbst Juliane, die ihr Herz auf der Zunge trägt, hatte sich im Krankenhaus viele Jahre einigermaßen zurückgehalten, obgleich es ihr auch verdammt oft schwerfiel. Waren da doch noch ihre Kinder, die ihr sehr wichtig waren. Erst als Markus und später auch Katharina auf eigenen Füßen standen und Juliane sich kurz darauf mit ihrem jetzigen Ehemann Thomas Dorn liierte, änderte sie ihr Verhalten, wurde für ihren Arbeitgeber eine immer unbequemere Mitarbeiterin, die die Dinge mehr und mehr hinterfragte und sich mitunter auch, sobald nötig, zur Wehr setzte. Auf einem Klassentreffen war es, als sie sich ineinander verliebten. Juliane gefiel zuerst sein Äußeres: Er war groß und von athletischer Gestalt, seine kurzen, struppigen Haare ließen ihn etwas lustig, gleichzeitig verwegen erscheinen. So fasste sie nach zwei Gläschen Rotwein all ihren Mut zusammen und sprach ihn einfach an: „Wo hast du denn deine wunderschönen langen, dunklen Locken gelassen, um die wir Mädchen dich damals immer so beneidet haben?“ Sie ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, dass diese einfache Frage ihr Leben verändern sollte. Denn an jenem Abend unterhielt sie sich fast ausschließlich nur noch mit Thomas, sie klebte förmlich an seinen schönen blaugrauen, klaren Augen. Beide entdeckten unendlich viele Gemeinsamkeiten während ihrer Gespräche über Gott und die Welt. Juliane gefiel seine Offenheit und - was ihr besonders wichtig war - Thomas war kein spießiger Anpasser, kein Duckmäuser. Aus diesem anfänglichen Verliebtsein erwuchs bald eine große Liebe zwischen beiden. Es dauerte nicht lange und sie beendeten ihre Fernbeziehung. Thomas Dorn zog zu seiner Juliane. Endlich war sie nicht mehr nur auf sich allein gestellt mit sämtlichen Entscheidungen im Alltag. Auch finanziell lebte es sich bedeutend einfacher. So suchten sie sich bald auch ein neues Zuhause und fanden zusammen eine wunderschöne Wohnung mit Garten, in einem idyllischen Dörfchen, ebenfalls in der Gemeinde W...
Ein Schritt in ihrem Leben, den Juliane niemals bereut hat. Thomas war es schließlich auch, der seine Frau dazu bewegte, sich endlich gegen ihren bestehenden Arbeitsvertrag zu wehren. Schließlich begann sie sich mit dem Arbeitsgesetzbuch ausgiebig zu beschäftigen und kämpfte zusammen mit Herrn Urich, dem damaligen Vorsitzenden der MAV, also der Mitarbeitervertretung, eine Änderung ihres Arbeitsvertrages durch. All die Jahre erfüllte Juliane den vollen Aufgabenbereich einer examinierten Krankenschwester, der um einiges umfangreicher und verantwortungsvoller war, als der Aufgabenbereich einer Krankenpflegehelferin. Um die Bezahlung wurde sie jedoch fast zwölf Jahre betrogen. Daran änderte auch nicht das Verhalten der Damen und Herren der Geschäftsführung und Personalabteilung, die sich als wohlwollende Gönner bei der Änderung des Arbeitsvertrages gaben. Es war ein jahrelanger Betrug. Hatte Juliane in der Vergangenheit die Arbeit einer examinierten Krankenschwester verrichten müssen, bekam sie dennoch nur das Gehalt einer Hilfskraft. Nicht lange nach der Vertragsänderung, wurde Juliane auf eine andere Station versetzt, in die HNO-Abteilung. Mit diesem Schachzug sollte wohl von Seiten der Krankenhausleitung ein Zeichen gesetzt werden, eine Art Machtdemonstration. Auch wenn es ein Umdenken durch völlig andere Arbeitsabläufe erforderte, empfand Juliane diese Veränderung durchaus als eine angenehme Abwechslung, anstatt einer Bestrafung.
Sie war froh und stolz auf sich, den Kampf zusammen mit Herrn Urich gewonnen zu haben. Dieser kleine, etwas untersetzte Mann brachte in dieser Verhandlung handfeste Argumente, war er doch seit den 1968ern ein leidenschaftlicher Kämpfer für Gerechtigkeit. Kurze Zeit später hatte er das Rentenalter erreicht und ging in den Ruhestand, womit sich auch allmählich der Charakter der MAV änderte. Sie verkam – so empfand es nicht nur Juliane - zunehmend zu einem Haufen Mitglieder, die zwar die Vorteile einer Mitgliedschaft für sich ausnutzten, bei Konflikten sich aber spürbar auf die Unternehmerseite schlugen. Lediglich eine Schlichtung konnten die Angestellten noch erwarten.
Von Ängsten war auch Juliane nie frei, anmerken ließ sie sich davon am Arbeitsplatz jedoch nichts. Der Druck, der auf ältere Kollegen ausgeübt wurde, deren Belastbarkeit mit zunehmenden Alter nachgelassen hatte, fiel ihr bereits vor Jahren auf und bereiteten ihr ein ungutes Gefühl, auch weil viele diesem Druck nicht standhielten und früher als vorgesehen in Rente gingen, trotz erheblicher finanzieller Einbußen.
Juliane erinnerte das irgendwie unweigerlich an das Märchen der Gebrüder Grimm > die Bremer Stadt- musikanten<. Alt oder krank, nicht mehr leistungsfähig und somit wertlos, wurden Esel, Hund, Katze und Hahn davon gejagt, ihrem Schicksal gnadenlos ausgesetzt. Älter wird jeder, vor Krankheiten ist leider auch niemand gefeit. Bloß keine chronische Krankheit bekommen, welche die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt, schwirrte es ihr oft durch den Kopf. Für sie mit ein unabdingbarer Grund, sich eingehend mit den Arbeitsgesetzen zu befassen. Auch um sie, Juliane Dorn, würden weder die Zeit noch andere Launen der Natur, einen Bogen schlagen. Die Arbeit würde später auch ihr schwerer von der Hand gehen.