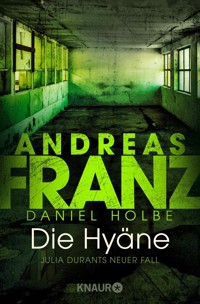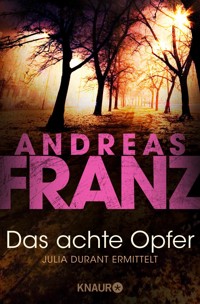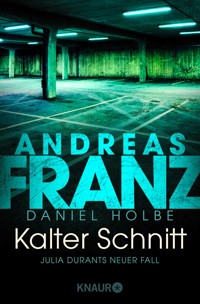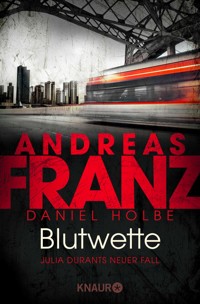Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine Serie mysteriöser Mädchenmorde beunruhigt die Bevölkerung von Frankfurt am Main. Alle Ermordeten sind blond. Der Mörder vergewaltigt seine Opfer, tötet sie und vollzieht sodann ein Ritual, bei dem er die Haare der Mädchen zu zwei Zöpfen mit roten Schleifchen bindet. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Fast hilflos jagen Kommissarin Durant und ihre Kollegen scheinbar hinter einem Phantom her - bis ein nahezu unglaublicher Zufall den Täter enttarnt. Jung, blond, tot von Andreas Franz: Spannung pur im eBook!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Franz
Jung, blond, tot
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Serie mysteriöser Mädchenmorde beunruhigt die Bevölkerung von Frankfurt am Main. Alle Ermordeten sind blond. Der Mörder vergewaltigt seine Opfer, tötet sie und vollzieht sodann ein Ritual, bei dem er die Haare der Mädchen zu zwei Zöpfen mit roten Schleifchen bindet. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Fast hilflos jagen Kommissarin Durant und ihre Kollegen scheinbar hinter einem Phantom her – bis ein nahezu unglaublicher Zufall den Täter enttarnt.
Inhaltsübersicht
Prolog
Donnerstag, 16. September, 19.45 Uhr
Freitag, 17. September, 8.30 Uhr
Samstag, 18. September, 7.30 Uhr
Sonntag, 19. September, 0.45 Uhr
Montag, 20. September, 12.00 Uhr
Dienstag, 21. September, 6.30 Uhr
Mittwoch, 22. September, 9.00 Uhr
Donnerstag, 23. September, 9.00 Uhr
Freitag, 24. September, 10.00 Uhr
Montag, 27. September, 8.00 Uhr
Dienstag, 28. September, 1.30 Uhr
Mittwoch, 29. September, 8.00 Uhr
Donnerstag, 30. September, 8.00 Uhr
Mittwoch, 6. Oktober, 11.00 Uhr
Epilog 1
Epilog 2
Wenn die Seele verbrennt, bleibt nicht einmal Asche
Er spielte im Wohnzimmer, einem großen, hellen Raum mit zwei Fenstern, spärlich eingerichtet mit alten, verschrammten Möbeln. Der Teppichboden abgetreten, die Farben verblaßt, die Wände, bis auf ein Bild von Großvater, von vergilbtem Weiß und leer, von der Decke baumelte eine 25-Watt-Birne unter einem geflochtenen Bastschirm, den eine alte Zigeunerin hiergelassen hatte. Auf dem Tisch ein paar zerlesene Zeitungen, Mode- und Klatschblätter, der Aschenbecher quoll über von Stummeln und Asche. Ein Schaukelstuhl, in dem nie jemand saß, stand in der Ecke neben der alten, staubigen Kommode, deren Holz voller Kerben und Schrammen war.
Er fuhr mit seinem Holzauto über den mit Brot- und Kekskrümeln übersäten Boden, seit Wochen hatte seine Mutter nicht mehr gesaugt, und dabei ahmte er mit dem Mund die Geräusche eines vorbeidonnernden Trucks nach. Die Sonne fiel in breiter Bahn ins Zimmer, trockene Hitze. Er rutschte auf den nackten Knien, drückte mit seiner Hand fest auf das Spielzeug. Mit einemmal hielt er inne, zuckte zusammen, hob den Kopf ein wenig, ein schwarzer Schatten vor der Fliegengittertür verdunkelte den vorderen Teil des Zimmers. Kräftiges Klopfen gegen den Holzrahmen, ein durchdringendes, trockenes Hämmern, das ihm durch Mark und Bein ging und in seinen Ohren dröhnte. Er erstarrte.
Seine Mutter tänzelte zur Tür, nicht ohne vorher ihre Zigarette ausgedrückt zu haben, strich den Rock gerade, zupfte an der Bluse, betrachtete sich kurz im Spiegel, schien zufrieden mit ihrem Äußeren und öffnete die Tür. Der Mann trat ein, er war sehr schlank, doch muskulös, mindestens anderthalb Kopf größer als sie. Er faßte sie kurz mit kräftigem Griff am Kinn, dann blickte er ins Zimmer.
»Schön, daß du da bist«, hauchte sie.
Der Mann deutete mit dem ausgestreckten Arm auf den Jungen. »Was macht der hier?« Harte Stimme, böser Blick. »Er spielt.«
»Ich habe dir doch deutlich genug gesagt, daß ich ihn nicht sehen will! Schick deinen kleinen Bastard weg!«
»Ja, ja, schon gut. Komm, Spatz, du gehst jetzt rüber in das andere Zimmer. Es wird nicht allzulange dauern.«
Er kroch mit vor Angst geweiteten Augen auf dem Hosenboden ein paar Zentimeter zurück, bis er an die Couch stieß. Er zitterte, wollte etwas sagen, doch seine Kehle war wie zugeschnürt, alles in ihm schien zu Eis zu erstarren.
»Los, steh auf und komm!« sagte sie etwas lauter und faßte ihn am Arm.
Er versuchte, sich so schwer zu machen, daß sie ihn unmöglich würde fortziehen können, aber sie war stärker.
»Verdammt, ich will nicht immer das gleiche Spiel mit dir spielen! Du wirst jetzt machen, was ich dir sage, sonst passiert dir was! Hast du das verstanden?!«
»Hau ihm eins hinter die Ohren, dann kapiert er’s schon!«
»Halt du dich aus meiner Erziehung raus!« keifte sie ihn an. »Das geht nur den Jungen und mich etwas an! Du wirst schon noch zu deinem Vergnügen kommen! Los jetzt, komm!«
Der Junge erhob sich zögernd, den Blick ängstlich auf den Mann mit der drohenden Haltung gerichtet, auf die riesigen Hände, so groß wie Pizzateller. Der Mann ließ sich auf die Couch fallen, spreizte die Beine, nahm seinen Hut ab und begann, sein Hemd aufzuknöpfen. Der Junge wußte nicht, was der Mann vorhatte, aber es wirkte bedrohlich. Die Mutter zog den Jungen hinter sich her, riß die Tür auf, er hielt sich mit seiner kleinen linken Hand an dem morschen Türrahmen fest, doch die Mutter schubste ihn einfach mit einem kräftigen Stoß hinein. Sie schloß die Tür sofort wieder und drehte den Schlüssel herum.
Der Raum war dunkel und brütend heiß, die Fensterläden von außen verriegelt, die Griffe am Fenster abgeschraubt. Nicht einmal ein winziger Sonnenstrahl fiel herein, um wenigstens ein klein bißchen Licht in die furchterregende, erdrückende Finsternis zu bringen. Er trommelte wie immer gegen die Tür und schrie: »Mama, laß mich hier raus, laß mich hier raus, ich will hier raus!« Er schrie vielleicht zwei Minuten, bis der Mann an die Tür kam, dagegentrat, daß Tür und Rahmen erzitterten, das ganze Haus zu vibrieren schien, und zischte: »Wenn du nicht endlich deine gottverdammte Schnauze hältst, reiß ich dir deinen kleinen Arsch auseinander!« Und nach einer kurzen Pause:
»Oder ich mach mit dir das gleiche, was ich mit deiner Mutter mach, elender Bastard!«
Und wie immer sank der Junge zu Boden, und wie immer kauerte er sich in eine Ecke, und wie immer wimmerte er nur noch. Und wie so oft urinierte er in die Hose; ein Reflex, er konnte das Wasser nicht zurückhalten.
Stöhnen, dazwischen abgehackte, spitze Schreie aus dem Zimmer. Ein paarmal glaubte er, Schläge zu hören, Mutters Aufschreien, ungehaltene, scharfe Worte des bösen Mannes.
Mutter weinte. Er haßte dieses Schwein da draußen, das seiner Mutter weh tat. Und er haßte seine Mutter, daß sie dieses Schwein immer wieder ins Haus ließ. Ihn und all die anderen. Sein kleiner Verstand begriff noch nicht, was sie da draußen trieben, aber es konnte nicht gut sein, wenn Mutter so oft weinte. Bestimmt hatte sie Schmerzen, bestimmt tat man ihr weh, warum sonst sollte sie schreien. Wie immer hielt er sich die Ohren zu, um es nicht hören zu müssen. Er verstand nicht, warum sie ihn andauernd in dieses finstere Zimmer sperrte. Er verstand nicht, warum sie sagte, daß sie ihn liebte, und ihm dann so etwas antat. Und wie so oft fiel sein erschöpfter Körper zur Seite, und erlösender Schlaf hüllte ihn ein. Sein Gesicht war tränenverschmiert. Nein, er verstand diese Welt nicht, er war ja auch gerade erst fünf Jahre alt.
Donnerstag, 16. September, 19.45 Uhr
Berger besuchte den Friedhof zweimal in der Woche. Mindestens. Wenn es seine Zeit erlaubte, auch öfters. Seit zwei Jahren kam er, stellte jedesmal einen großen Strauß frischer Blumen in die grüne Plastikvase, alle drei Monate setzte er ein paar neue Pflanzen auf das Doppelgrab. Heute hatte er Freesien gekauft, und er kam, obwohl es regnete und die Dämmerung bereits hereingebrochen war. Er mußte sich beeilen, in einer Viertelstunde wurde das Tor geschlossen.
Mit langsamen Schritten bewegte er sich über den weichen, dunkelerdigen Boden, den Blick geradeaus gerichtet, eine Hand in der Manteltasche. Kühler, böiger Nordwestwind peitschte den Regen gegen Bergers Mantel. Eine alte, schwarzgekleidete Frau mit krummem Rücken und Wollstrümpfen an den rachitischen Beinen kam ihm entgegen, schaute kurz zu ihm auf, tauchte gleich darauf wie ein Schemen in die anbrechende Dunkelheit ein. Er paßte nicht auf, trat in eine Pfütze. Die Bäume verloren ihre ersten Blätter, die Natur legte sich zum Ausklang des Sommers ein buntes Kleid an, der Herbst war nur noch Tage entfernt. Nach einem zeitweise unerträglich langen, heißen, schwülen Sommer gab es kaum jemanden, der sich nicht nach kühleren Tagen und Nächten sehnte. Wenn man dem Wetterbericht glauben konnte, sollte diese Abkühlung schon am Wochenende kommen, aber Berger traute den Prognosen nicht, zu oft in den letzten Tagen und Wochen waren sie falsch gewesen. Bestimmt war auch dieser Regen wieder nur eine schnell vorübergehende Episode.
Das Grab befand sich fast am anderen Ende des Friedhofs. Als er dort war, blieb er beinahe regungslos davor stehen, die Hände vor dem Bauch verschränkt, kniff für einen Moment die Lippen zusammen, nahm den noch nicht einmal verwelkten Strauß, den er erst am Sonntag gebracht hatte, aus der Vase, um den frischen hineinzustellen. Mit der kleinen Harke, die er hinter dem Grabstein hervorholte, begradigte er ein paar kaum sichtbare Unebenheiten im Boden, beobachtet von einem neugierigen Rotschwänzchen, das ruhelos, den Kopf keck geneigt, um die Grabumrandung hüpfte, er legte die Harke wieder zurück, kehrte um, warf die alten Blumen in den dafür vorgesehenen Kompostbehälter und machte sich, müde und erschöpft von einem langen Tag, auf den Weg zum Auto.
Der Regen hatte in den letzten Minuten nachgelassen. Auf den Straßen drängten viele Menschen nach Hause. Er stieg in seinen Wagen, drehte den Zündschlüssel und fuhr los. Andrea, ob sie zu Hause war? In letzter Zeit hielt sie sich immer häufiger bei ihrer Freundin auf, beide siebzehn, beide voller Tatendrang. Manchmal überfiel ihn ein Gefühl beklemmender Melancholie, wenn er nach Hause kam und niemand da war, der ihn begrüßte, wenn das Alleinsein in dem großen Haus ihn erdrückte, Wände ihn kalt anstarrten, keiner außer dem Fernseher mit ihm sprach.
Ein weiterer in einer Reihe anstrengender Tage lag hinter ihm. Spurensuche. Hoffnungslosigkeit. Zwei Mädchen, eines davon bis zur Tat noch unberührt, innerhalb von zwei Wochen bestialisch ermordet. Nein, nicht ermordet, abgeschlachtet. Und kein Hinweis auf den Täter, kein Zeuge. Kein abgerissener Knopf, kein Medaillon, das vom Täter stammen könnte. Nur ein paar bis jetzt nichtssagende Fasern, Sperma, eine winzige Spur Fremdblut und die daraus bestimmte Blutgruppe Null, Rhesusfaktor positiv. Eine Allerweltsblutgruppe, die nichts an der Leere änderte, durch die die Polizei tappte. Eine Leere wie bei den Angehörigen der Opfer, denen mit einem Schlag ein Teil ihres Lebens genommen worden war. Und es schien nur eine Frage der Zeit, bis der Wahnsinnige wieder zuschlug. Die Boulevardblätter, vor allem aber die Nachrichtenredaktionen einiger TV-Sender, stürzten sich mit geradezu perverser Sensationsgeilheit auf die Morde und die Welt der Opfer. Glücklicherweise beschränkte sich der seriöse Journalismus auf die Meldung von Fakten – doch wie lange noch? Ein dritter Mord, womöglich gar ein vierter, und man würde den gesamten Frankfurter Polizeiapparat auseinandernehmen. Ihr lebt von unseren Steuern, also tut etwas! Wofür werdet ihr Beamtenärsche bezahlt, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid, unsere unschuldigen Töchter und Mädchen vor einer solchen Bestie zu schützen? Wofür habt ihr euch jahrelang auf unsere Kosten ausbilden lassen, wenn ihr doch nur elende Sesselfurzer seid? Berger hatte ähnliches schon einmal erlebt, als er noch neu bei der Polizei war und kurz nacheinander drei Homosexuellen die Kehle durchgeschnitten wurde. Bekam das Volk den Täter nicht vorgeworfen, wurde eben die Polizei gefressen. Doch das Volk hatte ja keine Ahnung von der Mühe, die es bereitete, Spuren zusammenzusuchen und alle noch so winzigen Puzzlestückchen zu einem vollständigen Bild zu ergänzen. Das Volk wollte Resultate sehen, alles andere interessierte nicht. Aber wie ein Phantom erwischen, das wie aus dem Nichts auftauchte, sein grausiges Geschäft verrichtete und wieder im Dunkel der Anonymität verschwand? Es war praktisch unmöglich, ein Täterprofil zu erstellen, wenn der Täter nichts am Tatort hinterließ. Er leistete solch perfekte Arbeit, daß man blonde Mädchen zwischen vierzehn und zwanzig nur eindringlich warnen konnte, sich nach Einbruch der Dämmerung nicht mehr allein auf der Straße aufzuhalten. Nur in Gruppen oder in männlicher Begleitung. Allein und dazu vielleicht noch durch eine schwach beleuchtete Wohngegend gehen, wo viele sich bei Dunkelheit in ihren Häusern verkrochen, barg im Augenblick ein tödliches Risiko. Vor einem Dreivierteljahr hatte es schon einmal zwei Morde an Frauen in Frankfurt gegeben, allerdings nicht annähernd so grausam. Man schloß zwar nicht völlig aus, daß es sich um ein und denselben Täter handelte, doch die Wahrscheinlichkeit, daß einer erst beim dritten Mal nekrophil wird, schien nach Psychologenmeinung weitgehend ausgeschlossen. Es gab ein oder zwei Übereinstimmungen, doch auch wieder klar erkennbar andere Vorgehensweisen. So hatte der Täter vor neun Monaten seinen Opfern weder Bißwunden zugefügt noch Teile der Vagina mit seinen Zähnen ausgerissen, sondern ihnen »nur« in einem Anfall von Blutrausch den Leib aufgeschlitzt. Zudem waren die damaligen Opfer rothaarig und dunkelbraun, hatten die Dreißig längst überschritten, und sie waren Huren. Nein, diesmal hatten sie es mit einem anderen Kaliber zu tun. Der Mörder vom letzten Winter lief zwar immer noch frei herum, vielleicht aber war er auch tot, auf jeden Fall war dieser Mann viel plumper vorgegangen.
Es war ein Scheißspiel, der Polizei waren die Hände gebunden, solange der Mörder nicht einen gravierenden Fehler beging. Wann aber würde er einen begehen – beim nächsten Mal, beim übernächsten oder erst in ein, zwei oder drei Jahren? Und wann war das nächste Mal? Heute schon, morgen oder übermorgen? Sicher war nur, daß irgendwo in dieser großen Stadt jemand herumlief, der blonde Mädchen auf den Tod nicht ausstehen konnte. Und unter diesen blonden Mädchen waren bestimmt noch immer sehr viele, die selbst die eindringlichsten Warnungen in den Wind schlugen, die nachts allein durch einsame Straßen liefen in der Überzeugung, ihnen würde schon nichts passieren. Und irgendeine von ihnen würde der Wahnsinnige erwischen.
Berger schaltete das Licht ein, der nasse Asphalt glänzte. Menschen eilten, nach Erledigung der letzten Einkäufe, über die Bürgersteige, eine zähe Blechlawine quälte sich von einer Ampel zur nächsten. Er öffnete das Seitenfenster einen Spalt, die Luft im Wagen war stickig, die Scheiben beschlagen. Er wünschte sich einen ruhigen Abend, nicht wie vorgestern, als man ihn nachts um halb zwei aus dem Bett geklingelt hatte.
Maureen Nettleton war gerade siebzehn und übel zugerichtet. Gefunden in einem Waldstück gleich bei der S-Bahn-Haltestelle, etwa zehn Fußminuten von zu Hause entfernt. Auf die brutalste Weise vergewaltigt, mit mehr als dreißig Stichen verstümmelt, die Augen ausgestochen, die rechte Brust abgetrennt und neben das Mädchen gelegt, das Schambein mit einem harten Gegenstand von innen zertrümmert, ein Kollege von der Spurensicherung hatte sarkastisch bemerkt, der Täter müsse einen gewaltigen Stahlschwanz haben. Bißwunden an dieser, aber auch an der anderen Brust. Bißwunden an der Zunge, an den Ohren. Bißwunden am Bauch und den unteren Genitalien, die inneren Schamlippen regelrecht abgebissen. Als ob es nicht genug der Perversion gewesen wäre, hatte der Kerl ihr die Haare auch noch zu zwei Rattenschwänzen geflochten und rote Schleifchen darum gebunden, die Arme über der Brust gefaltet, die Beine überkreuzt. Ein höchst makabres Ritual, das der Mörder schon beim ersten Mädchen zelebriert hatte. Schlimmer noch als der gräßliche Anblick der Leiche war, den Eltern den Tod ihrer Tochter mitzuteilen. Der Vater Mitte Vierzig, Deutschlanddirektor einer amerikanischen Großbank, die Mutter etwas jünger, klein und zierlich, attraktiv. Reichtum, eine prachtvolle Villa mit parkähnlicher Anlage, Pool, eine Terrasse mit Marmorboden, das gesamte Grundstück von Bäumen, Sträuchern und einer mannshohen Hecke vor neugierigen Blicken geschützt.
Es war etwas Erbärmliches, Angehörigen mitzuteilen, daß der Ehemann oder die Ehefrau oder ein Kind einem Verbrechen zum Opfer gefallen waren. Zwar hatte er während seiner mittlerweile mehr als zwanzig Jahre bei der Polizei eine Reihe psychologischer Seminare besucht und war auf solche Fälle vorbereitet, doch die Theorie war nichts als Luft, sobald man den Angehörigen gegenüberstand, in ihre fragenden, hoffenden, bangenden und schließlich verzweifelten Gesichter sah. Dann waren jede Schulung, jedes noch so intensive Seminar vergessen. Jeder Fall war anders gelagert, nicht zwei Menschen, die sich in einer solchen Situation gleich verhielten.
Maureens Mutter war zusammengebrochen, hatte geschrien, gegen die Tür und die Wand getrommelt. Zehn Minuten lang. War schluchzend auf die Knie gesunken, den Kopf zwischen den Händen vergraben. Bis der schnell gerufene Arzt ihr eine Beruhigungsspritze gab, nach der sie nur noch wimmerte. Der Arzt sagte, selbst ein Elefant würde nach dieser Dosis mindestens vierundzwanzig Stunden schlafen und hinterher weitere vierundzwanzig Stunden die Welt durch einen rosigen Schleier sehen. Doch hier erzielte die Spritze nur eine oberflächliche Wirkung. Der Vater hatte sich einer Spritze verweigert, war nur rastlos mit gesenktem Kopf in dem riesigen, mit dicken Teppichen ausgelegten Wohnzimmer von einer Ecke in die andere getigert, still mit sich und der Welt hadernd. Ein gebrochener Mann, der all seinen Besitz für das Leben seiner Tochter gegeben hätte.
Auch die vor zwei Wochen ermordete Carola Preusse stammte aus bestem Haus, ein hübsches, intelligentes, blondes Mädchen. Sie hatte nur eine Kirchenversammlung besucht, wollte spätestens um zehn zu Hause sein. Wenige hundert Meter durch die anbrechende Nacht in einer der behütetsten Gegenden laufen, als zusätzlicher Schutz die bereits eingeschaltete Straßenbeleuchtung und die um diese Zeit noch nicht menschenleeren Straßen – eine trügerische Sicherheit. Nach diesem ersten Mord ging man im Präsidium zunächst von einem Einzelfall aus und glaubte nicht, daß der Täter ein zweites Mal zuschlagen könnte.
Berger hatte vieles miterleben müssen, viele Leichen gesehen, doch die beiden letzten waren etwas ganz Besonderes, im negativen Sinn. Jung und hübsch und irgendwie unschuldig – und massakriert. Von einem Wahnsinnigen, einem Psychopathen, da war man inzwischen sicher, aber einem intelligenten Psychopathen. Vielleicht ein notorischer Hasser, dessen Leben aus nichts als tiefstem Abscheu und der Vernichtung des Objektes seines Hasses bestand. Die Gründe für Haß, so hatte Berger sich belehren lassen, waren so zahlreich wie der Sand am Meer. Mancher haßt, wie jemand läuft, das Eßbesteck hält, die Zigarette anzündet, lacht oder sich schminkt, blonde Haare, kurze Röcke, auffällige Ohrringe. Selten aber, so wurde er belehrt, schlüge Haß in derart krasse physische Gewalt um.
Auch heute war wieder einmal alles im Sand verlaufen. Ein paar klägliche Hinweise von Wichtigtuern, lediglich für den Papierkorb. Die Sorge, er könnte wieder zuschlagen. Aus heiterem Himmel, irgendwo in Frankfurt, zu irgendeiner Zeit. Wenn niemand damit rechnete.
Er gab Gas, um die Ampel noch bei Gelb passieren zu können. Dann wieder ein Stau. Vor einigen Wochen war die Verkehrsführung geändert worden, angeblich, um den Anwohnern des Viertels mehr Ruhe und weniger Abgase zu bescheren. Dabei wollten die Anwohner die Verkehrsänderung gar nicht, sie waren nicht einmal gefragt worden. Seit der Umstellung Stau über Stau, manchmal bis in den späten Abend hinein. Berger fluchte still vor sich hin. Er stellte das Radio an, laute, hämmernde, nervtötende Musik, er schaltete gleich wieder ab. Dies war nicht mehr seine Musik. Zum Zerreißen gespannte Nerven, er fühlte sich ausgehöhlt und hatte doch das Gefühl, innerlich gleich zu zerplatzen. Wie so oft, wenn er vom Friedhof kam.
Am einundzwanzigsten September jährte es sich zum zweiten Mal. Sie hatte den Kleinen vom Kindergarten abgeholt. Der übliche Heimweg über die Ausfallstraße, weil dies trotz des Umwegs Zeit sparte. Die Ampel, die sie schon Hunderte oder gar Tausende Male passiert hatte, die gerade auf Grün umsprang, der Lkw-Fahrer, der von der anderen Seite noch bei Rot über die Kreuzung donnern wollte. Mutter und Kind auf der Stelle tot, zermalmt von einem Dreißigtonner, den ein betrunkener Lkw-Fahrer steuerte. Als Strafe Führerscheinentzug für zwei Jahre, sechs Monate Gefängnis auf Bewährung. Ein junger Mann, dem man, so der Richter, mit einem übertriebenen Strafmaß nicht die Zukunft verbauen wollte. Ein junger Mann mit Frau und zwei kleinen Kindern. Von den Toten sprach kaum noch einer.
Die ersten zwei Wochen waren die Hölle – Weinen, Jammern, Nichtverstehen, Zweifeln, Hadern, Beten und doch Gott verfluchen. Warum ausgerechnet sie, und warum spielte ihm das Schicksal so mit?! Weder sie noch sein Sohn hatten je einer Menschenseele ein Leid zugefügt. Ihre Ehe war musterhaft gewesen. Und es war so verdammt ungerecht, daß sie auf diese Weise beendet wurde.
Er dachte an Selbstmord, dann an Rache. Aber er war zu feige für Selbstmord, außerdem trug er die Verantwortung für Andrea. Rache? Rache! Die Schuld des Täters durfte nicht ungesühnt bleiben. Immer und immer wieder putzte Berger seine Pistole, entsicherte sie, zielte auf einen imaginären Punkt, an dem er sich den Mörder seiner Familie vorstellte. Aber wieder war Andrea der Grund, daß er doch keine Rache übte. Sie war fünfzehn und brauchte noch einen Vater. Aber etwas in ihm war zerbrochen. Er, der so oft in seinem Leben mit dem Tod konfrontiert worden war, drohte daran kaputtzugehen. Er konnte nicht mehr lachen, selbst wenn er sich bemühte. Höchstens oberflächlich, nicht aus dem Herzen. Er war öfter, als ihm guttat, betrunken. Und bisweilen hart und ungerecht gegenüber Freunden und Kollegen. Schließlich stürzte er sich in Arbeit, um zu vergessen. Aber noch immer trank er zuviel, war oft unmäßig in seinen Eßgewohnheiten, hatte über zwanzig Kilo zugenommen.
Eine Viertelstunde nachdem er vom Friedhof weggefahren war, langte er zu Hause an. Kein Lichtschein hinter den Fenstern. Er parkte das Auto vor der Garage, stieg aus und ging ins Haus. Die Luft abgestanden, kalter, unsichtbarer Rauch. Andrea rauchte seit einem halben Jahr, er duldete es. Sie ließ sich keine Vorschriften mehr machen. Auf dem Herd ein schmutziger Topf mit dem angebrannten Rest eines Spaghetti-Fertiggerichts. Zwei Teller ungespült im Spülbecken. Krümel auf Tisch und Boden, zwei benutzte Gläser, eine leere Flasche Rotwein. Mit wem hatte sie hier gegessen und getrunken? Er zuckte nur mit den Schultern, stellte die Flasche weg und setzte sich. Den Kopf auf die Arme gestützt, schloß er für einen Moment die Augen. Er hatte Hunger, aber keinen Appetit. Nur eine Kleinigkeit essen, etwas fernsehen, ein großes Glas Cognac trinken, eine Pfeife rauchen. Und vielleicht wie so oft im Sessel einschlafen.
Auf dem Telefontisch im Flur eine kurze Notiz von Andrea. Sie war wieder einmal bei ihrer Freundin, wollte dort übernachten. Zumindest wußte er, wo sie war, er kannte diese Freundin, ein nettes, aufrichtiges Mädchen. Er glaubte auch nicht, daß Andrea in schlechte Gesellschaft geriet, sie hatte einen gesunden Menschenverstand – und einen Dickkopf. Sie würde ihren Weg machen. Noch zwei Jahre bis zum Abitur, danach Studium der Psychologie. Dann, so ihr Wunsch, zur Polizei. Wie er.
Ab morgen würde der Polizeiapparat auf Hochtouren laufen. Julia Durant, eine ihm wärmstens empfohlene Polizistin, würde ihnen während der nächsten Zeit bei der Klärung dieser bizarren Mordfälle zur Seite stehen und einen wesentlichen Teil der Ermittlungsarbeit in der auf zehn Mitarbeiter angewachsenen Sonderkommission übernehmen. Ein wenig graute Berger vor dem Moment, wenn er ihr und nicht seinem Freund und langjährigen Kollegen Schulz wesentliche Kompetenzen übertrug. Schulz würde sich einmal mehr überfahren fühlen, seine Fähigkeiten mißachtet, seinen langen Dienst für Stadt und Staat unterbewertet. Aber Berger erging sich nicht in Gefühlsduseleien. Vor einem oder zwei Jahren wäre Schulz sicher noch der richtige Mann gewesen, doch seit bekannt war, daß seine Frau sich rumtrieb, seine kleine Tochter auf der Krebsstation lag und ihn hohe Schulden plagten, war Schulz nicht mehr der Mann für heikle Fälle. Eines Tages vielleicht wieder. Jetzt brauchte er jemanden, der klar und frei im Kopf war.
Berger kannte Julia Durant nur vom Sehen, als Sitte und Mordkommission vor kurzem zur gleichen Zeit an einen Tatort gerufen worden waren. Eine hübsche und, so sein Eindruck, sehr eigenwillige Person. Doch seit sie bei der Sitte war, war die Aufklärungsquote sprunghaft nach oben geschnellt. Berger setzte große Hoffnungen in ihre Mitarbeit.
Schulz war auf dem Weg vom Präsidium nach Hause. Bahnhofsviertel. Die Nacht war nach dem Abzug der letzten Regenwolken sternenklar und angenehm kühl. Trotz der späten Stunde pulsierte das Leben weiter in dieser Stadt, die nie zur Ruhe kam. Die grellen Leuchtreklamen der Bars und Lokale blinkten einladend, Straßendirnen lungerten in dunklen Hauseingängen, traten ein oder zwei Schritte hervor, wenn einer vorbeikam, von dem sie sich eine schnelle Mark für eine schnelle, gefühllose Nummer erhofften, Geld für einen Druck Heroin, Geld für Schnaps. Zigarettenspitzen, die im Dunkel aufblitzten. Ein paar angetrunkene GIs, die laut schwätzend und lachend über den Bürgersteig schlenderten. Ein schief an der Hauswand lehnender Betrunkener, der seinen Rausch im Schmutz der Straße ausschlief. Türken, Italiener, Jugoslawen, genau war das im diffusen Licht der Straße nicht auszumachen, redeten wild gestikulierend aufeinander ein. Hütchenspieler knieten vor einer matterleuchteten Tür, umringt von zehn Männern, und spielten ihr betrügerisches Spiel – skrupellose Gauner, die immer gewannen. Erst vor drei Tagen war ein argloser Tourist in einem Hofeingang niedergestochen worden, nachdem er sich über die zweifelhaften Methoden des Spiels beschwert hatte; jetzt lag er mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in der Uniklinik. Zwei Streifenpolizisten bewegten sich gemächlich die Straße entlang, die Blicke geradeaus gerichtet, denn nachts waren auch Polizisten hier nicht frei von Angst. Eine alte Frau führte ihren Dackel spazieren. Idylle, auf den ersten Blick, doch ungemein trügerisch. Wie ein friedlich dahinplätscherndes Gewässer, das die Augen der lauernden Krokodile verbarg.
In dieser Gegend begann das Leben immer erst nachts. Wenn woanders die Menschen schliefen, kamen sie hier aus ihren Rattenlöchern gekrochen und schwärmten durch die Straßen, Huren, Freier, Loddel, Transvestiten, kriminelle Subjekte, Voyeure, die sich nur im Schutz der Nacht sicher fühlten. Kaum eine Nacht ohne Messerstecherei, wüste Schlägereien oder sogar Tote. Tote, oft kaum gekannt, von irgendwoher gekommen und hier zur Hölle gefahren, weil sie die Spielregeln in diesem Viertel nicht beachtet hatten. Tote, deren Namen keine Zeitung druckte, die von keiner Polizei registriert wurden, die in keiner Statistik auftauchten. Tote, die mit Beton an den Füßen im Main versenkt wurden. Tote, die scheinbar nie existiert hatten.
Unzählige Huren boten ihre Körper feil, auf Drehbühnen räkelten sich nackte Körper zu ekstatischer Musik, gaffende Männer und auch ein paar Frauen, die beim Hinsehen ihr Blut in Wallung brachten. Der Geruch von Döner durchzog die Luft. Autos, die dicht an dicht vor den zahlreichen Nachtbars parkten. Große, breite, bullige, furchteinflößende Rausschmeißer, die wie Zyklopen die Türeingänge bewachten und gleichzeitig schmeichlerisch zum Eintreten aufforderten. Frauen, grell geschminkt, trotz der Kühle nur mit enganliegenden Shirts, superkurzen Röcken und Netzstrümpfen bekleidet. Eindeutige Bilder in den hellerleuchteten Auslagen, flackernde Lampen. Edelhuren, die in sündhaft teuren Wagen gemächliche Runden drehten, auf der Suche nach Freiern, für die Geld keine Rolle spielte. Und unzählige, roterleuchtete Fenster. Er fuhr langsam, dieses Viertel übte einen besonderen Reiz auf ihn aus, auch wenn er um diese Zeit nicht aussteigen würde. Ihm reichte das Sehen aus der Sicherheit seines Wagens. Er fuhr sie alle ab, Weserstraße, Taunusstraße, Elbestraße, Moselstraße und zuletzt die Kaiserstraße, einst eine Prachtstraße, mittlerweile haftete ihr ein zweifelhafter Ruf an, und jeder Versuch, ihr den Glanz der Vergangenheit wieder einzuhauchen, war bis jetzt gescheitert. Erst weiter unten, an der Gallusanlage, wurde ihr Antlitz ansehnlicher.
Nachdem er seine kurze, nächtliche Rundfahrt beendet hatte, gab er Gas, passierte die nach einem Brand im Wiederaufbau befindliche Oper, überquerte die restaurierte Untermainbrücke und kam in die Schweizer Straße. Auch dort noch viele Menschen, die die Nacht zum Tag machten, wobei es hier ungleich friedlicher zuging als auf der andern Mainseite. Die Ampel sprang auf Rot, er stoppte. Das Mädchen fiel ihm sofort auf. Sie war mittelgroß, mit langem, blondem Haar und jenem unschuldig-lasziven Gang, den nur Mädchen in einem bestimmten Alter haben. Nicht künstlich angeeignet, sondern natürlich. Die Herausforderung nur unbewußt, das Provozieren nicht mit Absicht. Ihre Bewegungen katzenhaft, sie blieb einen Moment stehen, strich sich mit einer Hand durchs Haar, warf kurz den Kopf zurück, ließ ihren Blick in die Runde schweifen, bevor sie ihren Weg fortsetzte, in Turnschuhen, Jeans und enganliegendem, weißem T-Shirt. Selbst im schwachen Licht der Straßenlaternen erkannte er die sich in der kühlen Nachtluft deutlich unter dem Shirt abzeichnenden eregierten Brustwarzen. Ein anderes Mädchen tauchte scheinbar aus dem Nichts auf, legte einen Arm um die Schulter der Freundin, gemeinsam beschleunigten sie ihre Schritte, bis sie hinter einer Tür wie in einem schwarzen Schlund versanken. Beide mußten etwa in dem Alter wie die zwei ermordeten Mädchen sein. Er stellte sich vor, der Killer wartete in diesem schwarzen Schlund auf seine Opfer.
Er beobachtete gerne junge Mädchen und Frauen, für ihn hätte die Welt aus nichts als jungen Mädchen zu bestehen brauchen. Er wünschte sich in solchen Augenblicken, jünger zu sein, noch einmal von vorne beginnen zu können. Was erwartete ihn, wenn er nach Hause kam? Vielleicht war sie zu Hause, wahrscheinlich aber nicht. Sicher war sie wieder ausgeflogen, ein ruheloser Vogel, um sich ihre Befriedigung einmal mehr woanders zu holen. Der Gedanke schmerzte ihn, er liebte sie beinahe hündisch, verstand nicht, weshalb sie ihn ein ums andere Mal so tief verletzte. Zwölf Jahre waren sie jetzt verheiratet, und jeden Tag quälte sie ihn etwas mehr, als wollte sie ausprobieren, wie lange er dem Martyrium standhielt. Immer häufiger verließ sie das Haus, nachdem sie Julian fürs Bett fertig gemacht hatte, aufgetakelt für die Nacht, für Abenteuer, die sie in fremden Betten suchte und meist auch fand. Er versuchte, nicht darüber nachzudenken, mit wie vielen Männern sie schon geschlafen haben könnte, aber es mußten inzwischen Hunderte sein. Vielleicht war sogar schon einer darunter, der sie infiziert hatte. Denn er konnte sich vorstellen, daß sie fast alles mit sich machen ließ. Nur schlagen ließ sie sich nicht, obgleich sie schon zweimal mit verquollenem und zerschlagenem Gesicht von einem ihrer nächtlichen Streifzüge heimgekehrt war. Wie eine Katze nach einem wilden Revierkampf. Doch auch das hinderte sie nicht, es immer wieder zu probieren, ihn zu demütigen – wofür, das wußte er nicht. Angeblich befriedigte er ihre sexuellen Bedürfnisse nicht, doch das allein konnte es unmöglich sein. Sie war eine Hure, auch wenn sie ihren Körper nicht verkaufte, wenn sie kein Geld für ihre Liebesdienste nahm. Sie war unersättlich geworden, und Schulz wußte längst, daß sie krank war. Nur deshalb hörte er nicht auf, sie zu lieben, nahm er jede noch so große Demütigung in Kauf. Eine kranke Frau zu verlassen war nicht sein Stil, und da waren ja auch noch die beiden Kinder.
Es begann vor drei Jahren, als sie innerhalb von vierzehn Monaten zwei Fehlgeburten hatte, davon einmal Zwillinge. Was immer damals mit ihr geschehen war, sie fing an, sich rumzutreiben, anfangs nur sporadisch, einmal im Monat vielleicht, doch jetzt, wo Sabrina im Krankenhaus lag und ihr Tod nur eine Frage der Zeit war, verschwand sie beinahe jede Nacht.
Lange würde er es nicht mehr aushalten. Irgendwann würden auch seine Kräfte aufgebraucht sein, sein Reservoir erschöpft, irgendwann war er nicht mehr fähig, ihre Eskapaden zu ertragen. Es gab Tage, da hätte er sie umbringen können, wenn sie wie ein billiges Straßenmädchen heimkehrte, beschwipst vom Alkohol, durchgefickt von irgendeinem geilen Schwanz – und scheinbar glücklich.
Er hoffte, sie schlafend vorzufinden, gehüllt in nichts als ein unscheinbares Baumwollnachthemd, das Gesicht von einer dicken Schicht fettiger Nachtcreme bedeckt, vielleicht sogar Wickler in den Haaren. Dann wüßte er, sie gehörte nur ihm.
Eine halbe Stunde nach Mitternacht war er zu Hause. Schaltete das Licht aus, dann den Motor. Öffnete leise die Tür, versuchte, sie genauso leise auch wieder zu schließen. Das lauteste Geräusch war das Einrasten des Türschlosses beim Drehen des Schlüssels.
Im Haus der kalte Geruch von Gebratenem. Er streifte die Schuhe in der engen Diele ab, hängte seine Jacke an die Garderobe. Schlich auf Zehenspitzen die Treppe hinauf, wenn sie schlief, wollte er sie nicht wecken, die Schlafzimmertür stand einen Spalt offen, der schwere Duft ihres Parfüms hing noch in der Luft. Ihr Bett war unberührt. Er warf einen Blick ins Kinderzimmer, Julian schlief. So geräuschlos er nach oben gegangen war, so leise begab er sich wieder hinunter, betrat die Küche und schloß die Tür hinter sich. Das für ihn bestimmte Schnitzel lag in der Bratpfanne, eine Glashaube darüber, zwei Butterbrote, eine aufgeschnittene Tomate, ein paar Gurkenscheiben unter Klarsichtfolie. Eine Flasche Bier im Kühlschrank. Bis vor kurzem hatte sie ihm wenigstens noch einen Zettel geschrieben. Er aß langsam, ließ den Tag Revue passieren, verscheuchte die Gedanken an sie.
Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da war er rast- und ziellos durch die Stadt gefahren in der Hoffnung, sie irgendwo aufzugabeln, wie eine läufige Hündin, die nicht mehr nach Hause fand. Er hatte sie nicht ein einziges Mal gefunden.
Und jetzt, nach vierzehn Stunden Knochenmühle, war er wieder einmal allein. Nichts in seinem elenden Leben stimmte. Er ließ das Brot sinken, weinte. Ließ den Teller stehen, nahm die Flasche Bier, trank sie in einem Zug leer, schenkte sich im Wohnzimmer noch ein großes Glas Jack Daniels ein, der in seinem Magen brannte.
Um ein Uhr ging er ins Bad, entleerte seine Blase, wusch Gesicht und Hände, putzte sich die Zähne. Tiefe Ringe unter den Augen, die vielen Überstunden der vergangenen zwei Wochen hatten Spuren hinterlassen. In ihm vibrierte es, wie immer, wenn sein Körper zur Ruhe kam. Sechs, maximal sieben Stunden Schlaf.
Die Schlafzimmertür knarrte beim Aufmachen. Er schaltete die kleine Nachttischlampe mit der 12-Watt-Birne neben seinem Bett an, die gerade genug Licht spendete, damit er nicht an den Schrank oder das Bett stieß. Zog sich aus, legte seine Sachen fein säuberlich zusammengelegt auf den Stuhl. Die Matratze ächzte, als er sich hinsetzte. Er legte sich auf den Rücken, die Hände über der Brust gefaltet, und starrte an die Decke. Wünschte sich, die Haustür würde aufgehen und sie hereinkommen und er ihr ansehen können, daß in dieser Nacht nichts geschehen war. Sie kam nicht.
Freitag, 17. September, 8.30 Uhr
Er fühlte sich miserabel. Gerädert, wie nach einer durchzechten Nacht. Schulz duschte abwechselnd kalt und warm; allmählich kehrte das Leben in seinen Körper zurück. Er trocknete sich ab, durch die geschlossene Badezimmertür hörte er Joanna in der Küche hantieren. Er rasierte sich naß, ein kleiner Pickel am Kinn brach auf, winzige Blutstropfen rollten aus der kaum sichtbaren Wunde. Er riß ein kleines Stück Toilettenpapier ab, klebte es auf die Wunde und wartete einen Moment, bis die Blutung zum Stillstand kam. Dann kleidete er sich an, kämmte sich, sprühte etwas Eau de Toilette auf sein Gesicht, leichtes Brennen auf der Haut.
Sie stand mit dem Rücken zu ihm an der Arbeitsplatte neben der Spüle. Er murmelte ein »Guten Morgen«, setzte sich an den Tisch. In einem Korb einige Scheiben geschnittenes Brot, frische Brötchen (Schulz überlegte, ob sie sie in der Nacht frisch vom Bäcker mitgebracht hatte – hatte sie es diesmal vielleicht mit einem Bäcker getrieben?!), daneben zwei Sorten Marmelade, Sirup und Nußcreme. Sie drehte sich zu ihm um und strahlte ihn an, erwiderte seinen Gruß, kam auf ihn zu, küßte ihn flüchtig auf die Wange. Er erwiderte den Kuß nicht, schwieg. Er fragte sich immer wieder verwundert, wie sie nach einer solchen Nacht so fit sein und so frisch aussehen konnte. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, er beobachtete sie lange und nachdenklich.
»Warum?« fragte er zum hundertsten oder tausendsten Mal.
»Warum was?« fragte sie naiv zurück und packte Schulbrot ein.
»Warum um alles in der Welt tust du das?«
»Warum tue ich was?«
»Du weißt genau, wovon ich rede!« Seine Stimme war eine Spur lauter und schärfer geworden.
»Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Für Rätsel ist es einfach noch zu früh.«
»Oh, mein Gott, tu doch um Himmels willen nicht so verdammt unschuldig! Wo warst du heute nacht? Du bist inzwischen schon fast jeden zweiten Abend weg! Wie soll das weitergehen?«
Sie drehte sich um, blickte ihn unschuldig an. »Ich war ein bißchen aus, na und? Mir fällt eben momentan die Decke auf den Kopf!«
»Dir fällt also momentan die Decke auf den Kopf! Dieses Momentan ist bei dir ja ein ganz schön dehnbarer Begriff!« höhnte er. »Was meinst du wohl, was mir alles auf den Kopf fällt?!« Er atmete hastig, sein Gesicht war rot angelaufen, er spürte sein Herz bis in die Schläfen pulsieren.
»Habt ihr wenigstens ein Kondom benutzt?« fragte er beißend.
»Mußt du gleich weg?« fragte sie ausweichend, drehte ihm wieder den Rücken zu.
»Oh, natürlich, darauf bekomme ich ja nie eine Antwort von dir! Habt ihr oder habt ihr nicht?«
»Ja, ja, ja, verdammt noch mal, wir haben! Zufrieden?« Sie schloß die Augen, atmete hastig, krallte ihre Finger um die Arbeitsplatte, legte den Kopf in den Nacken. »Es tut mir leid, wirklich, es tut mir leid!«
»Wie oft du schon gesagt hast, daß es dir leid tut! Von leid tun allein ändert sich aber nichts. Ich bin am Ende meiner Kräfte! Und im Präsidium zerreißen sie sich die Mäuler!«
»Präsidium, Präsidium! Du denkst immer nur an dein Scheißpräsidium! Und was ist mit mir? Wann sehe ich dich denn einmal? Und wenn ich dich sehe, bist du müde. Wie lange ist es her, daß wir etwas gemeinsam unternommen haben?«
»Ich ernähre die Familie, und ich treibe mich nicht rum! Hast du Grund, dich zu beklagen? Außerdem, was sollte ich denn sonst tun? Ich bin Polizist, und das werde ich auch bleiben.« Er stand auf, ging zu ihr – versöhnlicher Blick, er legte seine Hand auf ihre. »Ich habe nie große Anforderungen an das Leben gestellt, ich habe auch nie viel für mich gewünscht, aber ich wünsche mir jetzt, daß wir wieder zusammenfinden. Aber du mußt deinen Teil dazu beitragen. Nur zusammen können wir es schaffen.«
»Ich weiß nicht, was mit mir los ist«, sagte sie und blickte zu Boden. »Ich weiß es wirklich nicht. Es tut alles einfach nur weh. Ich sage mir jeden Tag aufs neue, daß ich es nicht mehr tun will …«
»Dann tu’s doch auch nicht …«
»Das sagst du so einfach. Was soll ich bloß machen?«
»Du mußt dir helfen lassen, und zwar von kompetenten Leuten. Es ist eine Krankheit wie Alkoholismus oder Drogensucht. Nur ein geschulter Therapeut kann dir helfen. Aber es kann und darf so nicht weitergehen!« sagte er, stieß die Luft hörbar aus und nahm sie in den Arm. Sie fühlte sich an wie ein hilfloses kleines Kind. Seine Stimme wurde sanfter. »Bitte tu’s, wenn nicht für dich, dann für mich!«
»Kennst du denn jemanden?« fragte sie tonlos. Sie war Mitte Dreißig, sah aber immer noch wie ein junges Mädchen aus, wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb sie so leicht woanders fand, wonach sie suchte.
»Es dürfte wirklich nicht allzu schwer sein, einen guten Therapeuten aufzutreiben. Wenn du möchtest, kümmere ich mich darum.«
Sie löste sich aus seiner Umarmung und fuhr fort, das Frühstück für Julian zu bereiten.
»Wollen wir heute Abend essen gehen?« fragte er, während er sich wieder setzte. »Ich kenne da ein nettes Lokal in einer Seitenstraße gleich bei der Alten Oper. Sie machen eine phantastische Paella.«
»Paella? Und es ist sicher, daß wir gehen? Ich meine, kein dringender Fall, der dich erst um Mitternacht nach Hause bringt?«
»Das kann ich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich hoffe natürlich nicht.«
»Dann werde ich um halb acht fertig sein. Ich frage Annette, ob sie bei Julian bleibt. Ich werde heute nachmittag wieder in der Klinik sein. Der Arzt will mit mir sprechen …«
»Ich werde versuchen, heute nachmittag auch dazusein. Ich würde mich gerne viel öfter um sie kümmern.«
»Dann tu’s doch! Es ist sehr schade, daß du so wenig Zeit für Sabrina hast. Wie soll sie verstehen, daß du so selten bei ihr bist?«
»Tut mir leid, aber ich muß jetzt los. Wir haben noch immer keine heiße Spur im Fall der beiden Mädchen.«
»Ja, ja, schon gut! Und – ich freue mich auf heute abend.«
»Ich mich auch.« Er stand auf, fuhr sich mit der Serviette über den Mund, hauchte Joanna einen kaum merklichen Kuß auf die Wange.
Er würde Sabrina heute besuchen, ganz gleich, ob es Berger recht war oder nicht. Er mußte jetzt jede freie Minute für sie aufbringen, wer weiß, wie lange es noch möglich war. Diese verfluchte Krankheit! Angefangen hatte es mit leichtem Unwohlsein und Fieber, sie war immer blasser geworden, wollte nur noch schlafen und konnte es doch nicht, und als sich nach drei Wochen der Zustand, den man zunächst für einen Virusinfekt gehalten hatte, nicht besserte, war vom Arzt eine Blutuntersuchung veranlaßt worden. Das Ergebnis war niederschmetternd, der Arzt hatte gesagt, daß Sabrinas Leukämie eine besonders heimtückische Form sei, eine, die rasend schnell in anderen Organen Metastasen bildete. Die Chemotherapie hatte ihr die Haare geraubt, den kleinen Körper ausgezehrt, weil sie jedesmal danach kein Essen mehr bei sich behalten konnte, nur ihren Willen, den besaß Sabrina noch. Die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten, wäre eine Knochenmarktransplantation gewesen, eine höchst kostspielige Angelegenheit. Aber es gab ja noch nicht einmal einen geeigneten Spender, zudem mußte die Operation in England durchgeführt werden und kostete über hunderttausend Mark. Und dieses Geld besaß Schulz nicht.
Schulz stieg in seinen Renault, startete den Motor und sah zu Joanna, die hinter der Fensterscheibe stand und ihm zuwinkte. Er winkte zurück. Legte eine Kassette ein – Metallica, laut, hart, Ablenkung.
Der Verkehr an diesem Morgen war mäßig stark, er kam gut voran. Kein Sonnenschein wie angekündigt, bedeckter Himmel und drückende Schwüle, die sich wie eine riesige Glocke über die Stadt spannte und die Auspuffgase nur wenig über den Boden aufsteigen ließ. Er kam durch das um diese Zeit verwaiste Bahnhofsviertel. Nur ein paar Geschäftsleute, die die Gitter vor den Türen ihrer Läden hochschoben, Pelzhändler, die fahrbare Ständer über die Bürgersteige rollten, eine Nachtbar, die schon wieder geöffnet hatte. Erbrochenes am Straßenrand. Schulz stand an der Ampel und wandte schnell seinen Blick ab, er konnte alles sehen, Blut, schrecklich zugerichtete Leichen, aber kein Erbrochenes. Um kurz nach neun stellte er sein Fahrzeug auf dem Hof des Präsidiums ab. Stieg aus, schlug die Wagentür zu, ging in das große, alte Gebäude.
Berger saß hinter seinem Schreibtisch, eine aufgeschlagene Akte vor sich, und während er darin blätterte, telefonierte er. Er schaute mit ernstem Blick auf den eintretenden Schulz. Ein junger Mann, etwa Mitte Zwanzig, saß rechts von Berger am Computer. Schwarze Augen hinter einer dunklen Hornbrille, das Gesicht von Pickeln übersät, mit zuviel Gel beschmierte, schwarze Haare. Schulz sah ihn zum ersten Mal. Er war ihm auf den ersten Blick unsympathisch.
Auf der anderen Seite des Tisches stand eine etwa dreißigjährige Frau. Knapp einssiebzig, kurze, dunkle Haare, große, ebenso dunkle Augen, äußerst feinporige, leicht gebräunte Haut, ein südländischer Typ. Volle, dezent geschminkte Lippen, feine Grübchen neben dem Mund, eine attraktive Frau. Sie trug Jeans und eine weitgeschnittene, pinkfarbene Bluse, deren beide oberste Knöpfe offenstanden. Trotz der lockeren Bluse wurde die beachtliche Oberweite nicht gänzlich verdeckt.
Kaum hatte Schulz die Tür geschlossen, legte Berger den Telefonhörer auf.
»Ein Mädchen wird vermißt«, sagte er ohne weitere Begrüßung und lehnte sich zurück. Verschränkte die Arme hinterm Kopf, seufzte auf.
»Schon wieder?« Schulz ließ sich auf den Stuhl fallen, seine eben noch gute Laune war dahin. Er warf erst einen kurzen Blick auf den jungen Mann, dann einen etwas längeren auf die Frau.
»Seit gestern abend. Aber die Eltern haben es erst heute morgen gemerkt. Ich habe eben noch mal mit ihnen telefoniert. Ihr müßt gleich hinfahren.«
»Laß mich raten«, sagte Schulz. »Ungefähr sechzehn, blond?«
»Siebzehn. Ich habe bereits die Fahndungsmeldung rausgegeben. Ach übrigens, wie ich gestern schon andeutete, haben wir Verstärkung bekommen. Das ist Janusz Koslowski, direkt von der Polizeischule. Er wird mich vorerst hier im Büro unterstützen. Und das ist Hauptkommissarin Julia Durant, die im wesentlichen für die Ermittlungsarbeit zuständig ist.« Er stoppte für ein, zwei Sekunden, zog die Stirn in Falten und beobachtete die Reaktion von Schulz, dessen Miene schlagartig versteinerte. Berger senkte den Blick und sagte: »Sie war bis jetzt bei der Sitte. Staatsanwalt Köhler hat sie uns als Verstärkung geschickt. Ihr beide werdet zusammenarbeiten. Außerdem sind uns auf meine Bitte hin noch sechs weitere Beamte zugeteilt worden. Das wär’s soweit, ich würde sagen, ihr macht euch jetzt am besten auf den Weg zu den Eltern.«
Schulz erhob sich gleich wieder und reichte erst Koslowski, dann Julia Durant mit süß-saurer Miene die Hand. Er war enttäuscht, versuchte dies aber zu verbergen. Warum hatte Berger, mit dem er jetzt schon so lange zusammenarbeitete, nicht ihm die Ermittlungsarbeit übertragen? Warum, zum Teufel, eine Frau und dazu noch eine Fremde? Wie er Berger kannte, hielt der ihn wegen seines verkorksten Privatlebens für nicht in der Lage … Natürlich, das war der Grund … aber was, zum Teufel, konnte er schon dafür? Irgendwann würde er Berger für diesen Verrat an ihrer Freundschaft (Freundschaft, Freundschaft, verfluchte Freundschaft!!) zur Rede stellen und ihn zwingen zu sagen, warum er ihm diesen Giftpfeil in die Brust gejagt hatte!
Er und Julia Durant verließen das Büro, im Hinausgehen warf er Berger einen verächtlichen Blick zu. Schulz ließ die Tür hinter sich ins Schloß fallen, es dröhnte hohl durch den langen Gang. Ihre Schritte hallten von den Wänden wider. »Was glauben Sie, was für ein Typ der Täter ist? Allem Anschein nach sind Sie ja ein As auf diesem Gebiet«, sagte er bissig. »Sonst hätte Berger Sie doch sicherlich nicht geholt, oder?«
Julia Durant ignorierte Schulz’ Sarkasmus. Sie hatte für weinerliche Männer nur wenig übrig, schon gar nicht für solche, die Niederlagen nicht ertrugen. Sie gab sich aber nicht die Blöße, ihre Abneigung zu zeigen, und antwortete ganz ruhig: »Keine Ahnung. Die Art und Weise, wie er mit den Leichen umgeht – ich muß zugeben, so was habe ich bisher nur in Büchern gelesen. Ich habe bis jetzt keine Vorstellung, was für ein Typ der Täter sein könnte. Aber wir werden ihn finden.«
»Sie sind ziemlich selbstsicher. Wann wir ihn finden, ist doch die Frage. Er hat bis jetzt wie ein Phantom gearbeitet. Keine Spuren, nichts.«
»Er wird Spuren hinterlassen, jeder hinterläßt bei Sexualverbrechen Spuren. Wahrscheinlich sind sie nur übersehen worden.«
»Berger und ich haben nichts übersehen! Wie lange machen Sie den Job überhaupt schon?«
»Sieben Jahre, davon habe ich sechs in München gearbeitet. Bin erst seit einem Jahr in Frankfurt. Aber Frankfurt ist schlimmer als München. Ein verdammt hartes Pflaster.«
»Das wußten Sie doch, bevor Sie herkamen!«
»Man hatte mich gewarnt. Ich werde damit klarkommen.« Sie stiegen in den Opel, Schulz setzte sich ans Steuer. Der Verkehr war dichter geworden, sie benötigten etwa zwanzig Minuten, bis sie vor dem Haus parkten, in dem die Eltern des vermißten Mädchens wohnten. Ein Haus aus den zwanziger Jahren, mit rußiger Fassade, drei Stockwerke, Arbeitergegend.
Kommen Sie rein«, sagte der Mann mit sonorer, kratziger Stimme. Julia Durant schätzte ihn auf Mitte bis Ende Vierzig, obwohl er durch die vielen tiefen Falten und die grobporige, sonnengegerbte Haut älter wirkte. Er war unrasiert, rote Augen, von billigem Korn schnapsgeschwängerter Atem, Raucherhusten. Derbe, von harter Arbeit gezeichnete, rissige Hände mit gespaltenen, ungepflegten Fingernägeln, dunkle Bartstoppeln, er trug ein blauschwarz kariertes Flanellhemd und eine schwarze Manchesterhose. Die Frau, ein in der Couch zusammengesunkenes Häufchen Elend, blickte mit leeren, rotumränderten Augen auf die Eintretenden. Sie trug eine Schwesterntracht, darüber eine dunkelblaue, dünne Wolljacke. Sie hatte die Knie geschlossen, die Hände gefaltet. Angst, Verzweiflung, vielleicht eine böse Ahnung.
»Bitte, setzen Sie sich«, sagte der Mann und wies auf zwei Stühle. Die Wohnung war kein Palast, nur eine der vielen typischen Arbeiterwohnungen in dieser Gegend, die Möbel noch von den Eltern übernommen, der Schrank Gelsenkirchener Barock, der Teppich längere Zeit nicht gesaugt und abgetreten, verblichen wie die Tapeten, ein paar alte Spinnweben bewegten sich leicht in den Zimmerecken und über der Lampe. Der abgestandene, unangenehme Geruch kalten, gebratenen Essens hatte sich festgesetzt. Aus einem auf dem Geschirrschrank stehenden Käfig piepste zaghaft ein Kanarienvogel.
»Lassen Sie uns bitte gleich zur Sache kommen, Herr Lindner«, sagte die Kommissarin, nahm Block und Stift aus ihrer Sommerjacke. »Seit wann genau vermissen Sie Ihre Tochter?«
»Wir hatten beide Nachtschicht«, erzählte der Mann stockend, »ich arbeite bei den Farbwerken und meine Frau im Altersheim. Und als wir heute morgen nach Hause gekommen sind, war Sabines Bett leer.«
»Ist so etwas schon öfter vorgekommen?«
»Einmal, da hat sie bei ihrer Freundin übernachtet. Aber diesmal ist sie nicht dort. Außerdem sagt sie sonst immer Bescheid, wenn sie auswärts übernachtet.«
»Hat Ihre Tochter einen Freund?«
»Nein!« war die schnelle Antwort.
»Wissen Sie das ganz genau, oder vermuten Sie es nur?«
»Martha, hat Sabine einen Freund?«
Kopfschütteln, Schweigen. Als fürchtete sie, mit jedem Wort, das sie sprach, einen Schritt näher an eine grausame, für sie nicht greifbare Wahrheit zu stoßen. Eine Wahrheit wie ein wabernder Nebel, durch den sie orientierungslos und hilflos taumelte.
»Aber hundertprozentig sicher sind Sie nicht?« hakte Julia Durant nach.
»Wann kann man bei jungen Leuten schon hundertprozentig sicher sein?! Aber sie hätte es uns gesagt«, beharrte Lindner, die Möglichkeit ausschließend, seine Tochter könnte Geheimnisse haben. »Sie ist ein anständiges Mädchen, müssen Sie wissen. Sie geht schließlich aufs Gymnasium. Sagen Sie, glauben Sie, daß ihr etwas passiert ist? Ich meine, da draußen läuft doch so ein Verrückter rum und massakriert …« Seine Augen weiteten sich schon bei dem Gedanken vor Entsetzen.
Schulz versuchte, Lindner zu beruhigen. »Denken Sie nicht gleich das Schlimmste. Manchmal klärt sich eine solche Sache ganz einfach auf. Ein Kollege von mir hat auch eine Tochter in diesem Alter, und er hat schon die absonderlichsten Dinge erlebt.«
»Nein, nein, ich kenne meine Kleine«, wehrte Lindner ab.
»Es ist nicht ihre Art, einfach wegzubleiben. Wissen Sie, zwischen Sabine und uns gibt es keine Geheimnisse. Sie hat uns bis jetzt immer alles gesagt, wirklich alles. Auch wenn sie einen Freund hätte. Sie hat uns noch nie Kummer bereitet.«
»Gibt es irgendeinen Ort, an dem sie sich besonders gerne aufhält?«
»Hier, in ihrem Zimmer, oder bei Nicole, ihrer Freundin. Sie gehen zusammen zur Schule. Sie war gestern Abend bei Nicole. Um halb neun wollte Sabine mit dem Bus nach Hause fahren. Es sind nur drei Stationen.«
»Hat Nicole sie in den Bus einsteigen sehen?«
»Weiß ich nicht, ich habe sie nicht gefragt.«
»Wir werden uns mit dieser Nicole gleich mal unterhalten. Wir haben bereits eine Suchmeldung rausgegeben. Wenn Sie uns jetzt bitte die Adresse von Nicole geben würden.«
Lindner schrieb mit ungelenker Schrift Namen und Adresse auf und reichte sie Schulz. Er bedankte sich und wollte gerade zusammen mit Julia Durant die Wohnung verlassen, als diese in der Tür stehenblieb, sich umdrehte und sagte: »Ach ja, beinahe hätten wir’s vergessen, wir bräuchten noch ein Bild Ihrer Tochter und wenn möglich auch ein Kleidungsstück von ihr. Am besten etwas, das sie getragen hat und noch nicht gewaschen wurde.«
»Warum?« fragte der Mann verwundert.
»Wenn Sie es haben, dann geben Sie es uns bitte«, ließ Durant die Frage unbeantwortet.
Die Frau stand auf, schlurfte in das Zimmer ihrer Tochter, während Lindner aus dem Wohnzimmerschrank einen Schuhkarton holte, in dem er die Fotos aufbewahrte. Er reichte eines davon der Kommissarin.
»Ist das ein neueres Foto?« fragte sie und schaute auf das bildhübsche Gesicht, die vollen, sinnlichen Lippen, die grünen Katzenaugen, das blonde Haar.
»Es ist in den Sommerferien gemacht worden.«
»Danke.«
Die Mutter kam mit einem Pyjamaoberteil zurück und gab es der Kommissarin. »Was glauben Sie«, fragte sie leise und sah Durant in die Augen, »glauben Sie, daß Sabine etwas passiert ist?«
Durant versuchte zu lächeln. »Im Augenblick glaube ich gar nichts. Es gibt so viele Möglichkeiten, nur bitte, machen Sie sich jetzt nicht zu viele Sorgen.«
Erst im Wagen sagte Schulz: »Es würde einfach irgendwie passen. Das Mädchen, das Alter, das Aussehen. Ich hoffe, ich täusche mich, aber wenn es stimmt, was ihr Vater sagt, dann …«
»Das ist wahr, im Augenblick müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Es ist ein schmutziges Spiel. Vielleicht kann uns ja diese Nicole weiterhelfen! Wie heißt die Straße noch mal?«
»Nobelring. Ist am Lerchesberg. Feinste Gegend. Dort wohnt der Geldadel von Frankfurt. Jetzt frag ich mich nur, wie kommt ein Mädchen wie Sabine Lindner zu einer Freundin in dieser Gegend?«
»Wir werden es sicher gleich wissen«, sagte Durant und zündete sich eine Zigarette an. »Aber hier, schauen Sie sich das Foto an, vielleicht beantwortet das Ihre Frage.«
Das Haus, in dem Nicole Bernhardt mit ihren Eltern wohnte, lag vor neugierigen Blicken geschützt hinter mannshohen Hecken und noch höheren Zäunen und ausladenden Bäumen versteckt auf einem riesigen Grundstück.
Nicole war zu Hause. Julia Durant schätzte sie auf etwa einsfünfundsiebzig, sie hatte seidig glänzendes, bis weit über die Schultern fallendes, dunkelblondes Haar und ein feingeschnittenes Gesicht mit etwas schräggestellten, blauen Augen und einem feingeschwungenen Mund.
Wahrscheinlich würde sie keine Auskunft über den Verbleib von Sabine Lindner geben können. Freunde und Bekannte der anderen Opfer hatten auch nie etwas gewußt. Nicole bat die Beamten ins Haus, das Dienstmädchen, das die Tür geöffnet hatte, verzog sich diskret in einen anderen Raum. Eine gepflegte Frau von etwa Ende Dreißig saß auf einem weißen Ledersofa, die Beine hochgeschlagen, und las. Sie sah auf, als Schulz und Julia Durant eintraten, legte das Buch zur Seite und erhob sich – fragender Blick in einem neugierigen Gesicht. Sie trug lediglich einen bis zum Knie reichenden marinefarbenen Seidenhausmantel, der vorn tief ausgeschnitten war und den Ansatz ihrer vollen Brüste erkennen ließ. Sie war ebenfalls blond, doch obwohl fast faltenlos, hatte ihr Gesicht einen verlebten, leicht gewöhnlichen Ausdruck. Dunkle, von Make-up nur unvollständig kaschierte Ringe lagen unter ihren Augen, ihr rechter Mundwinkel zuckte ein paarmal nervös. Sie war barfuß, die Zehennägel wie die Finger dunkelrot lackiert, sie hatte makellos schöne Beine mit schlanken Fesseln.
Gediegene, geschmackvolle Einrichtung. Dunkelblaue, dichtgewebte Orientteppiche, eine weiße Ledergarnitur, zwei kobaltblaue Bodenvasen, ein Chippendale-Sekretär, eine maßgefertigte Bücherwand, ein gewaltiger Breitbildfernsehapparat. Frau Bernhardt kam mit geschmeidigen Bewegungen auf die Beamten zu, blieb einen Meter vor ihnen stehen.
»Guten Tag«, sagte sie mit rauchiger, erotischer Stimme und musterte Schulz mit leicht spöttischem Lächeln. »Was führt Sie zu uns?«
»Wir sind von der Mordkommission Frankfurt und hätten ein paar Fragen an Ihre Tochter. Sie können natürlich gerne bleiben, sofern es Ihrer Tochter nichts ausmacht. Vielleicht können ja auch Sie uns bei der einen oder anderen Frage weiterhelfen. Es geht, wie Sie sicher schon wissen, um Sabine Lindner. Sie wird seit gestern Abend vermißt, und ihre Eltern machen sich große Sorgen um sie.«
»Bitte«, sagte Frau Bernhardt und deutete auf die Ledergarnitur. »Ja, Sabine, es ist seltsam, daß sie nicht zu Hause ist. Man kann nur hoffen …« Sie schüttelte den Kopf und sah Julia Durant an, die sich gesetzt hatte, während Schulz stehengeblieben war. »Es ist schon sehr seltsam. Sabine ist ein zuverlässiges Mädchen.«
Sie stellte sich an die offene Terrassentür, die den Blick auf den herzförmigen Swimmingpool freigab. Nicole setzte sich in einen Sessel, die Hände gefaltet.
»Von Herrn Lindner wissen wir, daß Sabine gestern Abend bei Ihnen war. Ist das richtig?«
»Ja, von halb fünf bis gegen acht, kann auch Viertel nach acht gewesen sein.«
»Sie sind eng befreundet?«
»Sie ist meine beste Freundin. Wir sind fast jeden Tag zusammen. Glauben Sie, daß ihr etwas zugestoßen ist? Wenn man hört, was so in den letzten Tagen …«
»Im Augenblick glauben wir gar nichts. Es verschwinden jeden Tag viele Menschen, und die meisten von ihnen tauchen kurze Zeit später wieder auf. Noch wollen wir nicht das Schlimmste annehmen. Aber sagen Sie, zu wem hat Sabine noch Kontakt?« fragte die Kommissarin weiter.
»Ich verstehe nicht ganz …«
»Nun, Sie werden nicht der einzige Mensch sein, mit dem Sabine ihre Zeit verbringt. Gibt es vielleicht einen Jungen, von dem ihre Eltern nichts wissen dürfen?«
Nicole stand auf und stellte sich neben ihre Mutter, die sich eine Zigarette angezündet hatte. Nicole nahm sich ebenfalls eine Zigarette. Sie blieb mit dem Rücken zu den Beamten stehen und schüttelte den Kopf. »Nein, Sabine hat keinen Freund. Es gab da mal einen, aber die Sache ist seit einem halben Jahr vorbei. Es war auch keine feste Beziehung, eher oberflächlich. Er hat wohl auch mehr reininterpretiert, als da in Wirklichkeit war. Sie hat es mehr als Spaß angesehen, während er es sehr ernst nahm.«
»Was hat er gemacht, als Schluß war?«
»Nichts, er hat ein paar Tage lang ständig hier und bei Sabine angerufen und gewinselt – manche Jungs sind eben echte Memmen –, aber Sabine hat nur drüber gelacht. Wie gesagt, die Sache ist ein halbes Jahr her und …«
»Kennen Sie den Jungen?«
»Ja, er geht auf unsere Schule, macht dieses Jahr sein Abi.«
»Würden Sie ihm zutrauen …«
Frau Bernhardt drehte sich abrupt um, angriffslustiger Blick, wie eine Löwin, die ihr Junges verteidigt, und sagte: »Nein, vergessen Sie’s, ich kenne den Jungen, seit er in den Windeln gelegen hat, und ich kenne seine Eltern. Er ist ein überaus sensibler und lieber Kerl. Versuchen Sie’s gar nicht erst bei ihm.«
»Wir hätten trotzdem gern seine Adresse.«
»Warum? Wollen Sie unbedingt unnötigen Staub aufwirbeln?«
»Hören Sie zu«, sagte Durant schärfer als beabsichtigt, »ein Mädchen ist verschwunden, und wir werden jeder noch so vagen Spur nachgehen; das ist alles andere als nur das Aufwirbeln unnötigen Staubs, wie Sie es nennen! Zur Zeit ist das Verschwinden eines siebzehnjährigen Mädchens mit blonden Haaren leider überaus ernst zu nehmen!«
»Ich gebe Ihnen eine Karte, auf der Name und Adresse vermerkt sind«, sagte Frau Bernhardt leicht pikiert, zog die oberste Schublade des Sekretärs heraus, entnahm eine Visitenkarte und reichte sie Durant.
»Sonst gab oder gibt es keinen Jungen, mit dem Sabine irgendwann einmal zusammen war oder ist?«
Nicole schüttelte erneut den Kopf. »Zumindest hat sie es mir nicht gesagt. Aber wir sprechen eigentlich über alles. Ich wüßte es, wenn sie einen Freund hätte.«
»Seit wann sind Sie befreundet?«
»Seit etwa drei Jahren. Wir sehen uns fast jeden Tag.«
»Wie kommt Sabine von hier nach Hause? Es ist ein ganzes Stück Weg bis zu ihrer Wohnung.«
»Gestern ist sie mit dem Fahrrad gekommen, aber weil es zu regnen anfing, hat sie das Rad hier stehengelassen. Manchmal fährt meine Mutter sie, manchmal bringe ich sie zum Bus, gestern ging aber weder das eine noch das andere, weil meine Mutter nicht da war und ich einen dringenden Anruf bekam und Sabine pünktlich zu Hause sein wollte. Ich mußte sie allein gehen lassen.«
»Wie weit ist es bis zur Haltestelle?«
»Drei, vier Minuten zu Fuß. Mit dem 61er sind es noch mal zehn Minuten bis zu ihr nach Hause.« Sie nahm einen langen Zug an der Zigarette und fuhr fort: »Ich habe mich gestern Abend schon gewundert, daß sie mich nicht angerufen hat, denn sonst ruft sie immer noch mal hier an, nachdem sie zu Hause angekommen ist. Gut, ich habe fast eine Dreiviertelstunde telefoniert, aber ich habe sofort danach bei ihr angerufen, und es hat sich niemand gemeldet. Ich dachte mir, daß sie vielleicht gerade badet oder schon im Bett liegt, habe es aber ein paar Minuten später trotzdem noch einmal probiert.«
»Ist es schon einmal vorgekommen, daß sie nicht gleich nach Hause gefahren ist? Daß sie einen Umweg genommen hat oder aufgehalten wurde?«
»Ein-, zweimal. Aber das hing damals mit Andreas zusammen, und ich wußte jedesmal davon. Wenn sie etwas anderes vorgehabt hätte, hätte sie es mir gesagt, da bin ich ganz sicher.«
»Auch, wenn es sich um einen Freund gehandelt hätte?«
»Gerade dann.«
»Gut, das war’s fürs erste«, sagte Julia Durant, verstaute den Block in ihrer Tasche, stand auf. »Hoffen wir, daß Sabine wieder auftaucht. Sollten wir noch Fragen haben, werden wir uns vielleicht noch einmal an Sie wenden müssen. Auf Wiedersehen.«
Frau Bernhardt nickte mit abwesendem Blick. Rauchte, pulte am rechten Daumen, wirkte etwas nervös. Durant registrierte es, zeigte es aber nicht. Draußen reichte sie Schulz die Visitenkarte.
»Fahren wir also zum Nansenring zu Menzel. Das ist die Parallelstraße«, sagte er.
An der Tür standen nicht einmal die Initialen von Alexander Menzel, einem der einflußreichsten Männer von Frankfurt, Bauunternehmer, Aufsichtsratsvorsitzender, Vorstandsvorsitzender, seine Krakenarme reichten überallhin, kaum ein Unternehmensbereich, in dem er nicht tätig war. Und seit einiger Zeit engagierte er sich auch noch politisch auf kommunaler Ebene, mit wachsendem Erfolg, wie es hieß.
Die Kommissarin drückte den Klingelknopf. Es dauerte eine Weile, bis eine ältere Frau in grauem Kostüm an das Tor kam. Durant hielt ihr den Ausweis hin, bat darum, Andreas Menzel sprechen zu können.
»Er schläft noch«, sagte die Frau blechern und unfreundlich.
»Dann wecken Sie ihn, es ist wichtig«, sagte Durant eisig.
»Folgen Sie mir bitte, und nehmen Sie im Wohnzimmer Platz …«, sagte die Frau, öffnete das Tor und ging vor ihnen ins Haus. Sie deutete auf den Wohnbereich.
Andreas Menzel kam nach fünf Minuten. Er war ungekämmt, hatte sich eine Jogginghose und ein T-Shirt übergezogen. Er war höchstens einssiebzig, ausgesprochen zierlich gebaut, mit feingliedrigen Fingern und dünnen, zerbrechlich wirkenden Armen. Er verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich in aufreizender Pose an den Schrank. Die Kommissarin spürte hinter der Fassade der Aufsässigkeit einen verstörten, unsicheren Jungen.
»Sie sind Andreas Menzel?« fragte sie.
»Ja, und Sie sind von der Polizei, wie ich gehört habe. Was wollen Sie von mir?«
»Sie kennen Sabine Lindner?«
»Ja.«
»Und Sie waren befreundet? Stimmt das?«
»Ja, aber das ist schon eine ganze Weile her. Ich habe mit ihr Schluß gemacht …«
Durant verkniff sich ein Lächeln. Das war also die andere Version der Geschichte. Ein verschmähter Liebhaber, der nie zugeben würde, den Laufpaß bekommen zu haben, aber wer gab so etwas schon gerne zu.
»Haben Sie sie in letzter Zeit gesehen?«
»Natürlich, in der Schule. Aber wir sprechen nicht mehr miteinander. Uns trennen Welten. Schauen Sie doch, wie wir leben, und dann sie. Sie lebt auf der anderen Seite der Welt. Aber warum fragen Sie mich über Sabine aus?«
»Sie wird seit gestern Abend vermißt. Und weil sie blond und erst siebzehn ist … Nun, Sie werden sicher die Nachrichten gehört oder zumindest Zeitung gelesen haben. Was können Sie uns über sie sagen? Welche Hobbys hat sie, wo hält sie sich gerne auf, und so weiter.«