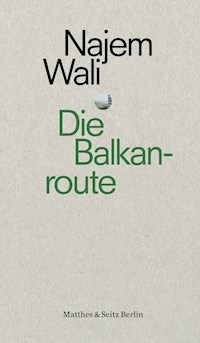Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2008
Jussif und Junis sind Brüder. Als Jungen waren sie beide in dasselbe Mädchen verliebt. Weil sie Jussif bevorzugte, gab Junis ihr einen Kuchen mit Nägeln zu essen. Sie starb, aber nicht Junis, sondern Jussif kam ins Gefängnis dafür. Seitdem ist das Verhältnis der Brüder ein Spiel mit Rollen und Masken, aus dem im Krieg tödlicher Ernst wird. Als Junis nach dem Aufstand gegen Saddam Hussein verschwindet, nimmt Jussif seinen Namen an. Viel zu spät erfährt er, dass sein Bruder als Henker gesucht wird. Niemand will Jussif seine Geschichte und seine Unschuld glauben. Ein gefährlicher Kampf um Namen und Identitäten entbrennt, den nur einer der Brüder gewinnen kann. Ein bewegender, dunkler, intensiver Roman über den Irak - märchenhaft, burlesk und voller politischer Anspielungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Najem Wali
Jussifs Gesichter
Roman aus der Mekka-Bar
Aus dem Arabischen
von Imke Ahlf-Wien
Carl Hanser Verlag
Die arabische Originalausgabe erschien 2005
unter dem Titel Súrat Jussif bei Al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi in Beirut und Casablanca.
Die Übersetzerin dankt Hans-Eugen Wien
für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts.
eBook ISBN 978-3-446-23357-7
© Najem Wali
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2008
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.hanser.de
»Erzählen wollen wir dir die schönste der Geschichten«
(Koran, Sure 12: »Jussif«, Vers 3)
»Wir sind Wesen, die einander etwas erzählen«
(Fernando Pessoa)
Für Nahar, im Labyrinth der Namenserarbeitung
Inhaltsverzeichnis
Ein Wort vorweg 11
Das Ende der Geschichte 15
Der Kassettenrekorder 23
Erstes Kapitel
Auf der Flucht vor sich selbst zu sich hin:
die Erinnerung an das kleine Mädchen mit
den grünen Augen, den blonden Zöpfen
und dem blauen T-Shirt 25
Zweites Kapitel
Auf der Suche nach dem Widersacher: ein Spaziergang
durch die Geisterstadt – Bagdad 45
Drittes Kapitel
Ein Besuch im Leichenschauhaus: Werde ich
wirklich verfolgt? Und wo soll meine eigene
Leiche liegen? 57
Viertes Kapitel
Die Erschaffung von Namen: ein Labyrinth
voller Masken und Spiegel 85
Fünftes Kapitel
Ein Besuch bei Josef Karmali oder Josef K.:
Gespräch über Bombenexplosionen und Volkskrankheiten,
über die Fälschung von Ausweisen,
über Dichter und Mord 123
Sechstes Kapitel
Ein Streifzug durch die Chajjam-Straße:
als wäre man im Kino 155
Siebtes Kapitel
Über das Glück, den Tisch mit der Frau des Lebens
zu teilen: mit einer Schachtel Zigaretten,
einem Glas eisgekühltem Bier und ein wenig Erotik 177
Achtes Kapitel
Auf der Rückkehr von sich selbst zu sich hin:
ein Besuch in der geheimen Bar, der Mekka-Bar,
und der Abschied von den Freunden 219
Der Anfang der Geschichte 261
Ein Wort vorweg
Diese Worte muss ich dir schreiben, lieber Leser, um mich im Voraus dafür zu entschuldigen, wenn du dich im Labyrinth der Namen und Persönlichkeitsfälschungen verlieren solltest. Aber wie soll man die Tragödie der Qual beschreiben, in der ich mich viele Jahre befand?
Damals zog ich von einer Stadt in die andere, von einem Hotel ins nächste, von Büro zu Büro, wechselte Arbeitsplätze und Persönlichkeit, legte mir falsche Namen zu – bis ich vergaß, wer ich eigentlich war. Einmal war ich fahnenflüchtig, ein andermal versuchte ich, meine Vorgesetzten zu täuschen, einmal um meiner, Jussifs selbst willen, ein andermal um der Namen willen, die ich zu den meinen gemacht hatte. So geriet ich selbst immer mehr in ein Labyrinth (nachdem die Fälschung zur einzigen, mein Leben bestimmenden Wahrheit geworden war): Ist man mir als Jussif Mani auf den Fersen oder einem anderen, dessen Namen ich trage? Wundere dich nicht, verehrter Leser, dass meine Geschichte eine Hymne auf die »Fälschung« singt! Denn wenn alles zerstört ist und der Tod zur Richtschnur für das Leben der Menschen wird, wenn sich die Angst in jede Faser unseres Lebens einnistet, wenn Verhaftung, Gefängnis, Militarismus, Seuchen und Krankenhäuser überhand nehmen, wenn der Pulverdampf den Himmel verdunkelt und der Krieg zum täglichen Einerlei wird, dann bleibt zur Rettung unseres Lebens nur noch die Flucht in die Fälschung des eigenen Namens. Dies könnte ein Paradebeispiel für den Kampf ums Überleben im Strudel der Angst sein.
Meine Erzählung ist eine Sammlung von gefälschten oder angeeigneten Geschichten: der Geschichte Jussifs, der Geschichte Junis’, der Geschichte Harun Walis, der Geschichte Josef Karmalis oder Josef K.s, der Geschichte Mariams, der Frau Junis’, der Geschichte der blinden Tante, der Geschichte des verrückten, arrakversoffenen Onkels ’Assim, der Geschichte des kleinen Mädchens Sarab, Fata Morgana, der Geschichte der Ehefrau Sarab, der Geschichte des kleinen Mädchens Sarab, das beobachtete, wie Jussif, von einem Schuss getroffen, niederfällt, der Geschichte des Erzähler-Arztes, der mir am Ende ähnlich wird ... Meine Erzählung ist auch die Geschichte der Mekka-Bar, die zu einer heiligen Gebetsnische für all jene enttäuschten Existenzen wird, die den Tisch der Hoffnungslosigkeit miteinander teilen.
Man sagt, die Katze habe sieben Leben und nehme mit jedem Leben eine neue Gestalt an. Und ich? Wie viele verwirrende Gestalten haben mir ein neues Leben gegeben? Wie viele gefälschte Namen gingen mir voraus? In wie vielen Geschichten wird mein Bild gepriesen? Wie handelt jemand wie ich, der die Angst von Kindheit an als tägliche Begleiterin kennt? Wie handelt jemand wie ich, dem der Bruder (der Henker) die von ihm gewünschte Persönlichkeit aufdrückt, dieser Bruder, der ihn so früh zum Mörder abstempeln lässt? Wie handelt jemand wie ich, wenn die Verwirrungen mit zunehmendem Alter immer größer werden, wenn es ihn nicht mehr interessiert, zu welchen Wurzeln, zu welchem Stamm, zu welchem Clan, zu welchem Volk er zurückkehrt?
Ja, lieber Leser, so sieht es aus in Zeiten von Diktatur und Gewalt, in Zeiten von Besatzung und Kriegen, in Zeiten totaler Zerstörung. Dem Einzelnen bleibt nichts anderes übrig, als sich Geschichten zu eigen zu machen, von denen er glaubt, sie gehörten ihm. Auf diese Weise vergehen »fünfunddreißig Jahre«, Jahre der Willkür und der Gewaltherrschaft, Jahre des schwarzen Urteils. Im Land der Gedemütigten und der Siegreichen, der sich selbst Besiegenden, aber auch Jahre, in denen man sich wünscht, mit seiner gelebten, für sich erfundenen Wahrheit in Einklang zu sein, um die eigene Haut vor dem Vorwurf des Verrats an der eigenen Person oder an einem Nahestehenden zu retten, geheimnisvolle Jahre, die in ihrer Rätselhaftigkeit dem »geheimnisvollen« Land ähneln.
In unserem Land ist jeder Mensch die Quintessenz des Geheimnisses, das er in sich birgt. Und zwar nicht nur im Irak der Vergangenheit, sondern auch in dem der Gegenwart. Meine Geschichte beginnt und endet an einem Ort: in meinem Haus in Bagdad. Ich beschreibe meinen täglichen Weg durch diese Stadt, an ihren verlorenen historischen Stätten vorbei, die da sind: das Bab al-Mu’adhdham, die Raschid-Straße, das Hafiz-al-Qadi-Viertel, die Chajjam-Straße, der Museumsplatz, Kadhimijja, das Arosdibbek, das Kino, die Bars, besonders die Mekka-Bar, das historische Bagdad, nicht das gegenwärtige Bagdad mit seinen explodierenden Autos und Humvee-Fahrzeugen, das Bagdad der Banden, des Mordes und der Zerstörung, das Bagdad der Marines und der religiösen, ganz und gar nicht göttlichen Milizen, das Bagdad der Hoffnung und der Fata Morgana ... Und wenn du von dieser ausgedachten Reise nach Hause kommst, wirst du beginnen, dein Bild nach einem Bild zu formen, das zu mir passt: »Jussifs Gesichter«.
Ich bin Jussif Mani, dann und dann in Bagdad geboren, der kleine Bruder des großen Bruders namens Junis. Da ich der kleine war, musste ich hinnehmen, dass mich mein großer Bruder beherrschte. Sogar das Mädchen, in das ich verliebt war, »das kleine Mädchen mit den grünen Augen, den blonden Zöpfen und dem blauen T-Shirt«, hatte ein tragisches Schicksal, weil mein großer Bruder sie für sich forderte.
Als ich älter wurde und nicht in den Krieg ziehen wollte, flüchtete ich mich in noch mehr erlogene Eigenschaften und Fälschungen. Es gab kein Entrinnen mehr. Bei alledem übersah ich, wie ich mir mein eigenes Grab schaufelte, dass ich nicht imstande wäre, meine diesmal von ihm ausgewählte Rolle zu einem Ende zu bringen. Junis hatte mir, dem Ahnungslosen, eine Falle gestellt, mich dazu gebracht, freiwillig das Amt des Henkers zu übernehmen, das er fünfunddreißig Jahre lang innegehabt hatte, in der Zeit der schwarzen Herrschaft. Nach dem 9. April 2003 wollte er unter meinem Namen aufsteigen. Er kam auf den Panzern der ausländischen Streitkräfte daher. Er behauptete, ich sei nichts als ein Kranker aus der Irrenanstalt, zerstört von der Schizophrenie. Er habe es satt, die Verantwortung für seinen Namen zu tragen. Wer würde einem Schwächling wie mir schon glauben? Wer würde mir glauben, dass ich nicht Junis sei, sondern Jussif, den der eigene Bruder ins Irrenhaus geworfen hatte, um ihn loszuwerden? Junis konnte sich nicht vorstellen, dass ich mich diesmal wehren würde, und versuchte sich meiner mit allen Mitteln zu entledigen. Verehrter Leser, warum erzähle ich dir dies im Voraus, sage dir, was geschehen wird? Warum halte ich deine Urteilsfähigkeit und Aufmerksamkeit, deine Neugier und das Verlangen, die Geschichte zu erfahren, für zu schwach? Warum begnüge ich mich nicht damit, dir den Zugang zu der Geschichte in dem Maße zu erleichtern, das ich mehr als alles andere für ausreichend halte? Aber bevor ich mich von dir verabschiede und dich der weiteren Lektüre der Geschichte überlasse, sei es mir jetzt noch erlaubt, dir etwas Wichtiges mitzuteilen: Ich kenne zwar nicht die Zahl der Namen, die ich mir bis heute zugelegt habe, aber der einzige mir bekannte Name, dem ich treu geblieben bin, ist mein Name, Jussif Mani, Jussif der Unschuldige, der sein Lebtag niemanden getötet hat. Lebe wohl, lieber Leser, und erinnere dich eines Freundes im Unglück, der da Jussif heißt und in Bagdad lebt …
Jussif Mani,
Krankenhaus der Gerichtsmedizin
Bagdad
Das Ende der Geschichte
Ich wusste nicht, warum ich auf einmal Angst bekam, die Person, die dort schlief, könnte jede sein außer mir selbst. Oder war es das Echo auf den letzten Satz aus dem Kassettenrekorder, der mich vor Bestürzung zusammenzucken ließ?
»Der jüngste Tag ist angebrochen, und der Mörder muss seine Schulden begleichen.«
Ich blickte um mich, dann sah ich aus dem Fenster. Draußen, hinter den Gardinen, war es immer noch dunkel. Der Garten wirkte weit entfernt, war kaum zu sehen. Ich wusste nicht, wie viel Zeit ich auf dem Bett verbracht hatte. Es war so breit, dass mindestens zwei Personen darauf Platz fanden. Für meinen schmächtigen, zu einer Kugel zusammengerollten Körper – die Haltung, in der Jussif sich auf diesem Bett ausgeruht und mir vor dem Einschlafen eine seiner Geschichten erzählt hatte – war es viel zu breit. Vielleicht waren seit meinem Einschlafen etliche Stunden vergangen. Wie ich mich jetzt erinnerte, hatte ich mich nicht hingelegt, um zu schlafen, sondern um seinen Erzählungen auf dem Kassettenrekorder zu lauschen, wie er mich gebeten hatte. (Später legte ich das Gerät in die kleine Kommode an der Fensterseite zwischen Bett und Wand.) Ich wollte mich an den Esstisch in der Nähe des Fensters setzen, doch die alle Fasern meines Körpers erfassende Müdigkeit saß so tief, dass ich es für besser hielt, mich auf das Bett zu legen. Es sah ohnehin so aus, als stünde es nur für mich bereit und sei nicht das Bett, in dem Jussif seit Jahren geschlafen hatte. Bevor ich die Augen schloss, sann ich der Stimme aus dem Kassettenrekorder nach. Wenn ich tatsächlich eingeschlafen wäre, hätte ich sie nicht mehr hören können. Seit ich den Kassettenrekorder eingeschaltet hatte, um mir die Aufnahmen anzuhören, hatte ich das Gefühl, das Bett starre mich an, fordere mich geradezu auf, seinem Ruf nachzukommen und meinen erschöpften Körper daraufzuwerfen. Ich war wirklich müde, nachdem ich mehr als einen Tag hatte wach bleiben müssen – von der Morgendämmerung bis nach Mitternacht des folgenden Tages, als ich ihn ins Krankenhaus brachte. Sein Arzt hatte mir mitgeteilt, dass er verletzt und völlig verzweifelt sei. Wenn das elfjährige Mädchen nicht gewesen wäre, das neben ihm auf dem Bett saß und mit kindlicher Stimme sagte: »Er besteht darauf, dass Sie bleiben, er ist noch am Leben!«, hätte ich nicht geglaubt, dass er noch einmal die Augen öffnen würde. Außerdem sagte er sofort: »Wenn du die Wahrheit erfahren willst, hör dir an, was der Kassettenrekorder erzählt.« Er schien trotz seiner Schwäche zu wissen, dass ich eine Antwort verlangen würde und er seine Schulden begleichen müsse, um mich für das Schweigen zu entschädigen, mit dem er meinen Fragen und meinem Wunsch, er solle sich einer Behandlung unterziehen, begegnete. Was er am ersten Tag sagte, als sie ihn mit gefesselten Händen brachten, glaubte ich ohnehin nicht: »Ich bin ein hoffnungsloser Fall, genauso wie die anderen verzweifelten Fälle in diesem Land der Siegreichen und der Gedemütigten.« Auch er selbst konnte diese Worte nicht mehr vergessen und wiederholte sie bei jedem meiner Besuche im Krankenhaus. Einmal jedoch fügte er etwas hinzu, was mir im ersten Moment wenig logisch erschien: »Erst jetzt weiß ich, dass ich leben werde.« Dabei schaute er das kleine Mädchen an. Ich hatte bis dahin keine Ahnung, wer sie eigentlich war. Die Tatsache, dass sie mich vom Krankenhaus bis hierher, an diesen Ort, dessen Adresse er mir gegeben hatte, begleitete, steigerte meine Verwirrung nur noch. In diesem Haus mitten in der Stadt, in dem er sich jahrelang verkrochen hatte, fand ich zahlreiche Kassetten, die nur auf mich zu warten schienen. Auf ihnen hatte er alles erzählt, was ihm zugestoßen war (oder wovon er glaubte, es sei ihm zugestoßen). Ja, er beharrte darauf, bestimmte Dinge beim Namen zu nennen. Und an eben diesem Ort öffnete ich jetzt die Augen und merkte, dass ich in seinem Bett schlief.
Noch war alles mysteriös, voller Geheimnisse, wie die Dunkelheit, die sich draußen ausbreitete, wie der Zweifel, der seit Betreten dieses Hauses gestern Nacht auf mir lastete. Nicht nur meine Intuition sagte mir, dass sich noch jemand anders dort aufhalten und zurückkehren würde, je länger ich bliebe. Auch sonst deutete alles darauf hin: Die Haustür war offen; ich musste sie nur ein wenig anstoßen, um eintreten zu können. Die Kassetten auf dem Tisch zogen sofort den Blick auf sich, das Zimmer war sauber und ordentlich. Es war, als hätte man den Ort für meinen Aufenthalt vorbereitet, als sei es mir überlassen, ob ich bliebe oder ginge. Heute erinnere ich mich nicht mehr, ob ich mir darüber Gedanken machte, bevor ich einschlief. Ich hatte mich vor den Kassettenrekorder gesetzt, um mir die Kassetten von vorn bis hinten anzuhören. Vielleicht entdeckte ich es erst im Moment meines Erwachens aus einem endlosen Traum – am besten zu beschreiben als Albtraum, in dem ich wieder und wieder die Worte hörte: »Der jüngste Tag ist angebrochen, und der Mörder muss seine Schulden begleichen.« Von welchem Tag, von welchen Schulden sprach die Stimme? Sicher meinte der Sprecher einen anderen, sagte ich mir, als ich langsam die Augen öffnete. Doch vor mir auf dem Tisch im Salon sah ich nur den Kassettenrekorder, einen Aschenbecher, zwei Dosen Bier und daneben einen Kindercomic, verstreute Kassetten und eine Tageszeitung.
Paradoxerweise dachte ich, der Kassettenrekorder hätte mich aufgeweckt und die warnende Stimme käme von dort, aus dem Rekorder. Doch aus dem war nur ein Krächzen zu hören. Ich schreckte zusammen, merkte aber, dass die Kassette zu Ende war. Die Stimme kam von meiner Seite, aus der Gegend meiner Ohren. Ich fragte mich, wem sie wohl gehören mochte. Gehörte sie wirklich ihm: Jussif Mani? Ich war noch wie gelähmt, wie jeder, der gerade aus dem Schlaf erwacht und sich in meiner Lage befindet. Jussif Mani war vor sich selbst auf der Flucht und nicht vor mir, wie ich zunächst angenommen hatte. Er wollte die Geschichte nicht beenden, sondern hatte mir die Kassetten dagelassen, um mich auf die folgende Szene vorzubereiten. Nichts sollte mich überraschen. So stand es um ihn vom Moment unseres Kennenlernens an, als ich ihn ins Krankenhaus brachte, bis hin zu unserer letzten Begegnung: Er war verrückt nach Ordnung. Mit allen Mitteln wollte er auf Sorgfalt und Genauigkeit achten – auf diese Dinge, die wir allesamt schon in unserer Kindheit und dann in unserem weiteren Leben vermissten.
Doch dieser Gedanke hielt nicht länger an als die verdächtige, süße Trägheit, die mich bei solchen Gelegenheiten überwältigt. Als ich die Muskeln lockerte und die Lider öffnete, wurde mir bewusst, dass ich noch lange nicht genug geschlafen hatte. Was während des Liegens auf dem breiten Bett passierte, war ein Kampf zwischen Schlafen und Wachen, Traum und Albtraum, Zweifel und Gewissheit, Wirklichkeit und Erfindung. Es war ein Kampf zwischen dem, was ich bereits von den Kassetten gehört, und dem, was ich noch nicht gehört hatte, mir aber mit viel Willenskraft und Mühe ausmalen konnte. Letztlich war es auch ein Kampf zwischen mir, der auf dem Bett lag, und Jussif, der jetzt vielleicht anwesend war und nicht irgendwo anders, wie er es seit seiner Flucht immer geplant hatte. In diesem Moment hatte ich plötzlich das seltsame Gefühl, dass der Kassettenrekorder über mich sprach. Ja, ich hatte ihn dort hingestellt, um zu hören, was er zu erzählen hatte. Das Problem zwischen Jussif und seinem Bruder war also in Wirklichkeit ein Problem zwischen Jussif und mir. Es war, als würde ich alles, was geschehen war oder wovon ich mir vorstellte, es sei so geschehen, schon seit langem wissen. Es war, als setzte ich zu einem kleinen Sprung durch mehrere Personen an, als erschaffte ich mir eine frühere Existenz, in die ich mich verstrickte – ganz zu schweigen von dem, was ich auf dem Kassettenrekorder gehört oder noch nicht gehört hatte. Ich versetzte mich gleichsam an Jussifs Stelle, um alles zu erleben, was ihm zugestoßen war. Je länger dieser Gedanke anhielt, desto mehr fühlte ich mich befreit von dem, was ich gehört und noch nicht gehört hatte, als wäre der Kassettenrekorder weit weggebracht worden oder als wäre ich nicht mehr in diesem Haus, läge nicht mehr auf diesem breiten Bett, ja als wäre ich nicht wegen einer anderen Person hier. Es war, als wäre ich Jussif, der auf meine Ankunft wartete, als wäre ich der Verletzte, der im Krankenhaus lag. Ich wusste, dass ich sterben würde, und bat ihn, mein Haus aufzusuchen, egal, wo es sich befand – ein Haus an einem Nirgendwo. Und ich sagte ihm, dass er nur den Kassettenrekorder einschalten müsse, um die Wahrheit zu erfahren. Ich bat ihn, dort zu bleiben und mich die Geschichte ihm oder dem kleinen Mädchen an seiner Seite erzählen zu lassen – von Anfang bis Ende, ob sie nun der Wahrheit entsprach oder erfunden war. Die Art und Weise, wie ich meine Geschichten erzählte, spielte keine Rolle. In der Folge erzählte er mir nicht nur seine Geschichte, sondern auch die Geschichten anderer Menschen. Zunächst hatte ich gedacht, ich könnte ihn dadurch heilen, dass ich ihm Geschichte auf Geschichte erzählte. Aber es war so, dass er mir seine Geschichte erzählen musste oder, schlimmstenfalls, eine Geschichte, von der ich glaubte, dass sie mit ihm, eigentlich aber mit niemandem zu tun hatte: die Geschichte eines Verrückten, voller Geschrei und Gewalt, Mord und Verrat. Wichtig war nur meine Anstrengung, um mit ihm zusammen bis zu einem gewissen Punkt zu gelangen: Ich musste dem lauschen, was er mir zu sagen hatte. Ich bin geheilt: Sie müssen sich von heute an keine Sorgen mehr machen. Der Schaden, den ich Ihrer Existenz zugefügt habe, genügt. Ich weiß, es ist ein seltsames Gefühl, und es ist nicht einfach, sich davon zu befreien. Aber es ist auch ein neues Gefühl für mich! Gebt mir – trotz der Unordnung, die meine Gedanken deutlich sichtbar hinterlassen haben – die Schätze meines Geistes zurück.
Es war wirklich erstaunlich: Trotz der Dunkelheit, die mich von allen Seiten umschloss und mir ungewöhnlich schwarz erschien, spürte ich, dass sich meine Lider ganz leicht öffneten. Ich konnte genau sehen, was mich umgab, und fragte mich, wie spät es wohl sei. Im selben Moment antwortete ich mir aber: »Es ist egal, es sei, wie es sei.«
Ich spitzte die Ohren. Durch das Fenster vernahm ich ein leises Zwitschern, das aus dem Garten kam. Sicher dämmerte es schon, und die Vögel des frühen Morgens waren genauso erwacht wie ich. Auch sie vergewisserten sich zuerst, dass eine weitere Nacht vergangen war und sie noch am Leben waren. Dann bereiteten sie sich auf den kommenden Tag vor. Auch der Morgen gähnte noch im Schlaf und versuchte, sich von sich selbst zu befreien. Aus der Ferne hörte ich einen Schnellzug. Je weiter er sich entfernte, desto mehr stellte ich mir vor, wie das Geräusch die Grenzen einer neuen Strecke absteckte, als sei ich einer der Reisenden, die am nächsten Bahnhof aussteigen würden.
Ich reckte die Glieder und richtete mich ein wenig auf. Dann streckte ich die Hand nach der kleinen Kommode aus, die neben dem Bett an der Wand stand, und holte meine Uhr heraus. Ich warf einen Blick auf das phosphoreszierende Zifferblatt: Es war etwa vier Uhr. Mir fiel ein Satz ein, von dem ich nicht mehr wusste, wo ich ihn gehört oder gelesen hatte: »Dies ist der Moment, in dem der Kranke merkt, dass er reisen, dass er eine Nacht in einem unbekannten Hotel verbringen muss. Wenn das Licht unter der Türschwelle hindurchscheint, erwacht mit Glück das Ergebnis irgendeines Gedankens.«
Was mich betrifft, saß der Kranke allerdings nicht in einem unbekannten Hotel, sondern in einem Haus mitten in der Stadt, einem Haus an einem Nirgendwo. Er befand sich nur an Stelle des Kranken. Er lag auf dessen Bett und stellte sich den Lichtschein nur vor. Dieser Schein stammte vom Phosphor im Innern seiner Uhr, die er neben eine Tageszeitung, eine dicke Arztbrille und den Kassettenrekorder in die Nähe des Telefonapparats gelegt hatte. Er war verwirrt und konnte sich auf keine einzige Geschichte konzentrieren. Er vernahm nur einen von allen Zimmerwänden widerhallenden Satz: »Wenn Sie die Wahrheit erfahren wollen, hören Sie an, was der Kassettenrekorder erzählt.« Er drückte den Einschaltknopf des Kassettenrekorders, rieb sich die Augen und blickte um sich, als erwachte er aus einem langen Albtraum. Und er erkannte – oder bildete es sich ein – das Gesicht eines elfjährigen Mädchens, im Dunkel hinter der Fensterscheibe. Ja, alles deutete auf die wirkliche Sarab hin – eine dort harrende Fata Morgana. Jetzt streichelte sie die Hand des Mannes auf dem breiten Bett, viel zu breit für seinen ausgezehrten Körper. Seine Lippen murmelten etwas, das nur das Mädchen verstand. Er bat sie, nicht zu vergessen, was ihm und den Menschen in seiner Umgebung zugestoßen war. Auch die Geschichten, die er ihr erzählt hatte, sollte sie nicht vergessen, egal wie alt sie werden sollte. Jede einzelne seiner Geschichten sollte sie sich wieder und wieder vergegenwärtigen, bevor sie aufstehen und sich in eine andere Person verwandeln würde. Er würde seine tägliche Reise durch vertraute Orte antreten, und vor seinen Augen würde – gewollt oder ungewollt – das Bild erscheinen: das Bild Jussifs.
Der Kassettenrekorder
Erstes Kapitel
Auf der Flucht vor sich selbst zu sich hin:
die Erinnerung an das kleine Mädchen mit
den grünen Augen, den blonden Zöpfen
und dem blauen T-Shirt
Ich sehe ihn vor mir: Es war ungefähr vier Uhr morgens, als Jussif Mani durch eine warnende Stimme geweckt wurde: »Der jüngste Tag ist angebrochen, und der Mörder muss seine Schulden begleichen.« Es war keiner dieser vertrauten Albträume, die ihn sonst heimsuchten. Seit der Anrufer anfing, ihn zu belästigen, hörte er immer wieder dieselbe Stimme, die ihn daran erinnerte, dass der jüngste Tag gekommen sei und er sich dieses Mal bereithalten müsse. Er gab dem Sprecher keine Gelegenheit, deutlicher zu werden. Sicher handelte es sich um einen Irrtum. Denn Junis war ursprünglich gar nicht sein Name, wie der Sprecher voller Überzeugung behauptete, sondern der Name seines älteren Bruders, der seit etwa zwölf Jahren untergetaucht war. Damals hatte er beschlossen, seinen alten Namen für immer zu begraben und sich einen neuen Namen zuzulegen. Aber der Besitzer der fremden Stimme forderte vehement Rache. Er hörte nicht auf, ihn anzurufen – tagsüber bei der Arbeit, nachts zu Hause – und stets denselben Verdacht zu äußern. Er ließ ihm nicht einmal eine Sekunde Zeit, Fragen zu stellen.
In Wirklichkeit hatte Jussif bisher geglaubt, die Namensänderung sei eine Angelegenheit, die der Vergangenheit angehörte. Eigenhändig hatte er die Sterbepapiere für seinen Bruder abgestempelt. Er hatte keine Ahnung, warum dieses Thema plötzlich wieder aufgewärmt wurde. Seine Unruhe verstärkte sich noch, als ihm zwei oder drei Wochen später sein alter Name »Jussif Mani« in die Augen fiel – der Name, von dem wir annehmen können, dass es derzeit der seine ist. Er stand als Name des Herausgebers auf der ersten Seite einer Tageszeitung. Von diesem Moment an schlief Jussif nicht mehr gut. Immer häufiger schreckte er nachts auf; der Schweiß lief ihm über die Stirn, Fieber schüttelte seinen Körper. Schließlich meinte er, sogar Sarab, seine Bettgenossin, müsste diese Hitze spüren. Und oft stellte er sich vor, wie er sie mit einem plötzlichen Schrei aus dem Tiefschlaf riss. Endlich sah er ein, dass er sich nicht weiterhin so benehmen konnte, als sei nichts geschehen. Er konnte nicht mehr so tun, als handle es sich bei dem Anruf um einen Irrtum, den er ignorieren könne. Es war einfach kein unglücklicher Zufall, wie sie Tag für Tag überall auf der Welt vorkommen, eine bloße Namensverwandtschaft! In der nächsten Ausgabe derselben Zeitung las er ein Interview mit einer Person, die anonym bleiben wollte, über die Jahre der Gewalt und der Folter, der Entbehrung, des Verrats und Betrugs. Über den »Henker« Junis Mani, der seit seiner Kindheit ein Mörder war: »Stellen Sie sich das vor! Mit einem Kuchen, in den er winzige Nägel gesteckt hatte, tötete er das kleine Mädchen, das den Kuchen aß. Sie war in seinen kleinen Bruder verliebt, nicht in ihn. Er aber lenkte den Verdacht auf seinen Bruder, Jussif.«
Also änderte er seine Gewohnheiten, vor allem, weil er nicht der einzige war, der die Tageszeitung las. Seine Arbeitskollegen machten schon ihre Bemerkungen und fragten, ob er derjenige sei, von dem die Zeitungen berichteten, und ob er zwei Arbeitsstellen gehabt hätte. Die andere Tätigkeit hatte er jahrelang vor ihnen verborgen. Er konnte nicht so weitermachen wie bisher, er verstand es ja selbst nicht mehr. Je mehr er sich über das plötzliche Auftauchen seines alten Namens wunderte, desto nervöser wurde er. Ganz offensichtlich handelte es sich weder um einen Scherz noch um eine Intrige. Also würde es ihm schwerfallen, sich von jetzt an zu benehmen, als sei er auch als Träger dieses Namens ein Niemand, genau wie zuvor.
Es war lange her, seit er diesen Namen zum letzten Mal gehört hatte. Seine Mutter hatte ihm damals erzählt, dass sie Besuch von einer Person bekommen habe, die sie über den Tod seines Bruders informiert und ihr geraten hätte, diese Neuigkeit geheim zu halten. Aber dieser Person schenkte seine Mutter ohnehin keinen Glauben. Und auch Jussif glaubte nicht daran. Er war überzeugt, dass sein Bruder das Land verlassen hatte. Wenn er nicht vor ein paar Tagen zufällig in der Zeitung über seinen Namen gestolpert wäre, hätte er keinen Gedanken mehr an ihn verschwendet und die ganze Geschichte wäre nicht von neuem aufgerollt worden. Es war schwierig, sich mit der chaotischen Situation zu befassen, dass es noch eine andere Person gab, die einen Jussif in ihrem Innern barg. Er wollte nicht glauben, dass sein Bruder immer noch am Leben war und weiterhin seinen Namen, seinen alten Namen »Jussif« trug! Er wollte diesen Namen nicht aufgeben, er wollte nicht, dass die alte Geschichte wieder in Gang kam, wie damals, als es für einen von ihnen keinen Platz mehr gab. Seit dem Tod des kleinen Mädchens mit den grünen Augen, den blonden Zöpfen und dem blauen T-Shirt musste sich einer der beiden verstecken.
Da sich Jussif in den letzten Jahren daran gewöhnt hatte, keinen Schritt zu tun, ohne vorher alles sorgfältig abzuwägen, wollte er die Sache auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Es würde eine vorteilhafte Wirkung haben, den Fall ein für alle Mal beizulegen und diese ungeheure Last abzuwerfen, die ihn seit zwölf Jahren plagte. Warum antwortete er nicht einfach dem Anrufer: »Sie haben recht! Die Zeit ist gekommen, der Mörder muss die Schuld an seinen Opfern begleichen. Sie wissen doch, dass ich nicht Junis bin. Jeder von uns muss zu sich selbst zurückfinden.« Aber er wusste auch, dass die Angelegenheit nicht nur ihn betraf. Wer garantierte, dass es ihm gelingen würde, die andere Seite, diese andere Person, davon zu überzeugen, selbst wenn es sein Bruder sein sollte? Warum sollte der andere erneut die vergangenen und gegenwärtigen Auswirkungen dieses Namens auf sich nehmen, der ihm seit zwölf Jahren nicht mehr gehörte? Was wäre, wenn der andere seine Darstellung der Dinge ablehnte und auf seinem Namen und seinem Ich bestand, weil der andere nicht glauben wollte, dass er, Jussif, sich eine andere Persönlichkeit zugelegt hatte? Was, wenn der andere sogar aufdeckte, was Jussif seit all den Jahren vor sich selbst verbarg? Was, wenn der andere ihn vor anderen Menschen als Lügner bloßstellte, wenn dieser andere »sichere Beweise« zur Hand hatte, wie er in einem der Anrufe betonte?
Es fiel Jussif schwer, einen Entschluss zu fassen. Wann immer er daran dachte, alles zu klären, zögerte er. Doch der Besitzer dieser merkwürdig klingenden Stimme begann ihn heimzusuchen. Schlimmer als je zuvor überrumpelte er ihn im Traum und beherrschte ihn nächtelang immer drängender und fordernder, als würde er sich Nacht für Nacht näher an ihn herantasten. Diese Person schrie nicht von der Tür oder vom Fenster aus, sondern befand sich im Bett, direkt an seinem Kopf. Er konnte ihm nicht entkommen.
Es war sinnlos, feige zu sein, wie sonst immer. Die letzten zwölf Jahre, die Jahre des Vergessens, waren nur die tägliche Vorbereitung auf die Begegnung gewesen, die zwischen den beiden stattfinden musste: zwischen ihm und dem Phantom, das seinen Namen trug und ihn zwang, sich an seinen Bruder zu erinnern. Machte er weiter wie bisher, so bedeutete dies Selbstmord für ihn und Mord an seiner Frau Sarab. Denn er war sicher, dass sie zu ihm zurückkehren und ihm seine alten Geschichten verzeihen würde: Einer von uns muss sich verstecken. Es gibt keinen Platz für uns beide!
Dies dachte er in der vergangenen Nacht, als die Stimme sich in ein Dröhnen in seinem Kopf verwandelte, lauter als die Explosionen der gesprengten Autos, die man täglich in den Straßen der Stadt hörte. Das Dröhnen zersplitterte in seinem Kopf zu einer schnellen und regelmäßigen Folge von knallenden Geräuschen, die ihn nur in kurzen Phasen schlafen ließen. Er zitterte vor Angst, sein Mund war trocken, er wälzte sich im Bett hin und her, und das Echo der Stimme verfolgte ihn. Im selben Rhythmus wie sein Pulsschlag wiederholte es sich wieder und wieder: »Der jüngste Tag ist angebrochen, und der Mörder muss seine Schulden begleichen.«
Dann kam eine andere Nacht, voller Albträume wie die Nacht zuvor, eine Nacht ohne Worte außer diesem einen Satz, der ihm im selben Atemzug befahl aufzustehen. Auch dieser seltsame Ruf wiederholte sich wie der Albtraum, der häufiger auftrat als andere Albträume, fünf- oder sechsmal. Die Häufigkeit genau anzugeben fiel ihm schwer, vielleicht war es ihm gar nicht möglich, sie zu durchschauen. Seit dieser Albtraum ihn zum ersten Mal heimgesucht hatte, vermischte sich alles vor seinen Augen, bis das Bild, das er sich vom Besitzer der Stimme, von seiner angenommenen Gestalt zu machen versuchte, sich in sich selbst verlor. Es gewann keine Beständigkeit, sondern verwandelte sich stets in andere Personen. In vollkommenem Chaos nahm es so viele Schemen an, wie sein Bruder mit der eigenen Hand Masken angefertigt hatte. Das Gebilde konnte alles Mögliche sein, nur nicht das Gesicht seines Bruders. Warum wurde es nicht zum Antlitz seines Bruders? Hatte er es vergessen? Oder wollte er – wie als Knabe nach dem Tod des Mädchens – einfach nicht glauben, dass sein Bruder ein Mörder war? Oder war es wie beim Blick in den Spiegel, weil mit jedem Gedanken an ihn dasselbe Bild vor seinem inneren Auge auftauchte? Denn gerade er hatte dem Mädchen den Kuchen geschenkt, der es tötete! War dies nicht Anlass, dass er an die Existenz einer Person glaubte, die von seiner Unschuld wusste? Die wusste, dass sein Bruder der Mörder war? Wollte diese Person jetzt mit ihm eine Rechnung begleichen, weil sie nicht wusste, dass er unter dem Namen seines Bruders lebte? Wie sollte er seine Unschuld beweisen?
Jussif versuchte, sich die Gesichter ihm bekannter Personen vorzustellen. Einige hatte er seit der Kindheit, seit der Grundschule, nicht mehr gesehen. Andere kannte er aus den Tagen des Universitätsstudiums oder des Militärdienstes, wieder andere, seine Arbeitskollegen etwa, erst seit kurzer Zeit. Es waren aber auch die Gesichter Unbekannter darunter: Passanten, denen er auf dem Weg zum Büro oder beim Verlassen des Büros begegnete. Die meisten anderen kannte er aus der geheimen Bar: der Mekka-Bar (die eigentlich nur wenige Besucher so nannten). Andere Gesichter gehörten zu Schauspielern, die er im Fernsehen oder auf der Kinoleinwand gesehen hatte, ausländische und einheimische Schauspieler, die sich der Leinwand seiner Erinnerung eingeprägt hatten. Wieder andere gehörten Politikern der verschiedensten Nationen oder Händlern, denen er auf dem Markt begegnet war. Und auch die Gesichter der Ärzte, die ihn all die Jahre behandelt hatten, waren ihm gegenwärtig. Hunderte Gesichter der verschiedensten Prägung.
Immer aber war es ein männliches Gesicht, das auftauchte und sich schnell in der Dunkelheit des kleinen Zimmers verlor. In diesem Zimmer vernahm er auch die Seufzer seiner Frau Sarab, die neben ihm zu schlafen versuchte. Denn der Schweiß, der von seinem Körper rann und sich auf dem Bett verteilte, blieb nicht auf seiner Seite, sondern breitete sich bis zu Sarabs Seite des Bettes aus. Vielleicht hatte er beschlossen, jede Nacht den Kassettenrekorder auf dem Tisch im Salon laufen zu lassen, um damit die seltsamen Stimmen aufzuzeichnen. Schon nach kurzer Zeit musste er allerdings feststellen, dass es sich dabei um ein vergebliches Unterfangen handelte. Er hörte nur ein Knistern und Flüstern auf der Kassette, ein nichtssagendes Murmeln, das sich ständig wiederholte. Es ließ ein Echo zurück, das aus den Tiefen eines schweren Traums aufstieg und sich in seinen Ohren einnistete. Es drang wie alte Erinnerungen auf ihn ein, wie zusammenhanglos geschnittene Bilder aus alten Kriminal- und Liebesfilmen oder schwarzweißen Actionfilmen, nach denen er als Junge so süchtig war.
Wann immer er versuchte, sich an diese gebrochenen Geschehnisse zu erinnern, fühlte er sich wie jemand, der mit ungeheurer Mühe einen Traum erzählt, den er von jemand anderem gehört hat. Es ist nicht dieser Jussif Mani, der ständig vor Schreck zusammenzuckt, der vor seinem Namen auf der Flucht ist. Diesmal wird er eines Mordes verdächtigt, der – viel schrecklicher als zuvor – in der Morgendämmerung der vergangenen Nacht geschah. Diesmal fügt die Stimme einen neuen Satz hinzu, einen Satz, der eine Warnung in sich trägt: »Der jüngste Tag ist angebrochen, und der Mörder muss seine Schulden begleichen.«
Jussif erinnerte sich anschließend nicht mehr genau, ob das Telefon wirklich so spät in der Nacht klingelte und er diese Worte durch den Hörer vernahm oder ob sich alles nur in einem Traum abspielte. Er wusste allerdings, dass er die Worte erst vor kurzem gehört hatte. Sie hatten ihn unter Druck gesetzt und sich wie sein Albtraum ständig wiederholt. Aber wie sollte er seine Unschuld beweisen? Er brauchte dringend ein paar einfache Dokumente als gedruckte Beweise, nicht für sich selbst, sondern für die anderen. Vor allem Sarab sollte ihm endlich vertrauen, damit sie nicht irgendwann dem Besitzer der Stimme glaubte. Also musste er ihr endlich klarmachen, dass er das Mädchen nicht getötet hatte.
Er musste etwas tun. Seine Freunde rieten ihm, der Einsamkeit zu entfliehen und das Haus zu verlassen. Er sollte wieder in sein Büro zurückkehren, bevor er sich noch mehr verlor und endgültig zerstörte. Er hatte schon Sarab genug gequält. Er musste ihr dankbar sein, dass sie ihn ertrug und akzeptierte. Auch weil sie keine Kinder hatten, hätte ihn jede andere Frau schon längst verlassen. Seine seltsamen Geschichten hörte sie sich immer wieder an, weil sie ihn liebte.
Gewiss widerfuhr ihm das nicht allein, ihm, der krank im Kopf war, wie die anderen behaupteten. Nur verheimlichten es die anderen Menschen. Er allein hatte den Mut, offen darüber zu sprechen. Erst in den letzten Jahren begann man offener über die vergangenen Jahre zusprechen. Plötzlich tauchten Geschichten auf, die in den Cafés diskutiert und schließlich in den Zeitungen veröffentlicht wurden. Geschichten über gefälschte Identitäten, über Namensdiebstahl. Manche Geschichten entsprangen eher der Phantasie als der Wirklichkeit. Aber sie wurden geglaubt, mit Ausnahme einer einzigen: der Geschichte des Stimmenbesitzers, der von Jussif die Rückgabe seines Namens und seiner Persönlichkeit verlangte. Diese Geschichte erregte nichts als Zweifel bei ihren Hörern, besonders bei Sarab. Und sie klang jedes Mal anders. Selbst wenn Jussif dieselbe Geschichte erzählte, so doch jeweils auf andere Art und Weise. Es war, als hätte er selbst vergessen, dass er die Geschichte erst vor wenigen Tagen, ja Stunden, schon einmal erzählt hatte. Wenn er unsicher war, ob seine Erzählung tatsächlich stattgefunden habe, nahm er Zuflucht zu einer beliebten Ausrede: dem Traum. Das Wichtigste war, dass Sarab ihm glaubte. Vor allem zu Beginn ihrer Bekanntschaft gab er sich die größte Mühe, die Wahrheit zu verbergen, weil er ihr nicht sagen wollte, dass er einen falschen Namen trage, seit er aus dem Jugendgefängnis entlassen worden sei. Er hasste den Namen, der mit der Ermordung des Mädchens zusammenhing. Als sein Schwiegervater die Geschichte der Namensfälschung hörte, dachte er, Jussif habe sich damit der Einberufung entziehen wollen. Seine Einheit stand kurz vor der Verlegung von Mahawil nach Faw, um mit den dort bereits eingesetzten Soldaten Zerstörung, Dreck, Einsamkeit und Angst zuteilen. In Faw hatten schon die ersten Gefechte begonnen, die ersten Anzeichen des beginnenden Krieges. Er hatte zwar das Gefühl, dass Sarab dieses Argument – sich der Verlegung seiner Einheit an die Front zu entziehen – für eine Namensänderung akzeptiert und ihn sogar dazu ermutigt hätte. Und er zweifelte nie daran, dass sie anders als die anderen jedem seiner Worte glaubte. Trotzdem konnte er ihr erst nach langer Zeit die wahre Geschichte seiner Namensfälschung erzählen, nämlich dass sein Bruder das Mädchen ermordet hatte, in das Jussif verliebt gewesen war.
Sarab nahm seine Worte ernst und fragte ihn immer wieder nach Einzelheiten. Sie war neugierig. Manchmal war er erstaunt, was alles aus seinem Mund hervorsprudelte. Sobald er merkte, dass ein Ohr ihm lauschte, nahm sein Eifer zu. Er ging weiter und weiter, fügte hier und da etwas hinzu, schmückte die Erzählung aus und schönte ein paar Stellen. Es war, als wollte er sich vor Gewissensbissen schützen. Wenn er allein zu Hause oder im Büro war, überkam ihn ein Gefühl der Verlorenheit. Das Gefühl überkam ihn auch im Café, wenn er seine Wasserpfeife rauchte oder wenn er in der geheimen Bar, der Mekka-Bar – diese Geschichte glaubte ihm niemand –, allein vor einem vollen oder halbvollen Glas und einer Viertelliterflasche Zahlawi-Arrak saß. Dann erschien das Bild des kleinen Mädchens vor ihm, wie es sich mit einer Hand am Hals kratzte, mit der anderen ein Stück Kuchen abschnitt. Das Stück fiel zu Boden, und eine Menge Nägel rollten heraus. Gleichzeitig zeichnete sich ein anderes Bild des kleinen Mädchens vor seinem inneren Auge ab: Es hatte grüne Augen, blonde Zöpfe und trug ein blaues T-Shirt. Er erinnerte sich an die kleine Schülerin, an ihr Lachen. Und er hatte ein altes Lied im Ohr. Es war ihm in Erinnerung geblieben, als er vor langer Zeit angefangen hatte, Englisch zu lernen und einen dieser Schwarzweißfilme gesehen hatte: »We never reached Georgia.« Später hatte er dieses Lied zufällig von einer CD gehört, die in einem Laden in der Chajjam-Straße abgespielt wurde. Sobald er dieses Lied vernahm, erinnerte er sich an das Mädchen.
Ganz gleich, wo er war, es konnte auf dem Heimweg sein, im Bus, mitten im Gedränge von Menschen, die nach fauligem Schweiß und ekligem Atem stanken. Wann immer er seiner inneren Stimme lauschte, der anderen Stimme, der zweiten, dritten, vierten ..., überkam ihn eine Art schwermütiger Trauer. Er legte die Hände an die Brust oder auf die Schultern, kratzte sich am Kopf oder fuhr sich durchs Haar. Dabei sagte er sich: »Wenn mir irgendjemand, wenigstens Sarab, glauben würde, dass die Geschichte mit dem Mädchen wirklich geschehen ist und ich nicht der Mörder bin, könnte ich die Angelegenheit vielleicht vergessen.«
Wenn er allein war, vor allem mitten in der Nacht, oder wenn er in den ersten Morgenstunden erschreckt aufwachte, wurde ihm schmerzlich bewusst, dass er sein Verhalten ändern musste. Die anderen hatten durchaus recht mit dem, was sie sagten. Vielleicht war er wirklich ein Mörder. Vielleicht wollte er mit dem Erzählen von Geschichten nur die Geschichte von seinem Verbrechen und seiner Sünde wegerzählen. In jeder anderen seiner Geschichten entwarf er einen speziellen Plan, um vor seinen Opfern zu fliehen: »Der jüngste Tag ist angebrochen, und der Mörder muss seine Schulden begleichen«, wie die Stimme sagte. Was wäre, wenn Sarab ihr glaubte? Wenn sie ihn bat, sich an genau diese Geschichte zu erinnern? Würde er zum ersten Mal die Geschichte des Liedes vergessen, die Geschichte des kleinen Mädchens mit den grünen Augen, den blonden Zöpfen und dem blauen T-Shirt, die Geschichte seines Bruders, die Geschichte von Mariam und den vier Töchtern?
Er streckte seine Hand nach dem Wasserglas aus, das auf der kleinen Kommode am Kopfende seines Bettes stand, und führte es an den Mund. Es war leer. Offensichtlich hatte er es in der vergangenen Nacht ausgetrunken. Er stellte das Glas an seinen Platz zurück, öffnete die Augen und richtete sich langsam auf. Er setzte sich auf den Bettrand und warf einen Blick auf den Wecker mit dem phosphoreszierenden Zifferblatt. Seine Zeiger leuchteten und zeigten vier Uhr morgens an. Der Morgen hatte also noch nicht richtig begonnen, wie er im ersten Moment gedacht hatte, es war noch vollkommen dunkel. Er wollte kein Licht machen, um Sarab nicht in ihrem Schlaf zu stören. Also stand er auf und ging auf Zehenspitzen in den Salon. Dort zündete er die Kerze an, die auf dem kleinen Tisch neben dem Kassettenrekorder stand.
Der Salon öffnete sich zum Schlafzimmer, so dass er von dort aus auch das Bett sehen konnte, das Ehebett. Er sah Sarab in ihrem Schlaf, so wie er sie früher, in den Tagen des Krieges und der Krankheit, kennen gelernt hatte. Das Kerzenlicht ließ sie ruhiger aussehen. Und nicht zum ersten Mal dachte er, dass dieses Licht sie niemals stören würde. Sie schien noch tiefer zu schlafen, wenn das matte Licht im Zimmer tanzte.
Wie gern hätte er sie jetzt zu sich geholt, sie angeschaut und geküsst. Er wollte ihr sagen, dass die fünfundzwanzig Jahre des Betrugs und der Lüge wirklich vorbei seien! Und er wollte ihr erklären, dass es ihm schwerfalle, diese Geschichte zu vergessen. Wie sehr wünschte er sich, dass sie nicht wieder sagen würde: »Du hast diese Worte schon so oft ausgesprochen und gesagt, es sei das Ende der Welt!« Er wusste, dass er sie anlächeln und antworten würde: »Das stimmt nicht, Liebste. So etwas habe ich nie zuvor gesagt. Ich habe doch erst letzte Nacht die Stimme gehört. Sie hat mich besucht und mir stockend erklärt, dass mein Ende naht. Der Besitzer der Stimme wird mich töten, wenn ich nicht erfülle, was er von mir verlangt. Anscheinend muss ich irgendeine Rechnung für ihn begleichen. Aber ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird! Ich hoffe, dass ich niemandem etwas schulde.« Dann würde sie gewiss schweigen und ihm glauben.
Jetzt, mitten in der Nacht oder am frühen Morgen in der zweiten Aprilwoche, erinnerte er sich daran, wie sie zum ersten Mal in diesem Salon gesessen hatten. Direkt vor ihm hing ein großes Foto von ihnen an der Wand: Lachend saßen sie auf demselben Sofa, auf dem er jetzt saß. Sie hatte den Kopf an seine linke Schulter gelehnt. Es war das erste Foto, das sie mit der automatischen Kamera aufgenommen hatten, ein Hochzeitsgeschenk ihres Vaters. An diesem Tag hatten sie auch das Haus zum ersten Mal betreten. Ihr Vater hatte es in dem einfachen, dicht besiedelten Viertel hinter dem Museumsplatz entdeckt und für sie gemietet, bevor sie in ihr zweites Haus in Batawain umzogen. Dies geschah in einer Zeit, als Jussif nicht mehr die Kraft besaß, seine Heimlichtuerei weiter zu betreiben. Er hatte die Fälschung seiner Personalpapiere und seine Fahnenflucht damals nicht deshalb vor ihr verschleiert, weil er fürchtete, sie würde ihm nicht glauben. Vielmehr wollte er sie nicht in die Sache hineinziehen und sie auf keinen Fall beunruhigen. Es war wie beim Versteckspiel von Kindern: Eines Tages musste man vom Schatten ins Licht treten und sich zeigen. Als Jussif merkte, dass Sarabs Vater einen Verdacht hegte, beschloss er, ihr zu enthüllen, dass er sie unter falschem Namen geheiratet hatte. Er hieß nicht Harun Wali, sondern Jussif Mani.
Alles – die Hochzeit, das Mieten des Hauses – musste fast heimlich geschehen. Sie hatten zwar nichts verlautbaren lassen, aber Onkel ’Assim, Sarabs Vater, munkelte, dass es dennoch Schwierigkeiten geben könnte. Sie sollten sich aber keine Sorgen machen, denn Sarabs Vater, der seit den Vierzigerjahren über die politische Arbeit im Untergrund Bescheid wusste, verfügte – wie er stolz behauptete – über einige Erfahrung. Wenn sie die Angelegenheit ihm überließen, würde er sie regeln. Auf die Frage, warum sie ausgerechnet ein Haus im dicht besiedelten Museumsviertel beziehen sollten, lautete die Antwort: Wenn sich jemand verstecken wolle, dürfe er sich nicht verstecken. Er selbst hatte in den Vierzigerjahren als Schneider für den Gründer der Kommunistischen Partei, Fahd, gearbeitet. Gleichzeitig war er aber auch für Nuri al-Sa’id tätig gewesen, einen den Engländern nahestehenden Politiker, der später Regierungschef wurde, bevor das putschende Militär ihn zusammen mit der königlichen Familie Mitte Juli 1958 umbrachte. Auch die meisten anderen Regierungspolitiker hätten sich bei ihm ihre Kleider schneidern lassen. Doch irgendwann hatte er seinen Laden dichtgemacht und war Lokomotivführer geworden. Später hatte er seine Zeit damit verbracht, am Eingang des alten internationalen Bahnhofs herumzulungern. Er war nicht ganz dicht im Kopf.
Dies geschah an einem Frühlingstag, dem 21. März, um genau zu sein. (Jussif war bekannt für seine Leidenschaft für exakte Daten. Es war eine Gewohnheit, die er von seinem Großvater erlernt hatte, einem Dattelinspektor in der Dattelcompany in Basra. Dieser pflegte ein kleines Heft in seiner Jackentasche mit sich herumzutragen, in das er alle Daten eintrug, die ihm wichtig erschienen.) Er erinnerte sich nicht nur wegen seiner Leidenschaft für exakte Daten an diesen Tag, sondern auch weil er gemeinsam mit Sarab beschlossen hatte, diesen Tag jährlich zu feiern. Am 21. März 1979 hatten sie sich auf dem letztmalig gefeierten Nouruz-Fest kennen gelernt, bevor die Regierung es den Kurden grundsätzlich untersagte. Sie saßen im Café im Garten des British Council in Bagdad. Er war erst vor kurzem aus seiner Einheit desertiert und mit ein paar Freunden von der Akademie der Schönen Künste gekommen, die nichts von seiner Fahnenflucht wussten. Sarab erinnerte sich an einen mageren jungen Mann mit großen Augen, breitem Mund und ausgeprägter Nase. »Er näherte sich mir, und als er meinen Namen hörte, sagte er: ›Seit meiner Kindheit habe ich diesen Namen wieder und wieder gehört: Sarab.‹ Und er fügte fröhlich hinzu: ›Darf ich Sie auf ein Glas Tee einladen?‹« Von diesem Tag an stach Jussifs Gesicht für sie aus der Schar seiner Freunde im Garten des British Council