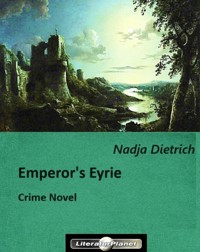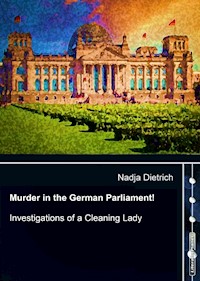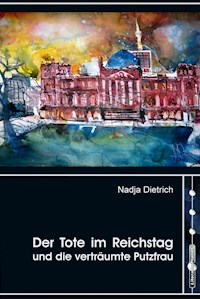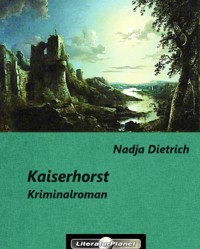
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: LiteraturPlanet
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein abendlicher Spaziergang im Wald. Da dringt plötzlich ein Schmerzensschrei aus einer Jagdhütte. Für den nächtlichen Wanderer ist das der Beginn einer Odyssee, die ihn über eine psychiatrische Anstalt und eine einsame Berghütte bis zu einem mysteriösen Ort namens "Kaiserhorst" führt. – Ein Kriminalroman in Tagebuchform über rechtsnationale Netzwerke und die vielen Gesichter der Wirklichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nadja Dietrich
Kaiserhorst
Kriminalroman
Literaturplanet
Impressum
© Verlag LiteraturPlanet, 2024
Im Borresch 14
66606 St. Wendel
http://www.literaturplanet.de
Über dieses Buch: Ein abendlicher Spaziergang im Wald. Da dringt plötzlich ein Schmerzensschrei aus einer Jagdhütte. Für den nächtlichen Wanderer ist das der Beginn einer Odyssee, die ihn über eine psychiatrische Anstalt und eine einsame Berghütte bis zu einem mysteriösen Ort namens "Kaiserhorst" führt. – Ein Kriminalroman in Tagebuchform über rechtsnationale Netzwerke und die vielen Gesichter der Wirklichkeit.
Über die Autorin: Nadja Dietrich hat lange in Russland gelebt und gearbeitet. Heute lebt sie als freie Autorin in Lothringen. Der vorliegende Roman ist nach Das russische Labyrinth (2008) und Mord im Reichstag (2017, überarbeitete Fassung 2022) ihre dritte Veröffentlichung bei LiteraturPlanet. Ein Interview zu dem Roman findet sich auf rotherbaron.com.
Cover-Bild: Abraham Pether (1756 – 1812): Pendragon Castle bei Mondschein (National Trust / Wikimedia Commons)
Titelbilder zu den einzelnen Romanteilen:
I. In der Psychiatrie: ID 8385: Kopf (Pixabay)
II. In den Bergen: Leonhard Niederwimmer: Berghütte (Pixabay)
III. In einem Hotelzimmer: Armelion: Wendeltreppe am Dubliner Trinity College (Pixabay)
IV. Im Tagungshotel "Kaiserforst": J.M.W. Turner (1775 – 1851): Dolbadern Castle (1800); Wikimedia commons
Vorwort der Herausgeberin
Vor ein paar Wochen habe ich Post von einem Notar erhalten. Darin teilte dieser mir mit, dass einer seiner Mandanten, Herr Carlo Iskalzi, ihm den Auftrag erteilt habe, mir beiliegendes Manuskript zu schicken, sollte er auf ungeklärte Weise aus dem Leben scheiden oder verschwinden. In letzterem Fall sei eine Frist von sechs Monaten, gerechnet vom Tag des Bekanntwerdens des Verschwindens an, einzuhalten. Da diese Frist nun abgelaufen sei, erhielte ich in der Anlage das in Frage stehende Manuskript.
Von dem Fall der beiden Verschwundenen hatte ich schon etwas gehört. Er war recht spektakulär gewesen, weshalb in den Medien ausführlich darüber berichtet worden war. Herr Iskalzi und seine Freundin hatten sich, nachdem sie schon einige Zeit zusammengelebt hatten, das Jawort gegeben. Während ihrer Flitterwochen auf einem Kreuzfahrtschiff waren sie in Neapel an Land gegangen und dort nach einem Tagesausflug nicht mehr zum Schiff zurückgekehrt. Die Suche nach ihnen blieb erfolglos und wurde schließlich abgebrochen.
Das spurlose Verschwinden des Paares hatte zu wildesten Spekulationen Anlass gegeben. Viele waren überzeugt, die Camorra müsse ihre Hände im Spiel haben, andere munkelten von nordafrikanischen Banden, wieder andere gingen von einem banalen Raubmord oder Badeunfall aus.
Als Wochen später Berichte auftauchten, wonach das Paar angeblich auf Malta gesichtet worden sei, hatte auch das wieder die Gerüchteküche angeheizt. Manche sahen in dem Paar nun Steuerflüchtlinge, die ihr Verschwinden nur inszeniert hätten, andere meinten, sie wären in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden, um Mafia-Verbrechen vor Gericht zu bringen. Nachdem auch diese Welle medialer Erregung wieder abgeebbt war, hatte ich den Fall schließlich vergessen – bis ich den Brief von dem Notar erhielt.
Was ich nicht verstehe, ist, warum der Autor ausgerechnet mich als potenzielle Empfängerin seines Manuskripts angegeben hat. Weder habe ich mich intensiver mit Vorfällen der Art, wie sie Herr Iskalzi in seinem Manuskript beschreibt, auseinandergesetzt, noch bin ich mit dem Autor oder seiner Frau persönlich bekannt. Ich kann nur mutmaßen, dass Herr Iskalzi mich vielleicht besser zu kennen meint, als ich ihn kenne.
Dennoch konnte ich dem Autor seine (posthume?) Bitte, für eine Veröffentlichung seines Manuskripts zu sorgen, selbstverständlich nicht abschlagen. Allerdings sah ich mich dabei vor ein Problem gestellt: Offensichtlich war Herrn Iskalzi vor allem daran gelegen, die in der Tat ungeheuerlichen Geschehnisse, von denen er in seinem Manuskript berichtet, öffentlich zu machen. Nun handelt es sich aber bei dem Manuskript um ein Tagebuch – und das ist etwas ganz anderes als ein Tatsachenbericht.
Während Letzterer sich auf die wesentlichen Ereignisse konzentriert, enthält ein Tagebuch auch zahlreiche sehr private, subjektive Aussagen, Meinungsschnipsel und emotionale Momentaufnahmen, die unter Umständen eine ablenkende Wirkung entfalten können. So sah ich mich mit der Frage konfrontiert, ob ich hier nicht redaktionell eingreifen, sprich Kürzungen vornehmen sollte.
Am Ende habe ich mich aber nur dazu durchringen können, die einzelnen Abschnitte des Tagebuchs, der besseren Übersicht halber, durch Ortsangaben und Zwischenüberschriften kenntlich zu machen. Außerdem habe ich die an einigen Stellen dem Tagebuch beigefügten Schriftstücke kursiv gesetzt. Von Streichungen habe ich dagegen abgesehen.
Der Hauptgrund für meine Skrupel in dieser Hinsicht war, dass vieles von dem, was mir anfangs entbehrlich erschien, beim zweiten Lesen doch eine untergründige Beziehung zu den geschilderten Ereignissen offenbarte. Vor allem aber hätte ich mich mit dem Rotstift in der Hand gefühlt, als würde ich nachträglich ein fremdes Leben zensieren.
Das Leben eines Menschen erschöpft sich nun einmal nicht in einer einzigen Geschichte. Vielmehr entsteht erst aus der Summe der vielen Geschichten, die es erzählt oder in die es eingeflossen ist, die einmalige, unverwechselbare Signatur des gelebten Lebens.
So hoffe ich, dass auch in diesem Fall all die zunächst dissonant wirkenden Ich-Fragmente am Ende doch zu einer gemeinsamen Melodie zusammenfließen.
I. In der Psychiatrie
1. Der Weg in die Psychiatrie
Donnerstag, 3. November
Manchmal stelle ich mich vor den Plastikspiegel neben dem vergitterten Fenster und brülle mich selbst an. Meistens gebe ich dann nur unartikulierte Laute von mir – und auch das nur ganz kurz, um nicht wieder von starken Armen gepackt, ans Bett gefesselt und mit einer Spritze in den Dämmerzustand versetzt zu werden, in dem hier alles Leben versunken ist.
Zuweilen senke ich aber auch unvermittelt die Stimme, umfasse den Spiegel mit beiden Händen und sehe mir direkt in die Augen. Schwer atmend frage ich mich dann: "Was hast du nur getan? Ist dir überhaupt klar, wo du hier gelandet bist? – In – der – Psy – chia – trie! Als – Geis – tes – ge – stört – ter!"
Dabei tasten meine Blicke forschend über die Landschaft meines Gesichts: die Wangentäler, den Lippengrat, das hell schimmernde Wangenmoos, die dunklen Schluchten unter den blauen Augenseen, die Macchia meiner schulterlangen Haare …
Nein, es ist eine eher unwirtliche Landschaft, die sich hier dem Auge bietet. Ich habe einfach keine Lust mehr, den Schein eines einladenden Äußeren in mein Gesicht zu zaubern. Wozu auch? Für wen denn? Weshalb sollte ich in einer feindseligen Umgebung Offenheit und Entgegenkommen ausstrahlen? Würde ich damit nicht sogar die letzte Bastion des Selbstschutzes aufgeben? Andererseits: Werde ich so nicht dem Bild immer ähnlicher, das man hier von mir entworfen hat?
Ja, ich bin zu weit gegangen. Ich hätte auf Esther hören sollen. Immer wieder hat sie mich vor Leppin gewarnt, vor den Netzwerken, über die er die Dinge in seinem Sinne beeinflussen kann. Es war leichtsinnig von mir, nicht von ihm abzulassen, immer neue Versuche zu starten, ihn aus der Reserve zu locken.
Aber was hätte ich denn sonst tun sollen? Leppin war und ist nun einmal das einzige Puzzlestück, das ich in den Händen halte. Nur über ihn kann ich der Lösung des Rätsels näherkommen, in das ich so plötzlich hineingestürzt bin.
Nie hätte ich gedacht, dass ausgerechnet ich, der ich die Jagd schon immer verabscheut habe, mich einmal so brennend für eine Jagdhütte interessieren würde.
Habe ich wirklich "brennend" geschrieben? Dass ich den Ausdruck noch so unbefangen verwenden kann …
Wie auch immer: Die Jagdhütte ist nun einmal der Ort, wo alles begonnen hat, das Sternentor, durch das ich in ein Paralleluniversum geschleudert worden bin, in dem alles so aussieht wie in meiner früheren Welt, in dem nichts sich verändert zu haben scheint und wo auch ich mich so fühle wie immer – nur dass meine Umgebung in mir dort einen anderen sieht.
Von Anfang an war klar, dass ich die Anschuldigungen gegen mich nur aus der Welt schaffen könnte, wenn es mir gelänge, den Besitzer der Jagdhütte ausfindig zu machen. Schon das erforderte eine ziemliche Wühlarbeit. Meine Anfragen bei Bürgerbüro, Grundbuch- und Katasteramt liefen alle ins Leere: "Datenschutz, Sie verstehen …"
Zum Glück war jedoch Esthers Chef, ein Rechtsanwalt, Mitglied der zuständigen Jagdgenossenschaft. Auf diese Weise bin ich schließlich doch noch an den Namen des Besitzers gekommen. Es handelte sich um niemand anderen als um Bruno Leppin, den bekannten Abgeordneten, der gerade seine erneute Kandidatur für einen Sitz im Parlament bekannt gegeben hatte.
Leppin hatte ich an dem fraglichen Abend nicht in der Jagdhütte gesehen – zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern. So bestand durchaus die Möglichkeit, dass er mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hatte. Warum also, dachte ich mir, sollte ich dann nicht einfach mit ihm darüber reden? Vielleicht würde ich bei ihm ja sogar auf mehr Verständnis stoßen als bei der Polizei. Müsste er als Besitzer der Jagdhütte nicht sogar ein besonderes Interesse an der vollständigen Aufklärung der Vorkommnisse haben?
Ich hätte es besser wissen müssen … Leppin erwies sich als genau der arrogante Schnösel, als den ich ihn von seinen Auftritten im Parlament und in den diversen Talkshows kannte. Als ich ihn nach einer Wahlkampfveranstaltung auf mein Anliegen ansprach, ließ er mich einfach stehen.
"Besprechen Sie das bitte mit meinem Anwalt", beschied er mich – und verschanzte sich dann hinter seiner Bodyguard-Wand. Bei einem zweiten Versuch, in seine Nähe zu kommen, schob diese Wand sich sogar schon vor mich, bevor ich Leppin überhaupt erreicht hatte.
So griff ich schließlich zu einer List: Ich gab mich seinem Büro gegenüber als Reporter aus, der für eine bekannte Tageszeitung arbeite. Diese Schein-Identität öffnete mir problemlos die Tür zum Allerheiligsten. "Ja", versicherte mir die Büroleiterin mit ausgesuchter Höflichkeit, "Herr Dr. Leppin ist gerne bereit, Sie für ein Interview zu empfangen." Ich solle nur bitte die Fragen vorher einreichen.
Da ich ohnehin nicht vorhatte, Leppin zu interviewen, formulierte ich schlicht sein Wahlprogramm in eine Interviewskizze um. Das ging natürlich ohne Beanstandung durch. Dann maskierte ich mich mit einer dunklen Perücke und einer randlosen, leicht abgedunkelten Brille.
Tatsächlich gelang es mir so zunächst, Leppin zu täuschen. Als eine seiner Minirock-Hostessen mich in sein Büro führte, schenkte er dem vermeintlichen Interviewer sein professionellstes Politikergrinsen. Ich wartete, bis das Püppchen uns Kaffee und Kekse serviert hatte, dann sprach ich ihn noch einmal auf seine Jagdhütte an.
Ich sehe ihn noch genau vor mir, wie er in seinem holzgetäfelten Büro hinter dem Schreibtisch thront und seinen Ärger mit selbstgefälliger Belustigung zu kaschieren versucht … Er wischte sich demonstrativ einen Fussel von seinem Jackett, das wie immer modische Anklänge an ein Trachtenjankerl aufwies, dann grinste er mir höhnisch ins Gesicht: "Aha – ein fingiertes Interview … Raffiniert … Aber was, wenn der Interviewpartner nicht mitspielt? Wenn er ganz einfach die Polizei ruft, um den Eindringling abführen zu lassen?"
"Ich möchte doch nur mit Ihnen reden!" wehrte ich mich. "Ich verstehe gar nicht, was daran so schlimm sein soll. Es geht ja nur um eine ganz banale Auskunft: Ich möchte lediglich wissen, ob Sie …"
Aber Leppin ließ mich nicht ausreden. "Frau Schneider", schnarrte er in die Gegensprechanlage, "unser Gast möchte gehen. Das Interview ist beendet."
Wenige Sekunden später betrat das Bürohäschen in Begleitung der lebenden Schrankwände das Zimmer, und ich wurde wortlos hinauskomplimentiert. Am nächsten Tag erhielt ich ein Schreiben von Leppins Anwalt, in dem dieser mir unter Androhung diverser Gemeinheiten untersagte, mich seinem Mandanten weiterhin zu nähern.
Esther riet mir daraufhin eindringlich davon ab, meinen Feldzug gegen Leppin fortzusetzen. Ich solle erst einmal die Gerichtsverhandlung abwarten. Da müsse Leppin schließlich unter Eid aussagen – mit den richtigen Fragen würde ein guter Anwalt ihn da schon zum Sprechen bringen.
Sie hatte natürlich Recht. Ich aber wollte und konnte jetzt nicht mehr zurückstecken. Leppins herablassende Art stachelte mich erst recht dazu an, die Auseinandersetzung mit ihm zu suchen. Jetzt wollte ich ihn nicht mehr nur zur Rede stellen. Jetzt wollte ich ihn bloßstellen. Seine Weigerung, mit mir zu reden, deutete ich als eine Art Schuldeingeständnis. Warum sollte er alle Gesprächsversuche so brüsk zurückweisen, wenn er mit der Angelegenheit nichts zu tun hatte?
So versuchte ich als Nächstes, öffentliches Interesse für den Vorfall zu wecken. Dafür suchte ich mir gezielt eine Wahlkampfveranstaltung auf einem größeren Marktplatz aus, an einem Ort also, wo mit mehr Publikum zu rechnen war. Dies sollte es mir zum einen erleichtern, unbemerkt an Leppin heranzukommen. Zum anderen hoffte ich auf diese Weise auch eine größere Wirkung zu erzielen.
Leppin hielt im Grunde immer dieselbe Rede, mit immer denselben Versatzstücken, die er nur unwesentlich variierte und mit aktuellen Bezügen anreicherte. So konnte ich mir schon im Vorfeld eine Passage aussuchen, die besonders gut zu meinem geplanten Auftritt passte.
Und tatsächlich: Leppin enttäuschte mich nicht. Wie immer erhob er irgendwann die Stimme und warnte voller Pathos vor Überfremdung, Terrorgefahr und dem Verlust der Sicherheit seiner überaus geschätzten "Mitbürgerinnen und Mitbürger". Von hier aus leitete er nahtlos über zum Schutz der Natur, die ebenfalls durch die "Einschleppung fremder Elemente" bedroht sei. Wie das Volk sei auch die Natur nur durch die kompromisslose "Ausmerzung des Artfremden" zu schützen – weshalb er für eine konsequente Ausdehnung der Jagd eintrete.
Genau in dem Moment sprang ich auf die Bühne und hielt ein Transparent in die Höhe. Darauf hatte ich in roter Farbe geschrieben: "Dieser Jäger ist ein Mörder!"
Ein Raunen ging durch die Menge. Leppin war für einen Augenblick konsterniert, fing sich aber sofort wieder. "Sehen Sie, meine Damen und Herren", setzte er seine Rede fort, "das ist genau das, was ich meine. Unsere Demokratie ist heute bedroht von Elementen, die vor nichts – auch nicht vor der Anwendung von Gewalt! – zurückschrecken. Deshalb brauchen wir heute mehr denn je ein entschlossenes Bekenntnis zum Rechtsstaat. Gesetze sind dazu da, um angewendet zu werden, meine Damen und Herren! Mit aller Härte! Wenn wir den Extremismus heute nicht entschlossen bekämpfen, werden wir morgen den Kampf gegen ihn verlieren!"
Applaus erhob sich, begleitet von zustimmendem Gemurmel. Ich selbst war da schon längst überwältigt worden – dieses Mal allerdings nicht von Leppins Leibgarde. Es war eine öffentliche Veranstaltung, also wurde ich nach allen Regeln der Kunst von zwei Polizisten abgeführt, die sich, wie mir hier schien, nicht ohne Stolz als entschlossene Verteidiger des Rechtsstaats präsentierten.
Es war ein einziges Desaster. Ich hatte das Gegenteil von dem erreicht, was ich mir von der Aktion erhofft hatte. Statt Leppin vor aller Welt bloßzustellen, war es ihm gelungen, mich zu einer Art Wahlkampf-Gag umzufunktionieren und mich als Werbemittel für seinen Law-and-Order-Feldzug zu missbrauchen. Ich war es, der sich lächerlich gemacht hatte, ich war es, der als Gefahr für die öffentliche Ordnung vorgeführt wurde.
Diese Verdrehung der Tatsachen brachte mich völlig aus der Fassung. Als ich dann auch noch – weil gegen mich ja bereits ein Verfahren lief – dem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde, verlor ich endgültig den Boden unter den Füßen. Das, was sich "Befragung" nannte, glich in Wahrheit eher einer Verlesung der zehn Gebote. In jeder Frage steckte der unerschütterliche Glaube an eine Realität, die nicht die meine war – und in der ich folglich auch nicht jene Tatsachen zur Sprache bringen konnte, die mein Tun hätten erklären können.
So endete die kurze Vernehmung schließlich mit einem Eklat. Ich riss mich von meinen Bewachern los und baute mich direkt vor dem Richter auf. "Willst du dich etwa zum Komplizen dieses Mörders machen?" fuhr ich ihn an. "Was ist das denn für eine Gerechtigkeit? Ihr zerstört den Rechtsstaat, wo ihr ihn zu schützen vorgebt!"
Als man mir als Reaktion auf meinen bühnenreifen Auftritt Handschellen anlegen wollte, hatte ich das Gefühl, als würde mir jemand die Kehle zudrücken. Ich tobte, ich schrie – und schlug in meiner Verzweiflung sogar eine Fensterscheibe ein. Obwohl ich keinesfalls vorhatte, mich aus dem Fenster zu stürzen – schließlich befand sich der Verhandlungsraum im sechsten Stock, und ich war keineswegs lebensmüde –, deutete man mein Verhalten als Selbstmordversuch.
Die Folge war, dass ich mein Seelenleben von einem psychiatrischen Gutachter sezieren lassen musste. Dieser konstatierte "partiellen Realitätsverlust, verbunden mit Verfolgungswahn und suizidalen Tendenzen".
Damit hatte ich sozusagen die Eintrittskarte in dieses Reich hier gelöst, das Reich des verdüsterten Verstandes, die Höhlenwelt, in der jene zu leben haben, die sich nicht von dem Licht der einen, allein selig machenden Wirklichkeit erleuchten lassen wollen.
2. Enteignete Wirklichkeit
Sonntag, 6. November
Je länger ich in dieser Anstalt bleiben muss, desto mehr beginne ich daran zu zweifeln, ob die Bilder in meinem Kopf mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Es ist wie bei einem Farbenblinden, der zusammen mit 99 anderen, nicht farbenblinden Menschen ein Gemälde betrachtet. Irgendwann wird er eben doch einsehen, dass er die Farben nicht so sieht, wie sie in Wirklichkeit sind.
Nein, der Vergleich ist schlecht gewählt! Bei dem Farbenblinden beruht die abweichende Wahrnehmung ja auf einer organischen Anomalie, die man ihm gegebenenfalls nachweisen kann, wenn er auf der "Wahrheit" des von ihm Wahrgenommenen besteht.
Außerdem geht es in diesem Fall ja nur um eine Nuance der Wirklichkeitswahrnehmung. Blau oder grün, was macht das schon für einen Unterschied! Mir aber hat man die gesamte Wirklichkeit gestohlen, ich bin sozusagen geistig enteignet worden und befinde mich nun in einem wirklichkeitslosen Raum, allein mit den Bildern in meinem Kopf: ein Schiffbrüchiger auf dem Meer des Geistes, der allmählich in seinen inneren Sturmfluten ertrinkt.
Nicht zuletzt kann sich der Farbenblinde auch damit trösten, dass die "Wirklichkeit" etwas sehr Relatives ist: Sehen die Fliegen die Wirklichkeit falsch, weil sie sie anders sehen? Bei mir geht es aber nicht um ein erkenntnistheoretisches Problem, sondern letztlich um Leben oder Tod. Sofern das, was ich gesehen habe, wahr ist – und warum sollte ich daran zweifeln? –, läuft irgendwo eine sadistische Mörderbande frei herum, die nur auf die Gelegenheit wartet, ein weiteres hinterhältiges Verbrechen zu begehen.
Vielleicht haben die Mörder seit meiner Verhaftung sogar längst wieder zugeschlagen. Wenn zutrifft, wovon ich ausgehen muss – dass die Täter die Spuren ihrer Verbrechen mit einer gespenstischen (weil die Wirklichkeit verdrehenden) Akribie verwischen –, kann niemand wissen, welche Bluttaten sie in der Zwischenzeit noch begangen haben.
Das Schlimme ist, dass ich langsam wirklich den Eindruck habe, den Verstand zu verlieren. Die Diagnose "geisteskrank" wirkt wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Es macht mich buchstäblich verrückt, dass ich mit niemandem über das reden kann, was mir widerfahren ist – oder vielmehr nur so darüber reden kann, als würde es sich dabei um Wahnvorstellungen eines Junkies handeln.
Nicht nur die Tatsache an sich, dass man mich für bekloppt hält, quält mich. Dadurch, dass meinen inneren Bildern die Osmose mit der äußeren Wirklichkeit verweigert wird, haben diese in mir eine Eigendynamik entfaltet, die mich wie ein geistiges Krebsgeschwür von innen heraus zerfrisst. Die Bilder wuchern, sie gebären ständig neue Bilder, die in meinen Träumen groteske Formen annehmen und sich mit längst vergessenen Gedanken, Gefühlen, Ereignissen vermengen.
Dann stoße ich nachts diese kehligen Schreie aus, durch welche die an Alpträumen Leidenden selbst wie die Gespenster wirken, von denen sie heimgesucht werden. Ich wache schwer atmend und schweißgebadet auf und muss nach der Nachtschwester klingeln, um ein Beruhigungsmittel zu bekommen. Ein Glas Wein würde mir wahrscheinlich auch helfen, aber so etwas bekommt man hier natürlich nicht.
Dabei weiß ich genau, dass die Pflegerin der Therapeutin von dem Vorfall Bericht erstatten wird – sie ist ja verpflichtet, jeden Handgriff in eine Tabelle einzutragen. Bei der nächsten Sitzung blicke ich dann wieder in diese mitleidstriefende Ich-versteh-dich-schon-Grimasse, die mich hier wie ein verzerrtes Spiegelbild von allen Seiten anglotzt.
Ein paar Mal bin ich schon richtig ausgerastet. Das verfestigt zwar meinen Bekloppten-Status, ist andererseits aber auch eine der wenigen Freiheiten, die man hat, wenn man von Amts wegen als geisteskrank eingestuft worden ist. Und da ich scheinbar ohnehin nichts an dem Bild ändern kann, das man sich hier von mir zurechtgelegt hat, kann ich ja auch von den Vorteilen profitieren, die meine Situation mit sich bringt. Also werfe ich manchmal den Kaffeebecher an die Wand – er ist zwar nur aus Plastik, aber wenn er voll ist, gibt das trotzdem einen ziemlichen Krawall –, oder ich stoße wilde Urschreie aus, bis die Pflegerin kommt und mich beruhigt.
Natürlich mache ich das nur, wenn Magdalena da ist. Sie gehört zu der fortschrittlicheren Pflegerinnensorte, die es erst mal mit sanften Mitteln versucht, ehe sie zu Tabletten und Spritzen greift. Außerdem hat sie etwas ausgesprochen Mütterliches an sich. Mit den weichen Polstern, die ihren Körper luftkissenartig umgeben, fühlt sie sich an wie ein warmes Moosbett, das einen die Heimtücke der Welt für ein paar Augenblicke vergessen lässt. Deshalb tut es mir einfach gut, mich von Zeit zu Zeit von ihr in den Arm nehmen zu lassen.
Dann seufze ich aus tiefstem Herzen, und sie streicht mir über den Kopf wie früher meine Mama, wenn ich wieder mal beim Rollschuhfahren auf die Knie gefallen war. Ich glaube, sie weiß ganz genau, was ich mit meinen "Anfällen" bezwecke – auch wenn es ihr wahrscheinlich lieber wäre, wenn ich meine Wünsche auf andere Weise artikulieren würde.
Aber meine Ausraster sind eben in dem sozialen Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, der einzige Code, mit dem ich auf mein Bedürfnis nach Nähe aufmerksam machen kann. Ich kann nicht einfach zu ihr sagen: "Ach bitte, drück mich doch mal ein bisschen" – das ist nun mal in dem gegebenen Rahmen nicht akzeptiert.
3. Esther und "Ándschela"
Dienstag, 8. November
Besuch von Esther. Sie fragt mich, wie es mit der Therapeutin klappt. "Schlecht", sage ich, aber sie lobt mich trotzdem dafür, dass ich mich der Therapie nicht mehr verweigere, von wegen "guter Führung" und so. Es ärgert mich, dass sie die Dinge so "vernünftig" sieht, aber ich schlucke meinen Ärger herunter und sage nichts.
Es wäre auch ungerecht von mir, ihr ihre pragmatische Haltung zum Vorwurf zu machen. Schließlich habe ich es nur ihrem Verhandlungsgeschick zu verdanken, dass die Anstaltsleitung meinem Wunsch, eine weibliche Therapeutin zu bekommen, entsprochen hat.
Nicht, dass ich grundsätzlich etwas gegen männliche Therapeuten hätte – aber ich habe nun einmal allzu oft die Erfahrung gemacht, dass das unmittelbare Aufeinandertreffen zweier Männer zu einer Art Hahnenkampf führt, bei dem einer dem anderen seine Überlegenheit zu beweisen versucht. Da ich aber der Definitionsmacht des Therapeuten ausgeliefert wäre, wäre in diesem Fall noch nicht einmal eine faire Auseinandersetzung möglich. Stattdessen würde man von mir wohl schlicht eine Unterwerfungsgeste erwarten.
Dies ist natürlich auch bei einer weiblichen Therapeutin möglich. Immerhin fällt hier aber die männliche Konkurrenzsituation weg. Wenn ich Glück habe, tritt an deren Stelle ein mitschwingendes Verstehen, das weit eher zu einer Verbesserung meiner Lage beitragen kann.
Ob das bei meiner neuen Therapeutin der Fall ist, scheint mir allerdings fraglich. Sie heißt Angela und spricht ihren Namen italienischaus – "Ándschela". Dabei passt nach meinem Empfinden die banal-strenge deutsche Variante weit eher zu ihr. Die erste Sitzung mit ihr hat mich jedenfalls nicht gerade hoffnungsfroh gestimmt.
Nicht nur bleibt ja das grundsätzliche Problem, dass sich durch die Therapie der Bekloppten-Status verfestigt, bestehen. Die Psychologen-Attitüde des Besserwissers, der die tieferen Beweggründe des Denkens und Handelns seiner Mitmenschen zu durchschauen meint, ist bei Angela auch besonders stark ausgeprägt. In Verbindung mit der nach außen hin an den Tag gelegten Kumpelhaftigkeit und dem lässigen Umgangston, die dem Gegenüber den Eindruck vermitteln sollen, sich mit einer guten Freundin zu unterhalten, wirkt dieses Verhaltensmuster auf mich ausgesprochen hinterhältig.
Esthers hilfloses Lächeln, als ich nach ihrer Bemerkung über die Therapie in düsteres Schweigen verfalle … Manchmal habe ich Angst, mich allmählich von ihr zu entfremden. Die Distanz zwischen ihrer und meiner momentanen Wirklichkeit ist einfach zu groß.
Dabei weiß ich natürlich auch, dass unsere Rollenverteilung auf einem puren Zufall beruht. Wenn die Dinge auch nur minimal anders gelaufen wären, wäre ich jetzt derjenige, der draußen in der "wirklichen" Welt nach Taktiken und Strategien für eine Lösung des Falles und eine Befreiung Esthers suchen würde, während sie in das Korsett des Wahnsinns gezwängt wäre und mit entsprechender Ungeduld auf meine wohlüberlegte Vorgehensweise reagieren würde.
Natürlich ist Esther nicht so impulsiv wie ich, so dass der Richter ihr vielleicht mit größerer Milde begegnet wäre als mir. Aber letztlich war ja mein Auftritt vor Gericht auch nicht der einzige Grund dafür, dass ich hier gelandet bin. Ausschlaggebend war am Ende wohl der Zweifel an meiner Fähigkeit, innere von äußeren Bildern zu unterscheiden. Und in diesem Punkt wäre Esther fraglos genauso gescheitert wie ich. Wäre sie ruhig geblieben, hätte man ihr das wahrscheinlich nur als "Apathie" ausgelegt – und damit eben eine andere Möglichkeit gefunden, die Geisteskranken-Hypothesezu bestätigen.
Der Gedanke, dass Esther jetzt ganz allein nach Spuren der Verbrecher sucht – und ich sie darin auch noch unterstützen muss, weil das die einzige Möglichkeit ist, mich zu rehabilitieren –, trägt auch nicht gerade zu meiner Beruhigung bei.
Zwar ist mir klar, dass der Eindruck der Zerbrechlichkeit, den Esther durch ihre etwas brüchige Stimme und das schmale Gesicht mit den tief liegenden Augen erweckt, eine Täuschung ist. Oft genug hat sie in brenzligen Situationen mehr Mut gezeigt und besonnener gehandelt als ich. Dennoch wäre sie Tätern wie denen, die diese Verbrechen begangen haben, im Ernstfall wohl hilflos ausgeliefert.
Das gibt den Angstzuständen, in denen ich mich nach meinen nächtlichen Alpträumen im Bett herumwälze, einen realen Hintergrund: Fühlen die Verbrecher sich sicher genug, um Esther und mich am Leben zu lassen? Oder warten sie nur auf die passende Gelegenheit, um uns beide aus der Welt zu schaffen?
4. Im Wald der Erinnerungen
Freitag, 11. November
Es hilft ja alles nichts – ich muss mich den vergangenen Ereignissen stellen. Noch einmal rekapitulieren, was geschehen ist. Noch einmal mit vollem Bewusstsein eintauchen in das Meer, das mich verschlungen hat.
Was ist es nur, das mich davon abhält?
Ist es mir vielleicht zu langweilig, mich in meiner imaginären Klause mit denselben Dingen zu beschäftigen, die auch sonst meinen Alltag bestimmen? Störe ich mich daran, auch noch den letzten Freiraum aufzugeben, mich vollständig an das zu ketten, was mich an diesen Ort geführt hat?
Schließlich habe ich ja schon bei der Polizei, in den Gesprächen mit dem Anwalt, dem Gutachter und vor Gericht unzählige Male zu Protokoll gegeben, was ich gesehen habe. Und die hochnotpeinlichen Gespräche, die man mich hier unter dem Etikett "Therapiesitzungen" zu führen zwingt, kreisen ja auch um nichts anderes.
Trotzdem: Vielleicht kann ich, wenn ich mich noch einmal ganz allein in den Wald der Erinnerungen begebe, etwas entdecken, das ich bislang, unter den Augen der anderen, übersehen habe.
Aber geht das hier überhaupt – etwas unbeobachtet tun? Womöglich ist ja gerade das mein größtes Hindernis auf dem Weg zu einer Zwiesprache mit mir selbst: dieses Gefühl, dass mir ständig jemand über die Schulter schaut, auch jetzt, während ich an diesem klapprigen Tisch sitze und meine Gedanken zu ordnen versuche.
Denn genau das ist ja das Ziel all der Gruppen- und Einzel- und Zweiertherapien, all der raffinierten Übungen und Tests und Meditationen, die angeblich "nur zu meinem Besten" angesetzt werden: Man möchte in mich eindringen, mein Innerstes soll nach außen gekehrt und so lange seziert werden, bis nur noch die leere Hülle meines Ichs zurückbleibt. Die füllt man dann mit einer Instantseele, mit der man mich gefahrlos in die Freiheit entlassen kann – in eine Freiheit, die für mich dann keine mehr wäre.
Andererseits: Selbst wenn jemand in meiner Abwesenheit mein Zimmer durchsuchen und auf diese Aufzeichnungen stoßen sollte – was würde er schon entdecken?